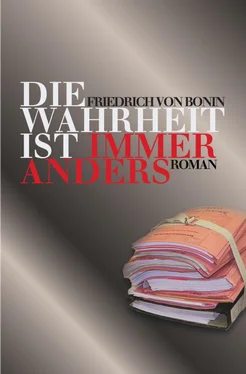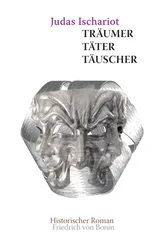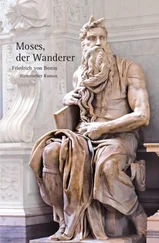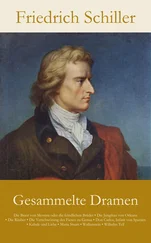Vier Tage hatte der Sturm gewütet, erinnerte sich Eduard, und zwei Wochen danach die Kälte. In dieser Periode war kein Raum für Scham und Gewissensbisse. Froh war er gewesen, dass er Vorräte gestohlen hatte, sie hätten sonst die Kälte nur schwer überlebt.
Wohlig spürte Eduard die Wärme der Sonne auf seinem Rücken, wie sie jetzt auf den Wald zugingen, er wollte nicht an Krieg denken, nicht an Töten und Stehlen, er sah die Sonne, hörte die Vögel und fühlte die Hand seiner Schwester in der seinen. Sie waren zusammen, es war warm und zu essen würde er heute Nachmittag auch finden. Schon oft waren sie in diesem Sommer unterwegs gewesen, und hatten immer etwas entdeckt. Heute hatte er sich aber etwas Besonderes ausgedacht. Er wollte mit seiner Schwester zusammen Kartoffeln von den Feldern holen, Rüben und was sie sonst noch fanden. Diesmal brauchte er etwas mehr, als sie essen wollten. Anni hatte gefragt, warum er nicht auf dem Grundstück der Villa Kartoffeln pflanzen konnte, Rüben und alles Gemüse, das sie fanden. Er brauchte dazu nur Saatgut, Früchte, die er in die Erde pflanzen konnte.
Und so gingen sie durch den Forst, schweigend. Seine Schwester plauderte nicht wie sonst, sondern schien wie er die Wärme zu genießen, die Sonnenstrahlen, die durch die Blätter der Bäume auf den gelben Sandweg schienen.
Jetzt erreichten sie den Rand des Waldes und waren wieder am Abhang, da, wo die flache Landschaft, in der die Stadt lag, sich sanft erhob zu weich gerundeten Hügeln, zu denen sie hinaufsahen. An den Abhängen lagen malerisch Felder, auf denen jetzt, im Hochsommer, goldgelbes Getreide stand, unterbrochen von dem saftige Grün der Kartoffel- und dem Hellgrün der Rübenäcker. Zu den Kartoffeln wollten sie, weit hinauf, sie gingen im Rain zwischen den Getreidefeldern, bis sie den ersten Acker erreicht hatten.
„Hier, halt den Sack auf, ich werfe die Knollen hinein“, wies Eduard seine Schwester an und fing an, die Pflanzen mit den Händen auszugraben, an deren Wurzeln frische Kartoffeln hingen, zart, hellgelb, nur von dunkler Erde bedeckt. Vier Pflanzen hatte er ausgegraben, er war vollkommen in die Arbeit vertieft, da hörte er trampelnde Schritte über den Rain kommen.
„Was macht ihr denn da?“ hörte er eine schwere drohende Stimme hinter sich und richtete sich auf, als schon der erste Schlag eines schweren Knüppels seine Schulter traf. Er schrie laut auf vor Schmerz.
„Ich werde euch zeigen, mir meine Kartoffeln klauen, was meint ihr wohl, wenn jeder aus der Stadt kommt und hier gräbt, was denn wohl für uns bleibt?“, schrie ein kräftiger Mann hinter ihm und jetzt prasselten die Schläge wie Hagel auf seinen Kopf, auf die Schulter und auf den Rücken.
Eduard hatte sich in der ersten Panik nach seiner Schwester umgesehen und sie nicht entdecken können.
„Gott sei Dank, sie ist weggelaufen“, dachte er bei sich und sah nun auf den Bauern, der groß schwer und bedrohlich vor ihm stand, den Knüppel schon wieder zum Schlag erhoben und hinter ihm den Sohn, jünger, aber nicht weniger drohend. Da drehte Eduard Eschenburg sich um und lief, den Sack im Stich lassend, davon, so schnell er konnte. Er hörte hinter sich die trampelnden Stiefel der Verfolger, die aber immer weiter entfernt klangen. Sie konnten mit dem jungen Eduard, der noch aus dem Krieg trainiert war, nicht mithalten und blieben irgendwann stehen, ihm Drohungen hinterherschreiend, deren Inhalt Eduard aber nicht verstand. Er war nur froh, als er den Waldrand erreichte und jetzt anfangen konnte, nach Kathrin Ausschau zu halten. Da vorne sah er einen roten Zipfel hinter einem Baum, das war das Kleid seiner Schwester, die sich dort versteckt hatte.
„Kathrin, Gott sei Dank, da bist du ja, bist du schnell genug weggelaufen?“, er war aufgeregt und glücklich.
„Ja, natürlich, Eduard, das hast du mir ja gesagt, aber was haben sie mit dir gemacht? Du hast ja lauter blaue Flecken auf dem Arm.“
„Nicht nur auf dem Arm, ich glaube, sie haben mir den Rücken grün und blau geprügelt, aber mehr ist auch nicht passiert, nur der schöne Sack mit den Kartoffeln, der ist wohl weg.“
„Macht nichts, einen Sack beschaffen wir schon wieder, und morgen möchte ich wieder mit dir losgehen, wir gehen dann auf ein anderes Feld, nicht?“
„Nein, gerade nicht, jetzt gehen wir zu dem gleichen Feld zurück, aber heute geht das nicht mehr, wir haben keine Tasche oder so etwas.“
Langsam und froh, halbwegs glimpflich davongekommen zu sein, gingen sie nach Hause.
2.
Am nächsten Tag und an vielen Tagen danach hatten sie mehr Glück. Eduard gelang, es, einen Vorrat von den Äckern mitzubringen, der sie durch den nächsten Winter brachte, er erlegte mit selbstgebastelten Fallen einige Hasen und Fasanen, die Anni briet und kochte und in den Einmachgläsern konservierte, die er von seinem ersten Einbruch mitgebracht hatte. Und Eduard pflanzte, er setzte Kartoffeln, Rüben, die er von den Feldern hatte, in den Garten der Villa, von dem er ein Stück umgegraben hatte, er fand in der Küche seiner Mutter alte Samen aus der Zeit vor dem Krieg, Salat, Kohlrabi und Tomaten, die er säte.
„Sie sind zwar alt, aber vielleicht wachsen sie noch“, hatte Anni gesagt, die ihn auch beriet, wie er pflanzen und säen sollte.
Im Sommer des nächsten Jahres stand Eduard vor dem kleinen Kartoffelacker. Dicke Blätterbüschel standen da in Reihen und Eduard zog eine Pflanze aus. Viele kleine Knollen waren da gewachsen, genug für eine ganze Mahlzeit aus zwei Stauden.
Eduard stand da, eine der Früchte in der Hand.
„Glück“, sinnierte er, „Glück ist relativ. Wer hätte das gedacht, dass ich einmal so glücklich sein werde nur, weil ich Kartoffeln gepflanzt und sie jetzt geerntet habe. Mein Vater war glücklich, wenn seine Firma blühte und wuchs, meine Mutter erzählte mir von dem Glück, das sie im Leben mit meinem Vater erlebte, ich hatte Glück, dass ich aus dem Krieg lebendig und unversehrt wiedergekommen bin und jetzt bin ich glücklich über einen Topf voll meinen eigenen Kartoffeln.“
Aber er wusste, das genügte nicht. Er konnte ebenso wenig wie Kathrin sein Leben damit verbringen, Saatfrüchte zu stehlen und einzupflanzen, mit nichts weiter beschäftigt als Hunger und Durst zu stillen. Er begann, sich über seine Zukunft Gedanken zu machen.
Eduard Eschenburg war jetzt vierundzwanzig Jahre alt, Major der Reserve in einer Armee, die es faktisch nicht mehr gab. Rund um ihn herum tobten Kämpfe zwischen den alten und den neuen Kräften, die einen wollten Revolution, die anderen den Kaiser wieder einsetzen und die Dritten wollten, ebenso wie die Kaiserlichen, die Größe des Deutschen Reiches wieder herstellen. Eduard wusste nicht, ob er mehr zu der einen oder der anderen Seite drängte. Er wusste nur, er wollte lernen, wenn möglich studieren, um dann einen Beruf zu ergreifen, der ihm ein ordentliches Leben ermöglichte, wenn dies im besiegten Deutschland jemals wieder möglich sein sollte.
Darauf deuteten aber die Zeichen hin. Seine Landsleute hatten begonnen, das Land wieder aufzubauen, überall in der Stadt wurde gezimmert, gemauert und gehämmert, immer begleitet von den schrillen Tönen der nationalen und sozialistischen Politiker, aber unbeirrbar.
Eduard ging zur Universität von Königsfeld, die, so hatte er gehört, ihren Betrieb wieder aufgenommen hatte.
„Ich möchte gerne Jura studieren“, eröffnete er der Sekretärin in der juristischen Fakultät, zu der er sich durchgefragt hatte.
„Gut, ich brauche Ihre Geburtsurkunde, Ihr Abiturzeugnis, und, wenn Sie im Krieg waren, Ihre Entlassungspapiere. Major sind Sie?“ fragte sie mit einem achtungsvollen Blick, als er seinen Dienstgrad auf ihre Frage nannte, „sind Sie nicht ein bisschen jung dafür?“
„Klar, aber im Krieg gab es das schon“, antwortete er, „und was kostet das, wenn ich studieren will?“
Читать дальше