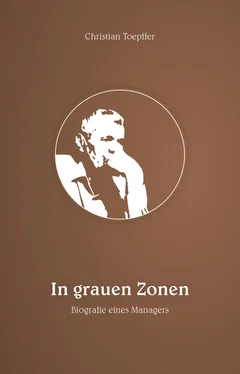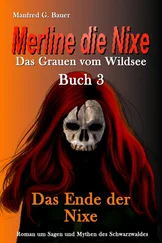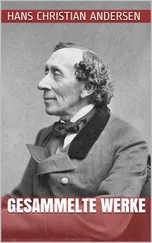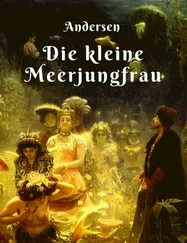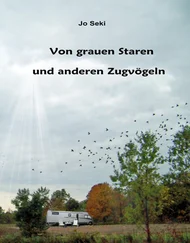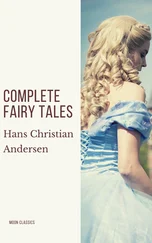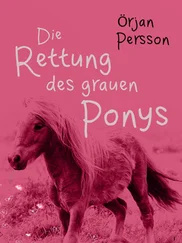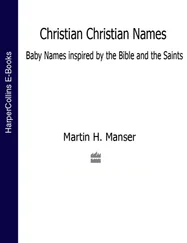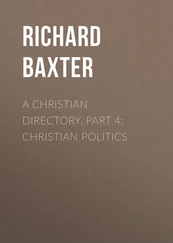Da brachte der nächste Besuch des englischen Offiziers eine Wende. Die Jüngeren hatten wenigstens ihr Schulenglisch, Bertha war inzwischen weit darüber hinaus, aber die Älteren hatten aus ihrer Jugend im Kaiserreich bestenfalls noch dunkle Erinnerungen an Französisch. Nur Mutter Agnes war als Tochter eines Diplomaten mehrsprachig aufgewachsen. Mit ihrer Hilfe konnte man sich entspannt unterhalten und begann, sich gegenseitig anzunehmen. Der Offizier lobte mehrfach Agnes‘ Englisch und vermittelte ihr schließlich, möglicherweise auf sanfte Empfehlung Berthas hin, eine Stelle als Übersetzerin bei der englischen Armee.
Statt die Gastfreundschaft durch Arbeit im Haus, Garten und auf dem Hof zu vergelten, konnte Agnes nun Miete zahlen. Sie zogen aus dem Archiv in frei gewordene Räume im Seitenflügel, Georg rechnete sich das als Verdienst seiner guten Beziehungen zu Bertha und seiner Verschwiegenheit an, aber die Mutter pries eher die gute Erziehung, die sie in ihrem Elternhaus genossen hatte.
Der Großvater war Diplomat gewesen, Agnes und ihre Schwester Anna hatten ihre Kindheit im Ausland unter der Obhut einer Schweizer Hauslehrerin verbracht. Besonders gern erzählte Agnes von Norwegen, das der Kaiser jeden Sommer auf seiner Yacht besuchte. Einmal war nicht nur der Großvater, sondern auch seine ganze Familie mit eingeladen worden. Die Mädchen durften mit am Tisch sitzen, noch zwei Kriege später veranlasste das Agnes zu erzieherischen Bemerkungen wie „Ich habe mit Kaisern und Königen gegessen“, wenn sie an den Tischmanieren Georgs etwas auszusetzen hatte. Wurde damals Republikaner. Jedenfalls mussten die Mädchen beim Kaiser einen guten Eindruck hinterlassen haben, denn er schenkte ihnen zum Abschied kleine goldene Broschen in Form eines stilisierten „W“ , Agnes trug ihre immer noch gern, obwohl der Großvater während des Krieges die Gunst des Kaisers verloren hatte.
Der Großvater und der Finanzier Goldberg hatten mit einer Denkschrift in den Streit um den Einsatz von U-Booten gegen Handelsschiffe eingegriffen und dringend davor gewarnt, den Amerikanern einen Vorwand zum Eintritt in den Krieg zu liefern. Später machte er sich bei seinen Standesgenossen unbeliebt, als er vor Annexionen im Osten warnte, die doch nur noch mehr der sonst so unerwünschten Polen und Juden ins Reich bringen würde. Leider gerieten der Kaiser, die Regierung und die Öffentlichkeit immer mehr unter den Einfluss intriganter Scharfmacher. Da war die Rede von Spielernaturen, was Georg etwas verwirrte, weil gelegentlich auch lobend erwähnt wurde, dass der Großvater einmal sehr viel Geld beim Glücksspiel gewonnen hätte. Aber der Großvater hätte eben die Charakterstärke besessen, aufzuhören, bevor die Gewinnserie abbrach. Die kaiserliche Ungnade kränkte den Großvater umso mehr, als, wie von ihm befürchtet, die Militärs ohne Erfolg blieben und der Krieg verloren ging. Da konnte man vernünftigerweise nur noch geduldig versuchen, zu retten, was noch zu retten war. Zwar würden die Sieger schwere Friedensbedingungen auferlegen, aber Deutschland müsste bei weiterem, äußersten Widerstand mit einer vernichtenden Zerstörung rechnen.
Der Großvater erhielt von der Republik die Aufgabe, die deutschen Interessen bei der Grenzziehung nach der Abstimmung in Oberschlesien zu vertreten. Das wollten sich die Polen mit Gewalt aneignen, obwohl sie die Abstimmung verloren hatten. Die Deutschen wehrten sich, und schließlich bestimmten die Siegermächte, dass das Gebiet geteilt werden sollte. In der Kommission, die die Grenze ziehen sollte, bevorzugten die Franzosen die Polen schamlos. Wenn Orte überwiegend deutsch waren, wurden sie aus wirtschaftlichen Gründen Polen zugesprochen. Aber zusammengehörige Industrien wurden zerschlagen, wenn es nur in irgendeinem Flecken eine polnische Mehrheit gab. Die übrigen in der Kommission vertretenen Länder sahen keinen Anlass, sich für den Kriegsverlierer einzusetzen, und hinter dem Großvater stand keine Macht. So niederdrückend das war, schlimmer traf ihn die Kritik aus jenen Kreisen, die er immer als die seinen empfunden hatte: Er sei einfach zu schlapp, ein Flaumacher vor, im und nach dem Krieg.
Obwohl sonst wach für politische und gesellschaftliche Entwicklungen, blieb der Großvater, soweit es seine Familie betraf, fest bei den überkommenen Vorstellungen. Die Bestimmung der Frau war Ehe und Mutterschaft. Zwar hatten noch vor dem Krieg unverheiratete Tanten bequem von ihrem Anteil am Familienvermögen leben können, aber viel zu vererben gab es nach der Inflation nicht mehr. Trotzdem erschien es ihm undenkbar, dass seine Töchter ein selbständiges Leben führen könnten. Falls sie keinen Mann finden würden, bliebe nur eine eher dienende Rolle, etwa in der Pflege, und das am besten im Rahmen der Großfamilie.
Die Töchter wurden also nach dem Lyzeum auf eine Maidenschule geschickt, ein Internat, in dem Töchter auf ihre Aufgaben als Gutsherrinnen in Hauswirtschaft, in der Anleitung und Beaufsichtigung des Personals, aber auch in der Gestaltung von Festen mit Musik, Theater, Literatur und Tanz vorbereitet wurden. Daneben war die Maidenschule natürlich auch ein Institut zur Anbahnung von Ehen mit den Brüdern der dort gewonnenen Freundinnen. Aber die Familie wurde nicht mehr für ganz zuverlässig gehalten, und Männer waren nach den Verlusten des Krieges ohnehin rar, es war nicht leicht, die Töchter standesgemäß zu verheiraten. Dabei waren beide hübsch, die ältere, selbstbewusste Anna heiratete schließlich den Ingenieur Friedrich Burgdorff aus Waldberg, zwar bürgerlich, aber aus einer lang ansässigen Familie, der das Eisenwerk Karlshütte gehörte. Burgdorff hatte noch in der kaiserlichen Marine gedient, auf der ein Schatten lag, sie hatte im Krieg gekniffen und dann auch noch gemeutert.
Die jüngere Agnes war eher schüchtern, aber zäh genug, eine Ausbildung zur Hauswirtschaftslehrerin gegen den anfänglichen Willen des Vaters durchzusetzen. Wenn schon alte Jungfer, dann besser unabhängig bleiben von der Familie, insbesondere der Schwester. Sie versuchte aber, so gut es ihre Arbeit erlaubte, weiter am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Im Kreis der entfernten Verwandten gab es die Familie v. Mallwitz mit einem Sohn Wilhelm, der das Gut Weißstein für seinen Vater verwaltete. Wilhelm v. Mallwitz hinkte leicht, er war als junger Freiwilliger bei den Kämpfen in Oberschlesien verwundet worden. Nach Jahren einer zunächst oberflächlichen Bekanntschaft entschlossen sich die beiden, zu heiraten. Weißstein hatte eine tüchtige Herrin nötig. Ein frommer Vorfahre Wilhelms hatte dem Krüppelheim Bethanien beträchtliche Flächen gestiftet, sodass das Gut selbst in guten Zeiten kaum Gewinn abwarf. Das Stammschloss auf einem Hügel war so heruntergekommen, dass Agnes beschloss, es den Familien der Arbeiter zu überlassen, die Mallwitzens selber zogen in das Haus der ehemaligen Verwalter am Wirtschaftshof. Agnes wirtschaftete geschickt und erschloss neue Einnahmequellen, indem sie Pensionsgäste aufnahm. Dass sie dafür Geld nahm, widersprach traditionellen Vorstellungen von Gastfreundlichkeit und war Wilhelm besonders dann peinlich, wenn es sich um Bekannte oder gar Verwandte handelte. Aber dem Argument, ohne solche Einnahmen könnten sie Weißstein überhaupt nicht halten, und das würde weder den Gästen noch ihnen selbst nützen, denn was sollten sie ohne das Gut anfangen, konnte er nichts entgegen setzen.
Vom Dritten Reich erhoffte man sich eine Versöhnung zwischen den Klassen, die auch Deutschlands Stellung nach außen stärken würde, selbst der Großvater trank noch kurz vor seinem Tod Champagner auf das Wohl der neuen Regierung. Die Landwirtschaft wurde gefördert, um Deutschland autark zu machen, und das Eisenwerk der Burgdorffs erhielt Rüstungsaufträge. Mit den guten Geschäften nahm aber auch das innere Unbehagen zu. Während man sich zunächst noch damit beruhigte, nach einer Zeit politischer Wirren und wirtschaftlichen Niedergangs seien vereinzelte Gewaltakte unvermeidlich und somit fast entschuldbar, merkte man bald, dass man mit ungeheurem Druck in eine Volksgemeinschaft gepresst wurde, die nur sich selber als Wert anerkennen wollte. Besonders bedrückte die wachsende Einsicht, dass es sich dabei nicht etwa nur um eine Weltanschauung handelte, die durch Übertreibungen auf radikale Abwege geraten war, sondern um eine Politik, deren durch und durch verbrecherischer Ansatz sich zunehmend offenbarte.
Читать дальше