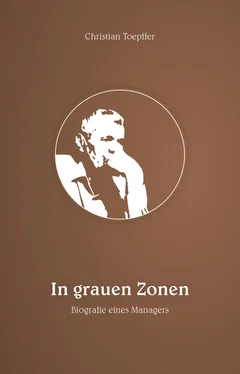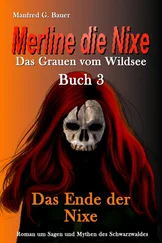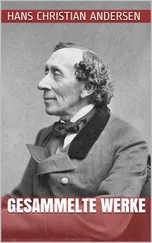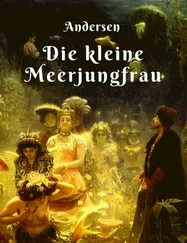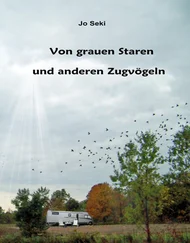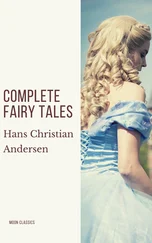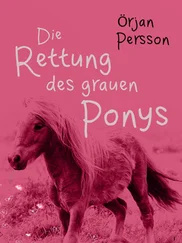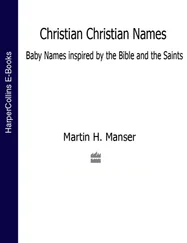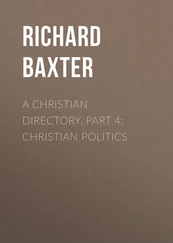Der Krieg war nun einige Jahre vorbei, die Notzeit ging zu Ende, jeder musste sich zumuten lassen, selber die Verantwortung für sein Schicksal zu übernehmen. Bei Tisch gab es sarkastische Anspielungen. Luise zu Eberhard: „Schönbergs haben den linken Flügel des Schlosses abreißen müssen, der war so baufällig, dass man es auch den Flüchtlingen nicht mehr zumuten konnte.“ Als erste gingen die Goldbergs, in einen Ort namens Bonn, wo Adenauer regierte. Aber nicht zu dem, sondern zu fragwürdigen Menschen, den Sozis. „Nach allem, was wir für ihn getan haben“, meinte Tante Luise. Der Onkel wiegelte ab: „Er ist gegen die Kommunisten und war das schon vor dem Dritten Reich, und überhaupt war schon sein Vater zwar Jude, aber doch ein hochanständiger Mensch.“ Tante Emmi unterstützte ihren Sohn: „Dein Vater, Agnes, hat die Goldbergs doch auch geschätzt“. „Ja, weil der alte Goldberg durchaus national gesinnt war. Dem Sohn hat Vater noch vor seinem Tod empfohlen, sich an uns zu wenden, wenn er in Schwierigkeiten käme, aber natürlich hat es damals Vater, wie wir alle, nie für möglich halten können, wie schlimm sich die Nazis aufführen würden. Jedenfalls haben wir ihn mit seiner Frau in Weißstein aufgenommen, als es in Berlin zu gefährlich wurde. Die Gestapo hatte schon einige seiner Bekannten verhaftet.“ „Tätige christliche Nächstenliebe“, lobte Tante Emmi. Tante Luise passte das alles nicht: „Mit seinem Webfehler hätte er sich nicht auch noch mit zweifelhaften Kreisen einlassen sollen. Wahrscheinlich hatte der doch nur Angst vor den Bomben. Von mir aus hätte er in Schlesien bleiben und sich von seinen roten Gesinnungsgenossen befreien lassen können.“ Onkel Eberhard beendete das Gespräch mit der Bemerkung, Goldberg sei ihm nach Kriegsende bei Verhandlungen mit den englischen Besatzungsbehörden durchaus behilflich gewesen, es sei nicht seine Art, so etwas zu vergessen. Aber er sei doch froh, dass man solcher Hilfe kaum noch bedürfe, man habe es jetzt wieder mehr mit deutschen Behörden zu tun, der Respekt kehre zurück.
Da sich diese Gespräche ständig bis auf unwesentliche Abweichungen wiederholten, merkte der kleine Georg, dass hier niemand mehr versuchte, andere zu überzeugen, vielmehr wurden unabänderliche Weltanschauungen verkündet. Die verstand der Junge kaum, aber er merkte sehr wohl, wie hartnäckig sich jeder darstellte: Mutter Agnes zurückhaltend, weil abhängig, Tante Luise gekränkt und aggressiv, Onkel Eberhard pragmatisch und Tante Emmi lieb, fromm und naiv.
Dann gab es die Söhne und Töchter von Eberhard und Luise, sie waren deutlich älter als Georg und wurden Vettern und Kusinen genannt, waren aber eigentlich zweiten Grades. Der älteste war 1944 in Frankreich gefallen, durch Verrat, wie Tante Luise fest behauptete, Karl kämpfte mit dem Abitur und auch Peter ging schon auf das Gymnasium. Zwischen den ersten beiden Söhnen kamen zwei Töchter, die ältere, Gerda, war noch BDM-Führerin gewesen. Georg wich ihr aus, sie hatte ihn einmal bloßgestellt. Er hatte für sich ein angenehmes Gefühl entdeckt, wenn er im Bett seinen Penis berührte. Dabei hatte ihn Gerda erwischt und bei Tante Luise verpetzt. „Du musst unbedingt darauf achten, Agnes, dass Georg im Bett die Hände immer auf der Decke hat.“ Die Mutter schämte sich, und dafür fühlte sich Georg schuldig.
Die jüngere Tochter, Bertha, hatte er sehr lieb. Einmal an einem bitterkalten Abend, als sie allein waren, durfte er zu ihr ins Bett schlüpfen. Da war es nicht nur warm, sondern sie roch auch sehr gut und fühlte sich zugleich weich und fest an, er schlief schnell ein.
Die Lücke in dieser Großfamilie war so offensichtlich, dass es die Mutter überhaupt nicht nötig gehabt hätte, ihren Sohn ständig an das Fehlen des Vaters zu erinnern und mehr noch, von ihm zu erwarten, die Rolle des Beschützers zu übernehmen. Nach heftigen Auseinandersetzungen mit Standesgenossen und Verwandten hatte sich Wilhelm v. Mallwitz schließlich nach Ausbruch der sowjetischen Offensive im Januar 1945 doch entschlossen, dem Rat seines Schwagers, des Fabrikanten Burgdorff, zu folgen und sich mit seinem Bulldog dessen Trek nach Westen anzuschließen. Die Mallwitzens wurden in Westfalen auf dem Gut des Vetters Eberhard aufgenommen, Luise allerdings machte spitze Bemerkungen, ob es sich denn für einen preußischen Edelmann schicke, im Angesicht des Feindes Haus und Hof zu verlassen. Dann posaunte die Propaganda heraus, dass es gelungen sei, den Ansturm der asiatischen Horden auf das schlesische Bergland zu brechen. Unter solchem Druck und bei eigenen Zweifeln entschied sich Mallwitz für einen Kompromiss: Seine schwangere Frau ließ er in Westfalen, er selber kehrte nach Schlesien zurück, und zwar – trotz seiner Behinderung – auf einem Fahrrad, alle anderen Verkehrsmittel waren inzwischen zu unsicher. Ende März kam er wieder in Weißstein an, das in der Tat noch einige Kilometer hinter der Front lag. Der Ortsgruppenleiter wurde unangenehm, redete von Fahnenflucht und Defaitismus, ließ sich aber mit dem Argument beeindrucken; ohne v. Mallwitz keine Aussaat, ohne Aussaat keine Ernte und ohne Ernte kein Endsieg. Mallwitz, der Vorarbeiter Jacques, ein belgischer Kriegsgefangener, die russischen Kriegsgefangenen und die Frauen der längst eingezogenen Landarbeiter machten sich an die Arbeit.
Anfang Mai verschwand Jacques mit einem Pferd. Ein paar Nächte später sahen sie Feuerwerk über der Front, die Russen feierten ihren Sieg. Der Ortsgruppenleiter setzte sich ab, ein wilde Menge, deren Anführer sich als Kommunisten ausgaben, fing an, Vorratslager zu plündern und dann auch verlassene Häuser. Die Bank wurde besetzt, ein Tresor auf den Vorplatz gestürzt, aufgeschweißt und geleert. Aber der Pöbel traute sich nicht nach Weißstein, Wilhelm v.Mallwitz saß noch auf seinem Besitz. Er vergrub einige Wertgegenstände und ließ allen Alkohol bis auf einen Anstandsrest ausgießen. Diese kluge Maßnahme bewährte sich nach Ankunft der Russen am nächsten Tag, sie bekamen etwas zu trinken, aber in Maßen. Auf dem Gut kam es zwar zu Diebereien, aber nicht zu Gewalttaten. Hilfreich war sicher auch, dass die Gefangenen nichts gegen Mallwitz vorbrachten. Im Ort erschossen die Russen einige wirkliche oder angebliche Kommunisten, um deutlich zu machen: Plündern ist ein Privileg von Siegern. Nach einigen Tagen verschlechterte sich die Lage, und zwar zuerst für die gerade befreiten russischen Gefangenen, sie wurden verhaftet, verprügelt und abgeführt von einem Trupp, den Mallwitz als so etwas wie eine sowjetische Gestapo einordnete. Dann zogen die Russen ab, und es kamen Polen, die alles in Beschlag nahmen, was sie nur wollten. Es wurden Plakate angeschlagen, die sie im Namen der Siegermächte als neue Herren einsetzten. Den Deutschen wurde die Repatriierung nach Westen befohlen. Mallwitz hatte verloren und glaubte inzwischen auch, sich damit abfinden zu müssen. Am Abend vor der Abschiebung tauchte eine Gruppe von Polen auf, Männer, Frauen, Kinder und ein Anführer. Der erklärte, sie würden nun das Gut übernehmen und erst einmal die Befreiung feiern. Man schlachtete ein noch verbliebenes Schwein, warf Möbel aus dem Haus und zündete damit ein großes Feuer an. Ein Scheunentor wurde ausgehängt und auf dem Hof als Tafel aufgebockt. Da griff das Feuer auf die Scheune über, die inzwischen Betrunkenen grölten vor Freude. Um wenigstens den Anführer zur Besinnung zu bringen und die Landmaschinen aus der Scheune zu retten, rüttelte Mallwitz an dessen Schultern. Der empfand das als Angriff und schlug ihn zu Boden. Dann legten sie das Scheunentor auf den regungslosen Körper und tanzten darauf herum. Wilhelm v. Mallwitz starb noch in dieser Nacht.
Das war der gemeinsame und schließlich von der Familie geglaubte Kern der Erzählungen und Briefe der überlebenden Ausgewiesenen. Das Pferd lieferte übrigens Jacques in Westfalen für Agnes ab und machte sich dann zu Fuß auf den Weg heimwärts nach Belgien.
Читать дальше