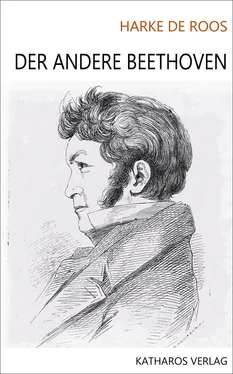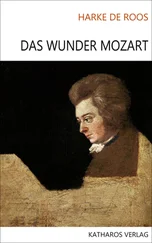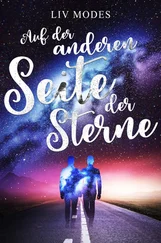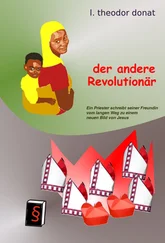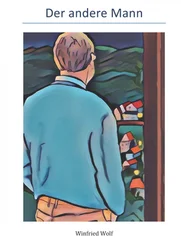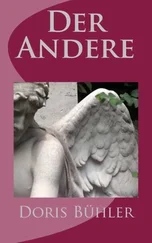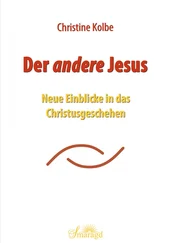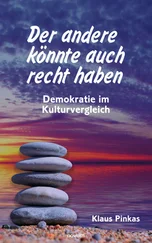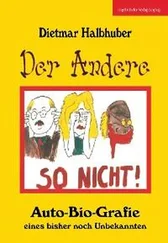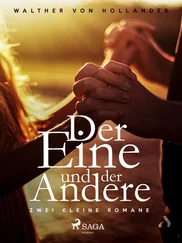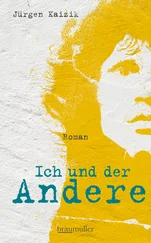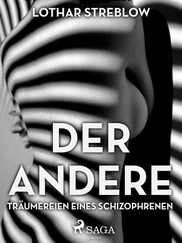(Wilhelm Rust an seine Schwester Jette, am 9. Juli 1808)
Die vierte Textstelle spricht das Problem des Zusammenspiels an, welches unter die Verantwortung des Konzertmeisters (Direktors) fiel:
Dies ist nöthig, in einem Jahrhundert, wo es keine Konserwatorien mehr gibt, und daher kein Direktor mehr wie alles andere auch nicht gebildet wird, sondern dem Zufall überlassen wird, dafür haben wir geld für einen OhneHodenMann wobey die Kunst nichts gewinnt, aber der Gaumen unserer ohnedem appetitlosen reizlosen sogenannten Großen gekizelt wird
(Beethoven an Gottfried Christoph Härtel, am 21. August 1810)
Aus keiner dieser zitierten Passagen tritt uns ein zufriedener Musiker entgegen. Ganz offensichtlich war Beethoven oft unglücklich mit der Interpretation seiner Werke. Trotzdem greift er niemals wie ein Schulmeister ein. Wenn seinen Vorschriften nicht nachgekommen wird, neigt er eher dazu, die Anweisungen gänzlich zu tilgen als dass er sie mit Nachdruck durchsetzt.
Aber wir wollen nicht nur wissen, was Beethoven an der Wiedergabe seiner Kompositionen schlecht findet, wir wollen auch wissen, was er gut findet. Es ist ja nicht so, dass er sich darüber nie geäußert hat. Nach seiner Lehre sollte jeder Interpret über drei Eigenschaften verfügen. Er muss über Kenntnis verfügen, er muss Gefühl haben und – wohl das Allerwichtigste – er muss „achtsam“ sein. Merkwürdigerweise nimmt gerade die Achtsamkeit auch in der buddhistischen Lehre eine zentrale Position ein. Achtsamkeit! Bedeutet es doch, dass der Mensch seine Sinnesorgane öffnet und die Verbindung zwischen Geist und Materie scharf stellt. Man beachte die folgende Textpassage von Ferdinand Ries:
Wenn Beethoven mir Lection gab, war er, ich möchte sagen, gegen seine Natur, auffallend geduldig. Ich wusste dieses, sowie sein nur selten unterbrochenes freundschaftliches Benehmen gegen mich größthentheils seiner Anhänglichkeit und Liebe für meinen Vater zuzuschreiben. So ließ er sich manchmal eine Sache zehnmal, ja noch öfter, wiederholen. In den Variationen in F-Dur, der Fürstin Odescalchi gewidmet (Opus 34), habe ich die letzten Adagio-Variationen siebenzehnmal fast ganz wiederholen müssen; er war mit dem Ausdrucke in der kleinen Cadenze immer noch nicht zufrieden, obschon ich glaubte, sie eben so gut zu spielen, wie er. Ich erhielt an diesem Tage beinahe zwei volle Stunden Unterricht. Wenn ich in einer Passage etwas verfehlte, oder Noten und Sprünge, die er öfter recht herausgehoben haben wollte, falsch anschlug, sagte er selten etwas; allein, wenn ich am Ausdrucke, an Crescendos u.s.w. oder am Charakter des Stückes etwas mangeln ließ, wurde er aufgebracht, weil, wie er sagte, das Erstere Zufall, das Andere Mangel an Kenntnis, an Gefühl, oder an Achtsamkeit sei.
Mälzels Metronom würde Beethoven die Gelegenheit verschaffen, die Tempi seiner Werke mit einer Eindeutigkeit vorzuschreiben, wie sie sonst nur beim Militär üblich ist. Aber wollte er das auch? Hatte er nicht schon längst mitbekommen, dass Vorschriften, je eindeutiger sie sind, umso weniger beachtet werden?
Aber sogar wenn es möglich gewesen wäre, die Tempi von allen Sätzen des Gesamt-Oeuvres mit Zahlen festzulegen und bei allen Interpretationen durchzusetzen, was wäre denn gewonnen? Beethoven kannte Platons Phaidros. Das Buch stand in seinem Bücherregal und enthält eigenhändige Eintragungen des Komponisten. Die Überschrift über dem 60. Kapitel lautet:
Schwäche des durch die Schrift überlieferten toten Wissens.
Bei den folgenden Sätzen könnte man denken, Platon spricht von Mälzels Metronom und nicht vom Alphabet:
Denn diese Erfindung wird den Seelen der Lernenden vielmehr Vergessenheit einflößen aus Vernachlässigung der Erinnerung, weil sie im Vertrauen auf die Schrift sich nur vermittels fremder Zeichen, nicht aber innerlich sich selbst und unmittelbar erinnern werden. Nicht also für die Erinnerung, sondern nur für das Erinnern hast du ein Mittel erfunden, und von der Weisheit bringst du deinen Lehrlingen nur den Schein bei, nicht die Sache selbst.
Dabei gilt zu bedenken, dass Beethoven ohnehin der Überzeugung war, dass die Tempi seiner Werke, wie auch die Tempi von Haydn und Mozart, aus den Noten selbst ablesbar sind. Voraussetzung dazu sind Grundkenntnisse der klassischen Temporelationen, wie sie im 18. Jahrhundert in den Konservatorien gelehrt wurden, aber eben nicht mehr im ersten Jahrzehnt des neuen 19. Jahrhunderts.
Das Hauptproblem der damaligen neuen Zeit war, dass die sogenannten langsamen Sätze der klassischen Werke bereits zu langsam, die schnellen Sätze zu schnell gespielt wurden. Das klassische Maß wurde nicht mehr eingehalten und zeigte überall Risse. Dieses Auseinanderdriften der Adagio- und Andantesätze auf der einen Seite und der Allegro- und Prestosätze auf der anderen ist ein Phänomen, das durch Rezensionen in der Allgemeinen Musikalischen Zeitung Leipzig gut belegt ist.
So heißt es in einem Beitrag der AMZ vom Januar 1807:
Die Sucht, musikal. Werke immer geschwinder zu spielen, nimmt auch hier immer mehr über Hand, so dass man sich oft einen Spaß und auch wohl ein Verdienst daraus macht, z. B. die Sinfonie, herunter „gestäubt“ zu haben. So wurde vor einiger Zeit ein Mozartsches Klavierkonzert gerade noch einmal so geschwind gespielt, als ich es selbst von Mozart vortragen hörte.
Um auch von übertriebenem Zögern wenigstens ein Beyspiel anzuführen, nenne ich das von Lamarc, der während seines Aufenthaltes in Wien das zweyte Stück des zweyten der konzertirenden Mozartschen Quartetten fast noch einmal so langsam nahm, als ich es unter Mozarts Leitung habe spielen hören.
Ein anderes Beispiel steht in der AMZ von Oktober 1811:
Paris 1811: In der Symphonie und Ouvertüre herrschen hier vor allen Mozart und Haydn. Ihre sämtlichen Werke dieser Gattungen werden hier mit einem Feuer, einer Präzision, einer Sorgsamkeit ausgeführt, dass auch dem strengsten Kunstrichter nur selten etwas zu wünschen übrig bleibt. Dies noch zu Wünschende möchte wohl zunächst seyn, dass man die Allegrosätze dieser Werke nicht selten zu rasch nimmt. Ich erinnere mich noch ganz genau, Mozart und Haydn in Wien Symphonien ihrer Composition aufführen gehört zu haben: ihre ersten Allegros nahmen sie nie so geschwind, als man sie hier, und auch wohl jetzt an mehreren deutschen Orchestern, zu hören bekommet; die Menuetten ließen beyde rasch hingehen, die Finalen liebte Haydn schneller zu nehmen als Mozart – was freylich aus dem Charakter und der Schreibart dieser ihrer Sätze hervorgeht, aber jetzt von andern Direktoren zuweilen vergessen wird.
Auf Beethoven hatte das klaffende Loch zwischen den Tempi der sogenannten langsamen und schnellen Sätze eine fatale Wirkung, als würde man das Mittelregister seines Klaviers zertrümmern. Im Originalton lautet die Beschreibung dieses Lasters:
Nicht zu gedenken, dass da, wo höherer Ernst, Würde und Kraft der Charakter des Tonstückes sind, dieser durch leichtfertiges schnelles Herabspielen entwürdiget, oder ganz vernichtet, im umgekehrten Falle aber, wo Feuer, Energie im Tonstücke liegt, der ganze Vortrag träge, schleppend, folglich auch hier der Geist des Tonsatzes verfehlt, und demnach die vom Tonsetzer beabsichtigte Wirkung auf eine oder auf die andere Art vereitelt wird.
(Nikolaus von Zmeskall, Beethovens Sprechrohr, am 28. August 1817 in der AMZ Wien)
Natürlich wissen wir nicht genau, wann und was Beethoven in der Zeit zwischen 1814 und 1817 gedacht hat, aber Ahnen ist erlaubt. Deutlich spürbar ist der Unwille des Meisters, einem unaufhaltsamen Trend in der Musikpraxis durch eindeutige Vorschriften entgegenwirken zu wollen, zumal er damit letztendlich sich nur selbst lächerlich machen würde. Nur zu gut wusste er, dass die Instrumentalisten sich immer weniger um seine Metronomvorschriften scheren und nach seinem Tod erst recht jeder Willkür freien Lauf lassen würden.
Читать дальше