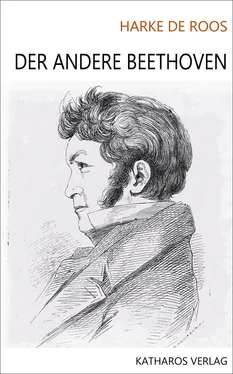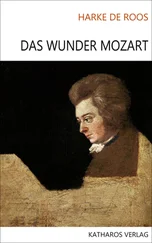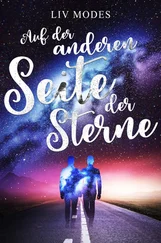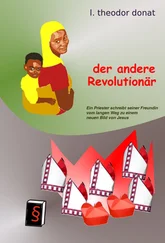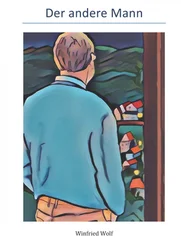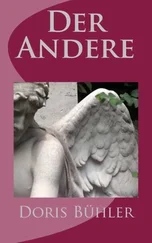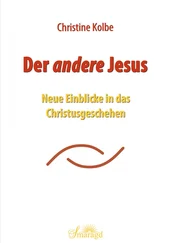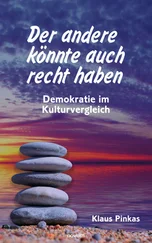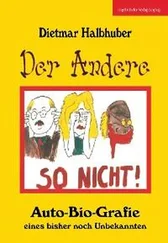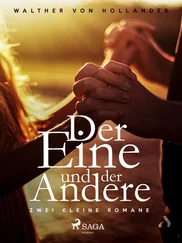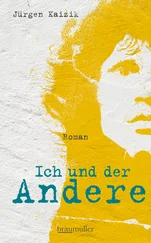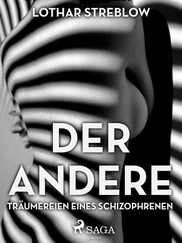Bei allen Komponisten wird die rasche Abwechslung zwischen den beiden Taktarten häufig verwendet, aber Beethoven geht manchmal noch einen Schritt weiter. Bei ihm gibt es Dreivierteltakte, die in Wirklichkeit getarnte Sechsachteltakte sind, wie zum Beispiel im Scherzo des Harfenquartetts op. 74. An anderen Stellen wechseln die Taktarten sich so schnell ab, dass es nicht auszumachen ist, welche von beiden vorherrscht. Beide Taktarten können sogar gleichzeitig in den verschiedenen Stimmen einer Komposition auftreten. Sechsachteltakt und Dreivierteltakt sind dann tatsächlich wie zwei Seiten einer Medaille.
Die Lösung des Rätsels rückt heran:
Die Metronomzahl ist eine feste Messlatte. Wenn das Metronom auf 100 eingestellt ist, zeigt der hörbare Tick des schlagenden Pendels ein Tempo, an dem nicht zu rütteln ist. Auf welche Notenwerte diese Messlatte angelegt wird, ist dagegen variabel. Es ist ein Unterschied, ob die Zeitspanne von einer Hundertstel-Minute zwei oder drei Achtelnoten definieren soll. Natürlich wäre die punktierte Viertelnote mit ihrem Zeitmass von drei Achtelnoten der übliche Bezugswert im Sechsachteltakt. Auch Beethoven wusste dies. Aber warum sollte er sich nach dem richten, was üblich heißt? Für ihn, der tagtäglich mit den unterschiedlichsten Taktarten jonglierte, war das Nebenzeitmass ebenso präsent wie das Hauptzeitmaß. Zudem war das Metronom so neu, dass noch bestimmt werden musste, was üblich ist und was nicht.
Die Auflösung liegt im richtigen Verständnis des Ausdrucks von den ersten Täkten. Offenbar meint Beethoven mit „Täkten“ nicht „Takte“, wie man auf den ersten Blick meinen würde, sondern „taktierende Achtelnoten“. „Von den ersten Täkten“ bedeutet in diesem Rätsel demnach „für die ersten zwei Achtelnoten“ – statt für die ersten drei – also für die Viertelnote statt für die punktierte Viertelnote. Jetzt lesen wir Beethovens Gebrauchsanleitung für das Tempo des Lieds ein wenig anders:
100 nach Mälzel, doch kann dies nur für die ersten zwei Achtelnoten gelten, denn die Empfindung hat auch ihren Takt. Dieses ist aber doch nicht ganz in diesem Grade (100 nämlich) auszudrücken.
Die Worte „doch nicht ganz“ bedeuten das Gleiche wie „nur zum Teil“. Zu welchem Teil? Natürlich zum Zweidrittel-Teil. Denn wenn das Hauptzeitmaß in das Nebenzeitmaß umgewandelt wird, verliert es an Geschwindigkeit in einem ganz bestimmten Grad. Es wird um eine Tempo- Quinte langsamer und fällt von 100 auf 66 zurück auf Mälzels Skala.
Mit diesem Rätselvers hat Beethoven seine Strategie gegen den Einzug des Mechanismus in die Musik vorgestellt. Sie ist ebenso genial wie einfach. Der Komponist geht dem Gegner in der Gestalt des Metronoms Mälzels nicht aus dem Weg, sondern stellt sich ihm wie ein mittelalterlicher Ritter einsam zum Kampf. Mit einem Schlag haut er den Drachen der mechanischen Zeitbestimmung in zwei Teile, in den „Takt nach Mälzel“ auf der einen Seite, „den Takt der Empfindung“ auf der anderen („die Empfindung hat auch ihren Takt“). Der Mälzeltakt ist der vordergründige, suchen muss man nach dem Takt der Empfindung.
Nach außen hin zeigt sich Beethoven somit äußerst zuvorkommend. Er geht auf die Wünsche der gefühllosen Außenwelt ein und „gibt dem Mälzel, was des Mälzels ist“. Er bietet dem Erfinder des Metronoms und dessen Konsorten eine mechanisierte Version seiner kleinen Tonschöpfung „So oder so“ an, wohl wissend, dass er seinen Interpreten ohnehin nicht zu einem bestimmten Tempo zwingen kann. Hinter dieser Fassade verbirgt sich das wahre Gefühl, das durch die verrätselte Zahl einen unerwarteten Schutz bekommt.
Man darf nicht vergessen, dass Beethoven selbst von vielen seiner Zeitgenossen oft als hart und unnahbar empfunden wurde. Dabei ist es angesichts des hoch emotionalen Gehalts seiner Musik undenkbar, dass er beim Komponieren immer wie eine Maschine funktionierte. Ungezählt sind die Tränen, welche er im stillen Kämmerlein vergossen hat, ungezählt schon deshalb, weil er beim Komponieren keine Menschen in seiner Nähe ertrug. Die Erfindung des Mälzeltaktes gibt uns eine ferne Ahnung davon, dass er nach einem harten Panzer suchte, um die extreme Verletzlichkeit seiner Seele einigermaßen schützen zu können. Interessant ist dabei, dass er zwischen dem Takt nach Mälzel und dem Takt der Empfindung eine klar definierte Beziehung bestehen lässt.
Allerdings gibt es einen einfachen Weg, die Zahl M.M. 66 für die Zählzeit des Lieds zu finden. Wenn der Sänger nichts von einer Metronomzahl weiß und sein Herz in die Wiedergabe der Komposition legt, kommt er automatisch auf Tempo 66. Bei Bedarf kann ich den Namen einer Sängerin aus Wien nennen, die in Gegenwart von Zeugen mit mir am Klavier die Probe aufs Exempel gemacht und die Richtigkeit der Zahl 66 glänzend bewiesen hat.
Fazit: Die Auflösung der Rätselzahl 100 zeigt, dass der Mälzelsche Takt aus Beethovens Sicht überflüssig ist, weil er sich, sobald er erkannt wird, wie eine Fata Morgana ins Nichts auflöst. Aber diese Überflüssigkeit wird erst wirksam, wenn das Rätsel erkannt und gelöst worden ist. Bevor es so weit ist, wacht die ungelöste Rätselzahl wie eine Sphinx vor dem Grab, in welchem die unsterbliche Empfindung ruht. Wie soll man ihren Zustand beschreiben? Schlaf oder Tod? Egal, sagt der Dichter von „So oder so“:
hell strahlt das Morgenrot.
Beethovens Verhältnis zur Obrigkeit
Leider ist die Beethovenforschung nicht darüber informiert, an welchem Tag und auf welchem Weg dem Tondichter das Metronom zugestellt wurde. Sicher scheint zu sein, dass Beethoven es Anfang 1817 vom Hersteller als Geschenk bekam, aber nicht aus den Händen von Mälzel selbst. Zum Einen weilte dieser zu diesem Zeitpunkt nicht in Wien, zum Anderen hätte er es auch wohl nicht gewagt, seinem Kontrahenten unter die Augen zu kommen, denn der Rechtsstreit von 1814 war noch keineswegs beigelegt.
Zwar lässt sich nicht ausschließen, dass Mälzel sein Geschenk auf gut Glück per Post an den berühmten Adressaten geschickt hat, aber dass er dies ohne entsprechendes Begleitschreiben gemacht hätte, ist absolut undenkbar. Ein solches Begleitschreiben liegt der Nachwelt nicht vor, was nicht sagen will, dass es nicht existiert hat. Denn wenn es danach ginge, was von der Korrespondenz Beethovens erhalten geblieben ist, hätte der Komponist nur selten Antwort bekommen auf die zweitausend Briefe und Zettel von seiner Hand, welche uns bekannt sind.
Wegen der Befangenheit Mälzels gegenüber Beethoven und auch wegen der Wichtigkeit, die von den Wiener Behörden dem Metronomprojekt Mälzels beigemessen wurde, ist es wahrscheinlicher, dass Zwischenpersonen eingeschaltet worden sind. So ist gut vorstellbar, dass Mosel und Salieri den Komponisten besucht haben um seine Stimmung zu erkunden und ihn an seine Verantwortung bezüglich des Metronomprojekts zu erinnern. Am wahrscheinlichsten ist aber, dass Mosel sich diese Mühe erspart und Beethoven einfach per Brief mitgeteilt hat, dass „an höchster Stelle“ ein Dekret für die musikalische Fachwelt vorbereitet worden sei mit dem Zweck, die traditionellen italienischen Tempobezeichnungen durch verbindliche Tempovorschriften zu ersetzen. In einem solchen Schreiben wäre Beethoven natürlich aufgefordert worden, selbst am Projekt teilzunehmen und das eigene Oeuvre mit einzubeziehen. Vor allem sollte dies nicht nur für die Werke gelten, die noch geschrieben werden mussten, sondern auch für die bestehenden Kompositionen, insbesondere für Beethovens frühes Oeuvre, das von den Zeitgenossen sosehr geliebt wurde. Nun, auch dieser Brief ist nicht erhalten, aber dafür kennen wir einen Brief von Beethoven an Mosel, der hervorragend als Antwort auf eine solche Aufforderung passt:
Euer Wohlgeboren!
Herzlich freut mich die selbe Ansicht, welche sie mit mir theilen in Ansehung der noch aus der Barbarey herrührenden Betzeichnungen des Zeitmaaßes, denn nur z.B. was kann widersinniger seyn als Allegro welches ein für allemal Lustig heißt, u. wie weit entfernt sind wir oft von diesem Begriffe dieses Zeitmaaßes, so daß das Stück selbst das Gegentheil der Betzeichnung sagt - - - -
Читать дальше