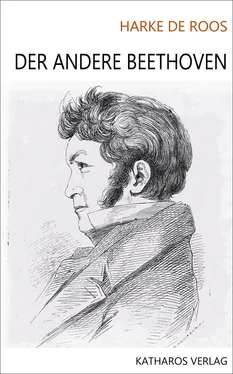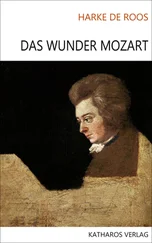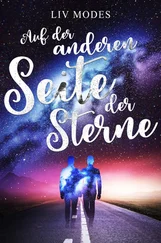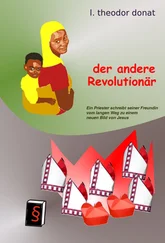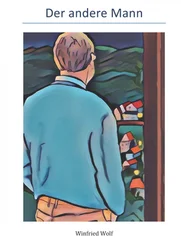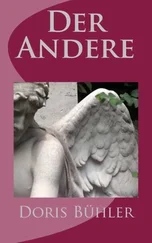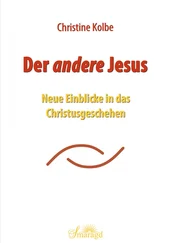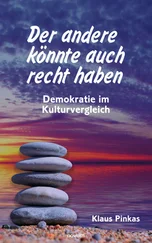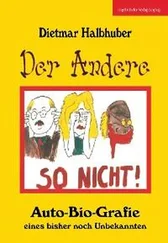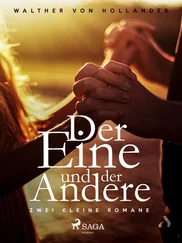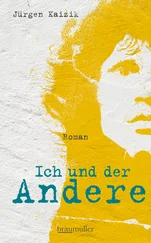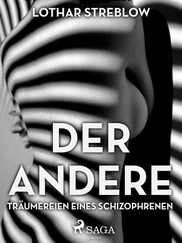Zunächst einmal führte Mälzels Weg nicht nach London, sondern nach Amsterdam, wo er im Herbst 1814 sein Panharmonikum und seinen mechanischen Trompeter vor den staunenden Holländern musizieren ließ. In der niederländischen Hauptstadt machte er eine wichtige Entdeckung, als er einen Kollegen namens Diederich Nikolaus Winkel in seiner Werkstatt besuchte. Dieser aus Deutschland stammende Mechaniker hatte nichts weniger als das perfekte Metronom erfunden, nach dem Mälzel so lange gesucht hatte. Stolz führte Winkel seine Erfindung dem berühmten Kollegen aus Wien vor. Dieser studierte die Mechanik Winkels genau, machte sich das Prinzip zu eigen und kehrte Amsterdam für immer den Rücken.
Innerhalb von zwei Jahren ließ Mälzel Winkels Erfindung als eigene Erfindung in München, Paris und London patentieren. In Paris gründete er 1816 eine Fabrik zur Herstellung von Metronomen. Als Winkel von Mälzels Plagiat erfuhr, war es bereits zu spät. 1820 gewann er zwar den Prozess um die Urheberschaft der Erfindung, aber zu diesem Zeitpunkt war das Gerät bereits überall als Mälzels Metronom (M.M.) im Handel.
Man mag sich vielleicht wundern, warum das Monopol auf einen Zeitmesser so begehrt war. So groß kann der Bedarf an musikalischen Tachometern doch nicht gewesen sein, dass man damit das große Geschäft machen konnte. Tatsächlich ist das Messen des musikalischen Zeitmaßes eine Beschäftigung, die nur eine Handvoll Musiker beglücken kann.
Das Metronom hat aber noch eine zweite Eigenschaft, die sehr wohl auf einen großen Umsatz hoffen ließ, vor allem zum Zeitpunkt seines Entstehens. Auf Wunsch liefert es nämlich das absolute Gleichmaß in jeder beliebigen Geschwindigkeit. Das Gleichmaß ist ja so eine Sache, die oft gering geschätzt wird, aber zum festen Prinzip der Schöpfung gehört. Ohne dieses Prinzip würde das Universum im Bruchteil einer Sekunde auseinander fallen.
Aber auch in der Musik ist dieses Prinzip allgegenwärtig. Im Barock und in der Wiener Klassik regierte das gleichmäßige Zeitmaß mit festem Impuls über die ganze abendländische Musik vom Kaukasus bis zum Atlantik, von Lappland bis nach Sizilien. Die Spuren dieses Stilmittels trifft man in allen geschriebenen Noten an. Die Bezeichnungen für die Beschleunigung (accelerando) oder Verzögerung (ritenuto, ritardando) sind bis zur Musik von Franz Schubert Ausnahmeerscheinungen, im ganzen 18. Jahrhundert kommen sie so gut wie nie vor. Anscheinend hatte der regelmäßige Impuls in der damaligen Musik eine ähnliche Funktion wie in den Jazzkellern des 20. Jahrhunderts.
Dieses Gefühl für Ebenmaß steckte dem musizierenden Menschen des 18. Jahrhunderts so sehr im Blut, dass auch bei größeren Orchestern kein Dirigent vor der Gruppe stand. Es genügte der Konzertmeister, der Geiger am ersten Pult, der sogenannte Director.
Mit dem beginnenden 19. Jahrhundert wuchs ein anderes Gefühl der Tempogestaltung heran. Es entstand allmählich Bedarf an flexiblen Tempi, an variablen Geschwindigkeiten, welche sich biegsam und schmiegsam um den musizierenden Genius ranken. In der Renaissance und im Barock mussten die Meister der Musik den Tempi folgen, in der Periode der Hochromantik hatten die Tempi ihrem Meister zu folgen. Für die Orchestermusiker bedeutete diese Akzentverlagerung, dass sie plötzlich einen taktierenden Vorgesetzten brauchten. Ohne Dirigent kommt kein romantisches Orchester zurecht. Es leuchtet ein, dass es eine Übergangszeit gegeben haben muss, in der beide Prinzipien parallel in der Musikpraxis vorhanden waren, das Prinzip des Gleichmaßes und das Prinzip der Tempofreiheit.
Es leuchtet ebenfalls ein, dass diese Übergangszeit gekennzeichnet wird durch die Suche nach dem Metronom als Sinnbild des gleichmäßigen Tempos und Garant für die gute alte Zeit. Der Bedarf nach dem gleichmäßigen Ticken des Metronompendels war wie der Ruf nach einem mechanischen Taktschläger, nach einem Kapellmeister-Roboter, der den übenden Schüler unerbittlich im richtigen Rhythmus hält. So gesehen war die Einführung des Metronoms ein rückwärts gerichteter Schritt, ein Symptom der Restauration und ihres Meisters Fürst Metternich.
Gar kein Zufall ist, dass die aktivsten Vorkämpfer des Metronoms zu den reaktionärsten Musikern ihrer Epoche zählten. Voran Antonio Salieri, der im Goldenen Jahrzehnt der Wiener Klassik als Opernkomponist noch große Erfolge buchen konnte, aber sich seit dem Tod Mozarts auf die Kirchenmusik und das Unterrichten seiner Schüler beschränkte. Im zweiten Jahrzehnt des neuen Jahrhunderts hatte der ehemalige Avantgardist sich zu einer konservativen Musikautorität entwickelt.
Neben ihm stand, Schulter an Schulter, der ultrakonservative Ignaz Mosel, der unter Metternich einen dominierenden Posten im Wiener Musikleben einnahm und wegen seiner – für uns absolut schleierhaften – Verdienste für die Musik 1817 in den Adelstand erhoben wurde. Beethovens Kommentar zu ihm:
Trübe fließt die Mosel in den Rhein.
Mosel ging noch weiter als Salieri und wollte das Metronom bei jeder Form von Musikausübung einführen. Hier spürt man die Atmosphäre im Polizeistaat Metternichs mit seiner flächendeckenden Überwachung der Privatsphäre und erstickende Wirkung auf jedes Gefühl von Freiheit, selbst wenn sich diese in einer so unpolitischen Art wie der Musik äußert. Johann Nepomuk Mälzel war ein Geschäftsmann: die Politik war ihm herzlich egal, solange sie seinen geschäftlichen Aussichten nicht im Weg stand. Wenn Mosel das Bedürfnis hatte, aus dieser „Erfindung“ einen Überwachungsapparat zu machen, bitte schön! Mälzel hatte ein anderes Problem.
Im Jahre 1817 war es so weit, dass Mälzels Metronom auf den Markt kam. In London, Paris und München lag der Weg zum Markt offen und frei, aber in Wien, der Haupstadt der Musik, lebte Beethoven, der ungekrönte König aller Komponisten, der berühmteste Musiker der ganzen Welt. Ohne Mitwirkung dieser Person war das Geschäft in Österreich nur halb so lukrativ.
Die Sache mit der Schlachtsinfonie stand aber nach wie vor im Raum. Mälzel hatte Wien seit dem Ausbruch des Konfliktes gemieden, wie er auch Amsterdam gemieden hatte. Die Rückkehr nach Wien wegen der Eroberung des österreichischen Marktes schien schwierig. Kaiser Franz hatte Mälzel zwar im Frühling 1817 seine Lizenz zum Vertrieb des Metronoms erteilt und auch Mosel und Salieri warteten ungeduldig auf die Einfuhr des toten Tempopolizisten, aber Mälzel konnte nicht ahnen, wie Beethoven mit seinem notorisch unberechenbaren Charakter reagieren würde. Geschäftstüchtig, wie er war, hatte er 200 Metronome als Werbegeschenk an prominente Musiker verschickt. Auch Beethoven hatte ein wunderschönes, brandneues Exemplar von Mälzel geschenkt bekommen. Wäre es denkbar, dass er dieses Geschenk als „dummes Zeug“ aus dem Fenster werfen würde?
Wellingtons Sieg oder die Schlacht bei Vittoria heißt die Schlachtsinfonie wörtlich. Das 91. Opus Beethovens besteht aus zwei Teilen. Der 1. Teil stellt die Schlacht selbst dar, der 2. Teil, die Siegessymphonie genannt, ist eine Siegesfeier der Engländer, bei der der englischen Gefallenen gedacht und die Nationalhymne gespielt wird. Dieser Teil, in dem Beethoven nach eigener Aussage den Engländern ein wenig zeigen wollte, welch ein Segen in „God save the King“ ruht, klingt zu Ehren des englischen Königs. Folgerichtig ist der englische König der Widmungsträger der ganzen Partitur. In der Zeit der Komposition wurde England regiert vom Prinzregenten George, stellvertretend für seinen erkrankten Vater George III.
Um diese Widmung zu bekräftigen, ließ Beethoven eine prachtvolle Kopie seiner Komposition anfertigen und durch Lord Castlereagh oder einen Boten des russischen Gesandten in Österreich, des Grafen Rasumowsky, in die Hände des Prinzregenten legen. Zu welchem Zeitpunkt dies geschah, ist nicht eindeutig geklärt. Hätte der Prinzregent eine Empfangsquittung oder ein Dankesschreiben an den Komponisten geschickt, wäre das Datum kein Rätsel. Dass das Geschenk tatsächlich angekommen ist, steht aber fest.
Читать дальше