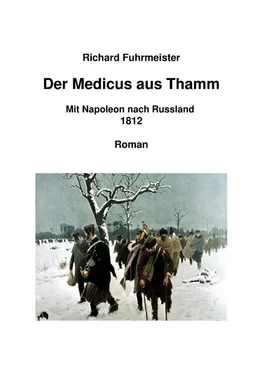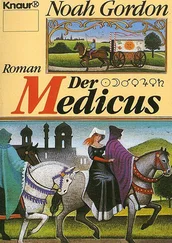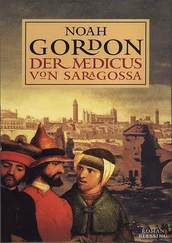Eines aber konnte Christoph nicht leugnen: Trotz seines ausgeprägten Widerwillens gegen den Krieg, gegen das Töten hatte er auf den Schlachtfeldern und in den Lazaretten hinreichend Gelegenheit, chirurgisch zu wirken, Verwundete zu versorgen, auch Erkrankungen wie Ruhr oder Typhus kennen zu lernen, die nicht durch den Kampf herbeigeführt waren, und sie zu behandeln. Möglichkeiten, die ihm das Studium allein nicht geboten hätte.
Aber diese Kenntnisse und Fähigkeiten auf solche Weise zu erwerben, hatte in Christoph Spuren hinterlassen. Jedes Mal, wenn er nach einem Feldzug zum Studium ins beschauliche Tübingen zurückkehrte, war er ernster geworden und brauchte längere Zeit, sich wieder an den ungewohnt friedlichen Alltag zu gewöhnen.
Nachdem der Hohenasperg hinter ihm lag, löste sich die Beklommenheit in Christophs Brust und er atmete wieder freier. Unwillkürlich hatte er sein Pferd angetrieben, um die Bergfestung nicht länger als unvermeidlich im Blick zu haben. Ein Wäldchen aus Buchen und Eichen, deren kahle Äste mit einer dünnen Reifschicht überzogen waren, nahm ihn auf. Der schmale, unebene Pfad und herabhängende Zweige zwangen den Grauschimmel, im Schritt zu gehen.
Christoph wie auch das Pferd genossen den Ritt durch den frostigen Wintermorgen. Der Schimmel, weil er zwei Tage nur im Stall gestanden hatte, und der Reiter, weil sein Kopf nach dem weinreichen Abend zunehmend klarer wurde.
Reiten zu können, nicht gehen zu müssen, welch ein Fortschritt für die Feldärzte der Infanterie, der Christoph bisher angehörte und der er auch bei seiner neuerlichen Einberufung zugeteilt war.
Lebhaft erinnerte er sich an seinen ersten Feldzug 1805, als er im Alter von achtzehn Jahren als Unterarzt mit einem württembergischen Bataillon gegen die Österreicher ziehen musste. Schon auf den ersten Märschen wurde er, im langen Gehen ungeübt, von schmerzhaften Wadenkrämpfen befallen, die sich so sehr steigerten, dass er ab Ulm zusammen mit anderen Maroden auf einem Pferdewagen gefahren wurde. In Günzburg quartierte man ihn bei einem alten, kinderlosen Ehepaar ein. Die mitleidige Frau, dem inzwischen fiebernden Patienten in mütterlicher Sorge zugetan, wich die ganze Nacht hindurch nicht von seinem Lager, das sie ihm in der Wohnstube bereitet hatte. Immer wieder bot sie ihm Speise und Trank an, wovon er nur letzteren zu sich nehmen konnte, und betete für ihn.
Trotz leichter Besserung seines Zustandes war er auch in den folgenden zwei Tagen noch nicht fähig zu gehen und musste gefahren werden. In einem Dorf bei Augsburg, dessen Name ihm entfallen war, geschah etwas, das Christoph sein Leben lang nicht vergessen würde.
Mit einigen anderen Soldaten hatte er, wiederum in der Wohnstube, bei Bauersleuten ein Nachtlager aus Stroh bezogen. Er lag weit hinten in der Stube, vor ihm die Kameraden. Wer zu ihm wollte, musste über die Schlafenden hinwegsteigen. Noch immer, obschon weniger als in den Tagen und Nächten zuvor, von Schmerzen geplagt, fand er nicht zu echtem Schlaf, sondern nur zu einem leichten Schlummer, aus dem er mehrmals erwachte. Tief in der Nacht wachte er erneut auf und sah zu seiner Linken, ganz nah bei ihm stehend, eine menschliche Gestalt in einer lichtnebelartigen Hülle. Eine innere Stimme sagte ihm sofort: „Deine Mutter!“. Gleich darauf verschwand die Gestalt.
Außer seinem Vater erzählte er nie jemandem von jener Erscheinung und er beteuerte ihm gegenüber, dass er, obschon gerade aus dem Schlummer erwacht, in diesen wenigen Sekunden geistig völlig klar und bei vollem Bewusstsein gewesen sei. Zudem hatte er damals wie heute Zweifel an der Unsterblichkeit, an ein Weiterleben nach dem Tod. Aber deutlich habe er die geisterhafte Gestalt zwischen sich und den Kameraden gesehen, die in der vom Mondschein erhellten Stube auf dem Boden lagen. Auch habe er in jenen von Schmerzen geprägten Tagen nicht öfter an seine früh verstorbene Mutter gedacht als vorher. Er konnte sich ohnehin nur schwach an sie erinnern. In seiner letzten und stärksten Erinnerung sah er sie auf dem Totenbett liegen. Durch ein Faul- und Gallenfieber war sie dem Vierjährigen entrissen worden.
Sein Vater, gottesgläubig und anders als Christoph von einem Weiterleben im Jenseits überzeugt, zweifelte nicht an der Echtheit jener Erscheinung und bestärkte den noch zaudernden Sohn im Glauben, dass ihm seine Mutter erschienen sei, um ihn aufzurichten und ihm Mut zu machen.
Dass er in jener Nacht einer Sinnestäuschung infolge eines leichten, kaum mehr vorhandenen Fiebers erlegen sein könnte, glaubte Christoph bis heute nicht. Wie oft hatte ihn in den folgenden Jahren noch weit höheres Fieber geschüttelt und ihn die absonderlichsten Erscheinungen und Geschehnisse sehen lassen. Aber niemals mehr war ihm die Lichtgestalt erschienen, von der er annahm, dass sie seine Mutter gewesen sei.
So lag er zum Beispiel, von dem nur kurzen, siegreichen Feldzug gegen die österreichisch-russische Koalition zurückgekehrt, einige Monate später in dem mal von badischem, mal von württembergischem Militär besetzten Kraichgaustädtchen Bischofsheim zehn Tage und Nächte mit Typhus danieder. Im Fieberdelirium sah und hörte er immer wieder einen mit vier Pferden bespannten Wagen durch sein Krankenzimmer rasen. Der Fuhrmann knallte entsetzlich mit der Peitsche und die Vorder- und Hinterräder des Wagens krachten dröhnend eine Treppe hinunter, so dass dem Fiebernden der Kopf zu zerspringen schien.
In Bischofsheim war es auch, dass sich Christoph das erste Mal verliebte. Klara, die sechzehnjährige Tochter des Kaufmanns, bei dem er einquartiert war, pflegte den nur zwei Jahre Älteren mit liebevoller Hingabe und trug so außerordentlich zu seiner Gesundung bei. In den Wochen und Monaten, nachdem er mit seiner Einheit weitergezogen war, fragte er sich manchmal: War es ihre aufopfernde Pflege oder ihr Liebreiz oder beides, warum er so oft an sie denken musste? An das besorgte, aber auch fröhliche Mädchen mit den langen blonden Zöpfen, das sich flink und anmutig durch sein Zimmer bewegte, was er allerdings erst wahrnahm, als sich sein Zustand gebessert hatte.
Er fand dann keine Antwort auf seine Frage und sagte sich, dass es doch ohne Bedeutung sei zu wissen, warum genau seine Gedanken sich immer wieder ihr zuwandten, warum er glaubte, sich in sie verliebt zu haben.
Und wie stand sie zu ihm? Fühlte sie wie er? Maßte er sich nicht etwas an, wozu es gar keinen Grund gab, bildete sich nur ein, sie könnte empfinden, was er empfand?
Später als Student in Tübingen verliebte er sich auch einige Male. Aber nie fühlte er dabei so stark wie für Klara und was er für die durchaus hübschen Eroberungen empfand, war bald wieder verflogen, dauerte nicht länger als ein paar Tage, kaum einmal mehr als zwei bis drei Wochen.
Er hatte bald begonnen, Klara zu schreiben. Anfangs sich behutsam vortastend, ihre Gefühle auslotend und darauf bedacht, sie nicht zu verschrecken. Wie leicht hätte sie sich zurückziehen können, noch bevor er sich ihr offenbart hatte. Er durfte nicht vergessen, dass sie noch ein Mädchen war, als einziges Kind von den Eltern unendlich geliebt und behütet und von unschuldiger Reinheit des Fühlens und Denkens.
Er schrieb ihr, wie dankbar er für ihre damalige Pflege sei und dass er oft an sie denke, sie nicht vergessen könne.
Sie antwortete ihm nicht sofort. Wollte sie sich erst über ihre Gefühle klar werden? Oder hatten ihre Eltern, die Christoph so gastfreundlich aufnahmen und ihn wie einen Sohn behandelten, ihr den Brief nicht ausgehändigt, weil sie glaubten, Klara sei noch zu jung für etwas so Ernstes, wie die Liebe es in ihren Augen war?
Aber Christophs Bedenken wurden bald zerstreut. Im Stuttgarter Garnisonshospital, wo er in untergeordneter Stellung Dienst tat und die Invaliden des letzten Feldzugs versorgte, erreichte ihn Klaras erster Brief. Sein Herz schlug schneller, als er ihn öffnete. In großen, schön geschwungenen Lettern schrieb sie, Christophs erste Vermutung bestätigend:
Читать дальше