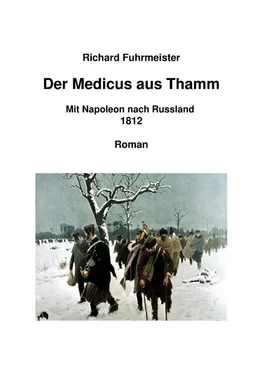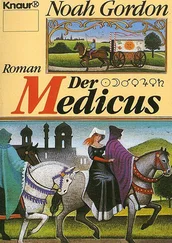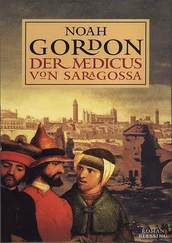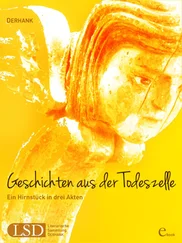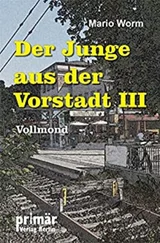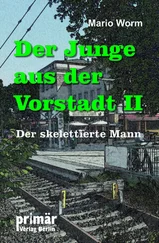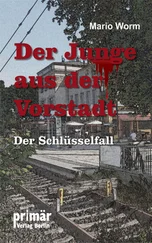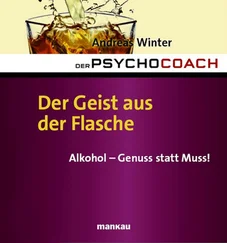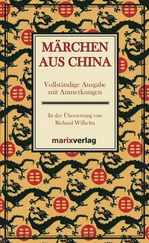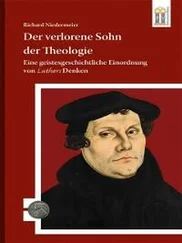„So, meine Lieben, Schluss für heute!“
„Aber Wilhelm, sei doch nicht so hart! Schenk halt nochmal ein!“ bettelte Frieder. „Wir sehen unseren Christoph doch für lange Zeit nicht mehr. Wer weiß, ob er ...“
Schnell brach er ab, stammelte dann nach kurzem Schweigen verlegen:
„Ich...ich...wollte nur sagen, dass du vielleicht eine weite Reise vor dir hast, Christoph, und deshalb lange fort sein wirst. Genau weiß man es ja nicht, aber es heißt, Napoleon will einen Krieg mit Russland. Russland ist nicht Österreich oder Preußen, sondern weit, weit weg. So weit weg warst du noch nie in deinem Leben, Christoph.“
Der Wirt hatte sich erweichen lassen und nachgeschenkt.
„Ich weiß, Frieder.“, erwiderte Christoph.„Ich weiß auch, was du sagen wolltest. Einen Krieg mit Russland zu beginnen und ihn sehr wahrscheinlich auch noch auf russischem Boden auszutragen, ist ein großes Wagnis. Keiner weiß, ob und wann er von dort zurückkommt. Mit den bisherigen Kriegszügen gegen Österreich oder Preußen, zu denen uns Napoleon gezwungen hat, kann man das nicht vergleichen. Das wissen alle. Und glaub mir, Frieder, kaum einer zieht gern in diesen Krieg. Außer vielleicht ein paar junge Offiziere, die sich im Kampf bewähren möchten und nach Ruhm und Ehre streben. Und meinst du nicht auch, ich würde tausendmal lieber Dienst im Garnisonshospital in Stuttgart tun als an einem so waghalsigen Unterfangen teilzunehmen?“
Frieder, der seine unbedachte Äußerung sofort bereut hatte, wollte seinen Fehler wettmachen und erhob sein frisch gefülltes Glas:
„Christoph, ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du heil zurückkommst. Egal, wo es hingeht. “
Ludwig und der Wirt schlossen sich Frieders in feierlichem Ernst vorgebrachten Wunsch an.
Bis Mitternacht noch redeten die Freunde, mal hitzig aufgebracht, mal bekümmert, über Christophs nahenden Abschied von der Heimat, über das ferne Russland und den langen Marsch dorthin, über die Gegner Napoleon und Zar Alexander, stritten heftig über die Schuldfrage am offenbar unvermeidlichen Kriegsausbruch, verurteilten die Unnachgiebigkeit Napoleons gegenüber dem Zaren.
„Nur weil Napoleon die Engländer mit seiner Kontinentalsperre in die Knie zwingen will, soll sich Russland wie die anderen europäischen Länder auch daran halten und seine Häfen für englische Schiffe sperren.“, schimpfte Frieder. „Und umgekehrt soll Russland keine Güter an England liefern dürfen. Vor allem kein Holz für den Schiffbau.“
„Die Niederlage der französischen Flotte in der Schlacht von Trafalgar hat Napoleon nie verwunden. Danach musste er den Briten endgültig die Seeherrschaft überlassen.“, fügte Ludwig hinzu. „Und er will auf jeden Fall verhindern, dass sie noch mehr Schiffe bauen.“
„Und seinen Plan, den Kanal zu überqueren und mit seiner Streitmacht in England zu landen, musste er auch aufgeben, nachdem Frankreichs Flotte ausgeschaltet war.“
„Dass Russland sich nicht mehr an die Kontinentalsperre halten will, weil sie seine Wirtschaft schwächt, ist verständlich.“ meinte Christoph. „Das sollte Napoleon einsehen.“
„Aber das tut er nicht. Er riskiert lieber einen Krieg als sich mit dem Zaren zu verständigen.“, erzürnte sich Frieder. „Und wir müssen es ausbaden. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie viele unserer Soldaten deshalb dran glauben müssen.“
Immer wieder kamen sie auf ihren ungeliebten, aber auch unglückseligen König zurück, dem keine andere Wahl blieb, als das Schicksal seiner Soldaten in die Hände des Franzosenkaisers zu legen, beklagten vor allem den, wie sie glaubten, aussichtslosen bevorstehenden Krieg, den die Grande Armée trotz ihres gewaltigen, niemals zuvor gesehenen Aufgebots an Menschen und Waffen nicht gewinnen konnte.
***
An all das dachte Christoph während seines Ritts nach Stuttgart. Kaum hatte er Thamm hinter sich gelassen, erhob sich zu seiner Linken, noch halb vom Morgennebel verhüllt, wie drohend der Hohenasperg. Christoph fröstelte bei dem Gedanken an das gefürchtete Gefängnis, dem die Inhaftierten so bezeichnende Namen wie Tränenberg, Höllenberg oder Jammerbuckel gegeben hatten. Der Dichter Christian Schubart war dort auf Geheiß des Herzogs Karl Eugen zehn Jahre eingekerkert gewesen, ohne Urteil und ohne den Grund für die Haft zu erfahren. In einem Brief an seinen Bruder schilderte Schubart sein unvorstellbares Leid: „Gefangenschaft ist Hölle. Einsamkeit, gähnende Langeweile, Frost, Hunger, Höllenangst, stechende Sehnsucht nach Weib und Kind, Erniedrigung aller Art, Schlaflosigkeit in langen Schauernächten, rastloses Wälzen auf einem faulen Strohlager sind die Furien, die mich dicht an den Rand der Verzweiflung geißeln.“ Friedrich Schiller, damals noch junger Militärarzt im Stuttgarter Garnisonshospital, hatte Schubart Ende 1781 an jenem elenden Ort besuchen dürfen und war betroffen von dort zurückgekehrt. Hätten ihn knapp ein Jahr später die Häscher Karl Eugens bei seiner Flucht aus Württemberg gefasst, wäre sicher auch er zur Festungshaft auf dem Schreckensberg verurteilt worden. Ob er dort seine großen Werke geschrieben hätte, die ihn so berühmt werden ließen, bezweifelte Christoph.
Er, der den fast dreißig Jahre früher Geborenen verehrte und dessen Dichtung begeistert aufnahm, hatte mit Schiller einiges gemeinsam. Beider Väter waren Wundärzte, wie die Chirurgi auch genannt wurden, beide führten neben anderen den Vornamen Christoph, beide hatten die Lateinschule in Ludwigsburg besucht, Medizin studiert und waren wider ihren Willen Militärärzte geworden. Schiller, der sich nicht zum Arzt, sondern früh schon zum Dichter berufen fühlte, nur für kurze Zeit, Christoph dagegen hatte das aus Neigung gewählte Medizinstudium in Tübingen mehrmals unterbrechen müssen, um an Feldzügen teilzunehmen.
Christoph fand insgeheim Gefallen an diesen Gemeinsamkeiten, hätte aber einen Vergleich mit dem Unerreichbaren als vermessen weit von sich gewiesen. Es genügte ihm, Schillers Werke zu lesen oder sich im Theater von seinen Dramen mitreißen und in eine andere als die eigene vertraute Welt entführen zu lassen. Wenn er eine Aufführung besucht hatte, wirkten die Handlung und das Schicksal der Personen eines Stücks noch lang in ihm nach. Er suchte dann nach Übereinstimmungen mit sich, besonders mit dem Helden des jeweiligen Dramas. Am stärksten ergriff ihn das tragische Schicksal der ungleichen Brüder Karl und Franz Moor in „Die Räuber“. Schillers umfangreiches „Lied von der Glocke“ hatte er auswendig gelernt und rezitierte es wie auch einige seiner Balladen, wenn er darum gebeten wurde. Als 1808 die erste vollständige Ausgabe von Goethes Faust Erster Teil veröffentlicht wurde, war Christoph zutiefst beeindruckt von Inhalt und Sprache der Tragödie und empfand es nicht als Verrat an seinem verehrten schwäbischen Landsmann, auch aus Goethes Werk zu zitieren und rezitieren. Besonders gern trug er daraus, wenn die Jahreszeit es gebot, den „Osterspaziergang“ vor.
In seiner Zeit auf der Lateinschule und später während des Medizinstudiums waren Christoph einige mit Beifall bedachte Gedichte gelungen, in denen er schwärmerisch die Natur, noch mehr aber die Liebe besang. Heimlich zugesteckt, verzauberten sie die wohlerzogenen, sittsamen Tübinger Bürger- und Professorentöchter, die dem hochgewachsenen, blonden Studiosus ohnedies zugetan waren. Seiner wohlklingenden Stimme, seinem anziehenden Lächeln, gepaart mit dem klaren, jedoch nicht kalten Blick aus blauen Augen, konnten nur wenige widerstehen. Sein höfliches, nie aufdringliches Benehmen taten ein Übriges. Nicht wenige Väter und Mütter hätten den zukünftigen Arzt gern als Schwiegersohn gesehen.
Aber aus keiner der flüchtigen Romanzen mit dieser oder jener Schönen aus dem Universitätsstädtchen am Neckar erwuchs eine dauerhafte Bindung. Zu sehr nahmen Christoph das Studium der Heilkunst und sein Drang nach immer neuem Wissen, nach fachlicher Vollkommenheit ein. Zu viel Zeit hatte ihm die erzwungene Teilnahme an den verhassten Kriegszügen des Franzosenkaisers geraubt.
Читать дальше