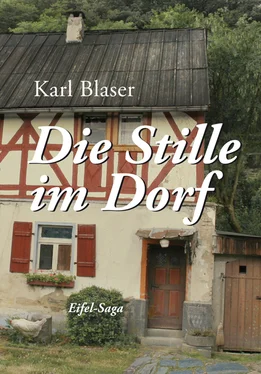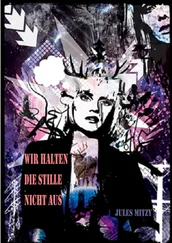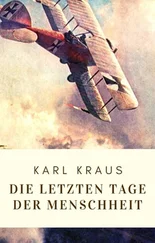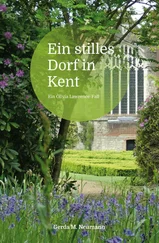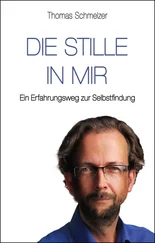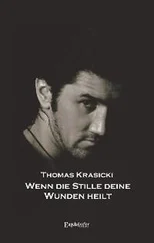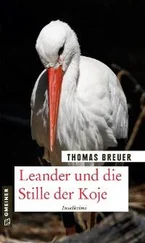Er kommt spät in diesem Jahr. Es ist ein sonniger Gründonnerstagnachmittag. Die Bauern des Dorfs schwitzen auf ihren Feldern. Die Saat muss in die lehmige Erde. Es ist höchste Zeit. Im Dorf herrscht Arbeitsstimmung. Die Tage sind noch kurz. Nur Johann sitzt gelassen mit den zwei Rentnern in seiner gut beheizten Küche und hat Besseres zu tun, als sich auf dem Feld abzurackern. Das Pflügen, Eggen und Säen überlässt er anderen: Marek, seine Frau Marsena und seine Tochter Hanka sind es, die auf Johanns Feldern malochen müssen. Die drei ‚Polacken‘, wie Johann sie nennt, leben seit Kriegsausbruch auf seinem Hof. Es sind polnische Zwangsarbeiter, Fremdarbeiter genannt, die nachts im Stall bei den Tieren schlafen und tagsüber von früh bis spät für den Ortsbauernführer schuften müssen. Johann und die anderen Bauern im Dorf empfinden nichts Unrechtes dabei, dass die ‚Untermenschen‘, wie sie beschimpft werden, ohne Lohn und erst recht ohne Dank ihre schwere Arbeit tun. Johann ist besonders streng mit den Polen. Er hat Marek verboten, ihm ins Gesicht zu sehen. An diesem Nachmittag ist der reiche Bauer guter Laune, hat er doch gerade beim Kartenspiel eine Glückssträhne: Jupp und Rudi verlieren eine Partie nach der anderen, und neben Johanns vollem Schnapsglas türmen sich die Kupferpfennige, die er den beiden aus der Tasche gezogen hat.
Margarete hat sich aus der Küche gestohlen, aber anstatt in den Keller zu gehen, wie alle denken, ist sie schmollend in ihr Zimmer im ersten Stock geflüchtet und hat sich dort eingeschlossen. Die Neunzehnjährige hasst diesen Bauernhof! Nicht um alles in der Welt kann sie sich erklären, warum die göttliche Vorsehung sie hier, ausgerechnet über einem Bauerndorf in der Vulkaneifel, abgeworfen hat. Weder dem Land noch dem Hof kann sie etwas Positives abgewinnen. Als kleines Mädchen hat sie geträumt, dass sie auf eine lange Reise geht; dass ein Engel einschweben und sie an einen Ort tragen werde, an dem sie glücklich ist: wo sie schicke Kostüme anhaben darf; wo sie ihr hübsches braunes Haar nicht mehr unter einem Kopftuch, und ihre langen Beine nicht unter einem dicken wollenen Rock verbergen muss. Aber Margaretes Traum bleibt ein Traum. Nichts geschieht, und dabei ist sie schon fünf Jahre aus der Dorfschule entlassen. Niemand kommt, der sie mitnimmt auf eine Reise. Der Engel lässt auf sich warten.
Stattdessen ist Krieg.
»Warum immer ich«, fragt sie sich. »Warum krieg ich immer nur den Zipfel von der Wurst?« Und sie gibt sich selbst die Antwort: »Weil außer mir niemand da ist.«
Margarete hat noch einen Bruder, Micha, der ist nur zwei Jahre älter als sie, und alle sagen, er sei auch klüger. Margarete findet das ungerecht. Aber an dem, was die Leute sagen, ist was dran: In der Schule hat Micha immer ihre Hausaufgaben gemacht und ihr vorgesagt. Für Margarete war das bequem. Sie hatte Micha im Rücken, auf den Bruder konnte sie sich verlassen. Alle Kinder des Dorfs saßen in einem Raum. Die Kleinen vorn, die Großen hinten. Vorne die Tafel, hinten an der Wand die Weltkarte mit dem Globus, der aussah wie ein bemaltes Osterei. Es waren viele Kinder, und es waren viele Jungs. Die sind nun alle im Krieg, so wie ihr Bruder. Auch er, wie alle jungen Männer, ist eingezogen und unter Waffen gestellt worden. Einige sind in Italien, andere in Frankreich. Sogar aus Afrika kam Feldpost mit einem Foto von dem kleinen Herbert. Der hätte viel zu erzählen gehabt, wenn er wiedergekommen wäre. Aber vor drei Monaten ist er gefallen. Micha haben sie an die Ostfront abkommandiert, nachdem er nur kurz im lothringischen Pont-à-Mousson eine Grundausbildung am Gewehr erhalten hat. Von dort ist sein letztes Lebenszeichen, ein zerknitterter Brief, angekommen. Er hat alle schön grüßen lassen und geschrieben, dass er in der Kirche Sankt-Martin des kleinen Städtchens, das am Fuß eines Hügels gelegen sei, am Sonntag dem französischen Priester als Messdiener assistiert habe.
»Es war alles genauso wie bei uns. Hier sprechen sie in der Kirche auch Latein«, hat er geschrieben. »Mir scheint, die Franzosen haben denselben Gott wie wir.«
Margarete zweifelt daran. Das Reich hat doch allen, auch den Franzosen, den Krieg erklärt. Es hat die Welt besetzt, und in Deutschland ist jetzt Hitler der Gott.
»Macht euch keine Sorgen. Ich komme bestimmt bald gesund nach Hause. Der Krieg dauert nicht lange«, war noch in Michas Brief zu lesen.
Es ist eine Weile her, dass sie dieses letzte Lebenszeichen von ihm erhalten haben.
Wenn Margarete eines hasst, dann ist es Fisch. Erst recht Hering. Pfui Teufel! Nicht nur, dass sie keinen Fisch essen mag: Sie kann Fisch nicht riechen. Schon der kleinste Luftzug, der den typischen Geruch weiterträgt, verursacht bei ihr auf der Stelle Brechreiz. Aber darauf scheint niemand da unten in der Küche Rücksicht zu nehmen. Ihr unüberwindlicher Ekel ist denen völlig egal. In den Keller soll sie hinabsteigen und vier übelriechende Heringe aus der immer noch halbvollen Tonne herausfischen. Einen für sie, einen für die Mutter, zwei für den Vater. Schon beim Gedanken, diese dicht verschlossene Holztonne zu öffnen, wird ihr auf der Stelle schlecht. Sofort würde der Gestank entweichen und sich im ganzen Haus festsetzen. Er kriecht überall hin, wie die Ratten. Noch Tage später ist er zu riechen. Sie weiß nicht, wie alt die Leichname sind, die in der Tonne lagern. Ihre Mutter hat die Ladung im letzten Herbst, oder war es der vorletzte oder der vorvorletzte, so genau kann Margarete sich nicht mehr erinnern, von einem fliegenden Händler gekauft und in einen Sud aus Wasser und Pökelsalz eingelegt. Salz konserviert. Damit kann man sogar Leichengeruch überdecken. Wieviel Salz es wohl braucht, um den Geruch der Kriegstoten zu überdecken, fragt sie sich.
Die Mutter hat das Fass luftdicht mit einem Gummiring zwischen Deckel und Gefäß verschlossen, wo die Fische in ihrem Salzgrab offenbar bis in alle Ewigkeit, Amen, haltbar sind. Bei Bedarf an Frei- oder Feiertagen landen sie stinkend auf dem Teller. Der Vater kann gar nicht genug davon kriegen, er allein isst mindestens zwei Heringe auf einen Streich, und da Margarete dankend verzichtet, würgt er anschließend, laut schmatzend, auch noch einen Dritten herunter. Übelriechend eingelegte Heringe gibt ihnen der Winter, frische Süßwasserforellen dagegen bringt der Sommer. Die Dorfburschen bringen sie heim, sie fangen die Forellen mit bloßen Händen aus dem kleinen Eschbach oder aus der etwas größeren Elz, die sich unweit vom Dorf durch die Täler schlängeln, bevor sich der Eschbach in die Elz und die Elz in die Mosel und die Mosel in den Rhein ergießen. Der Fischfang der Dorfjungen geschieht natürlich heimlich. Fischen und Jagen sind strengstens untersagt. Wer das Verbot missachtet, der muss »ins Dipo«, wie sie hier sagen; der landet im Gefängnis. Der Jagdpächter aus Düsseldorf namens Hugo Sander, ein reicher Industrieller, hat die Jagdrechte gepachtet, und ihm allein gehören alle wilden Tiere und die Fische. Er bedroht jeden Jungen mit Anzeige, aber bis jetzt hat es noch keinen erwischt. Gottlob taucht er nur gelegentlich hier auf, so wie früher der Kaiser aus Berlin. Die Hohe Eifel liegt weit vom Schuss. Kein Mensch interessiert sich dafür. Sander hat einen Aufseher eingesetzt: den alten Friedrich mit der Glatze, der am Dorfrand wohnt und ein Jagdgewehr trägt. Aber der lässt eine Fünf grade sein. Toni, sein Ältester, ist als Erster im Dorf gleich zu Kriegsbeginn gefallen. Friedrich verliert kein Wort darüber. Er zeigt keine Gefühle.
Im letzten Sommer, weil die Jungen alle im Krieg waren, ist Margarete allein losgezogen und hat versucht, Forellen zu fangen. Das war ein großer Reinfall. Und zu allem Übel hat Friedrich sie auch noch auf frischer Tat ertappt und ihr die Haarzöpfe langgezogen.
»Wenn ich dich noch einmal erwische, du dumme Göre, dann kommst du nicht mehr so glimpflich davon. Ich werd‘s deinen Eltern stecken«, hat er geschrien, und sie war weggelaufen.
Читать дальше