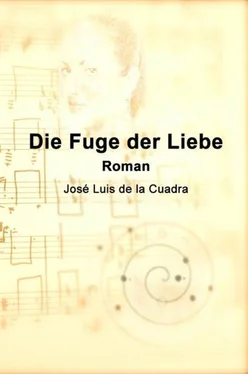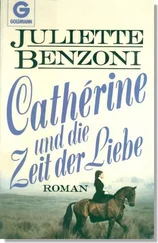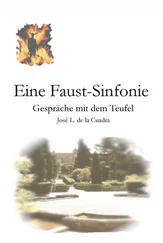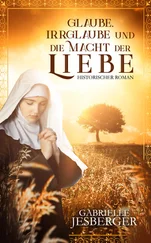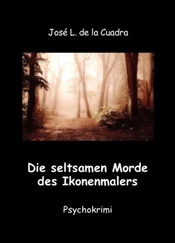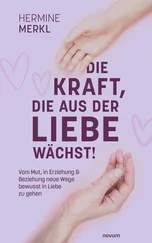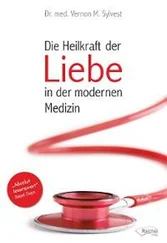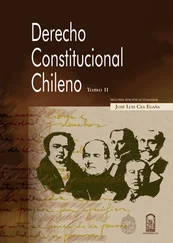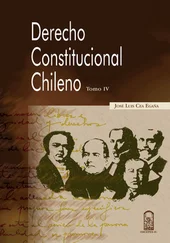„Mein Lieber, natürlich hast du in gewisser Weise Recht, dass das Krankheitsbild des Meisters schwierig einzuordnen ist. Aber auch ein manisch-depressives Zustandsbild kann wahnhafte Formen annehmen. Die Grenzen zum Wahn sind keinesfalls scharf. Ein Wahn kann in lichten Momenten durchaus als Irreführung erkannt werden. Ein Musiker verfügt über eine Empfindungsgabe, die - entschuldige die Anmassung - weit über die Deine hinausgeht. Es erstaunt daher nicht, dass unser Patient seine Sinnestäuschungen in luziden Momenten als solche erkennt und klangliche Halluzinationen als schöpferisch empfindet. Es könnte auch sein, dass er seine Musik innerlich hört, bevor er sie niederschreibt. In diesem Fall wären es gar keine Halluzinationen.
Ich gebe zu, dass sein Geisteszustand in keines der uns bekannten Krankheitsschemen passt. Allerdings wissen wir, dass Genialität und Geisteskrankheit nicht immer klar voneinander getrennt werden können. Was wäre die Welt ohne Wahnsinn? Ich meine, sie wäre eine Einöde!“
„Du meinst also, unser Patient müsste in weitestem Sinne als normal gelten?“
„Nun, was heisst hier normal? Bist du normal? Bin ich normal? Ist ein Komponist, der nahezu Uebermenschliches leistet, normal? Nach meiner jahrelangen Erfahrung mit Geisteskrankheiten und sogenanntem Irresein bin ich zur Ueberzeugung gelangt, dass es keine strikte Grenze zur Normalität gibt. Viel mehr kann sich diese Grenze mit zunehmender Schöpfungskraft und Genialität eines Menschen sogar auflösen.“
„Und weshalb - gestatte die ketzerische Frage - befindet sich dieser geniale Mensch überhaupt in unserer Klinik, der Anstalt für Geisteskrankheiten und Irresein?“
„Nun, mich beunruhigt etwas ganz Anderes: es sind die über Jahre zunehmenden Erscheinungen wie körperlicher Zerfall, Schwindelzustände, Schwerfälligkeit der Sprache, Schüttelanfälle und innere Unruhe mit unkontrolliertem Bewegungsmuster. Auch die Veränderungen der Persönlichkeit mit den bis zur Aggressivität führenden Erregtheitszuständen machen mir Sorgen.
Es ist, wie wenn sich hier eine Krankheit über die andere schieben würde. Es wird unsere Aufgabe sein, sehr differenziert nach den Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten zu suchen. Ich möchte Dich bitten, täglich Buch zu führen über Bewusstheitszustand, Temperatur, Puls und Beschaffenheit der Exkremente. Lass dem Patienten grösstmögliche Freiheit bezüglich Bewegung, musikalischem Schaffen und Ernährung. Lass ihn aber für längere Spaziergänge, vor allem ausserhalb des Klinikgeländes, von einem Wärter begleiten. Direkte Familienkontakte müssen vermieden werden. Zwischen den Eheleuten könnten erneut Konflikte ausbrechen. Du kennst die Ueberforderung der Gattin in letzter Zeit. Sie beansprucht Zeit für ihre eigene Karriere. Der Meister muss absolute Ruhe haben und von jeglicher Aufregung abgeschirmt sein. Und fast hätte ich es vergessen: beobachte peinlichst genau seine Pupillen auf ihre Grösse und auf Unregelmässigkeiten der Form!“
„Ich nehme an, dass du einverstanden bist, wenn ich zur Reinigung der Körpersäfte wirksame Abführmittel wie Bitterholz und Kolombowurzel verabreiche. Bei Tobsuchtsanfällen gedenke ich, Brechwurzeltee einzusetzen. Zur Ableitung der inneren, fehlgeleiteten Strömungen schiene mir das Anlegen einer künstlichen Eiterwunde, einer Fontanelle, nützlich.“
„Du hast mein vollstes Vertrauen. Ich schlage vor, dass wir uns wöchentlich zu einer Besprechung treffen. Und noch etwas: Anfragen seiner Ehefrau bezüglich des Gesundheitszustandes ihres Gatten solltest du nur nach Rücksprache mit mir beantworten. Sie ist begreiflicherweise sehr besorgt und es ist ihr peinlich, dass der geniale Musiker an einem so hässlichen Leiden erkrankt ist. Sie fürchtet um seinen - und wie mir scheint auch um ihren Ruf. Sie will sogar seine letzte Komposition, deren Thema er als von einem Engel eingegeben glaubt, unter Verschluss halten. Es ist verständlich, dass sie sein kompositorisches Werk durch sein Leiden beeinträchtigt sieht.“
„Alles klar. Nur noch ein Letztes: wir sollten im Aufnahmebuch eine vorläufige Diagnose vermerken.“
„Schreib: Melancholie mit Wahn. Auch wenn ich da meine Zweifel habe.“
Der Wärter Johannes steht an der Schwelle zum Gesellschaftszimmer und lauscht den Klängen, die vom Flügel her die Anstalt durchfluten. Schon stundenlang sitzt der Meister am Klavier und bearbeitet die Klaviatur in beängstigender Art und Weise. Noch nie hat der Pfleger Derartiges gehört. Sanfte und leise Töne, schwingende Melodien, dann abrupte und gewaltige Ausbrüche, dissonante Akkorde in gegenläufigen Skalen. Dabei scheint die gebückte Gestalt das Instrument überwältigen zu wollen. Bedrohlich kracht es in der Klavierbank und Johannes befürchtet, der Musiker könnte das Gleichgewicht verlieren und zu Boden stürzen. Die Szene gleicht einem Kampf gegen Titanen.
Wilde Schreie durchschneiden die Harmonien. Ungepflegte Haare wirbeln durch die Luft und Schweisstropfen besprinkeln die Tasten. Eine unangenehme Ausdünstung breitet sich aus. Dazwischen greift der Meister in ausfahrenden Bewegungen zur Feder und kritzelt Zeichen in die Notenblätter, die ihm seine Gattin zugesandt hat. Der Wächter macht sich Sorgen. Sein Patient hat heute weder gegessen noch getrunken. Den Tee hat er als vergiftet bezeichnet und das Glas zu Boden geworfen.
Nach unverständlichen Selbstgesprächen und stereotypem Wippen des Oberkörpers ist er heute Morgen plötzlich von seinem Bett aufgestanden und ins Gesellschaftszimmer gestürzt. Dort hat er sich an das Instrument gesetzt und vornüber gebeugt geweint. Mehrmals sind seine kräftigen Finger über die Tasten geglitten, ohne sie zu berühren, um dann in verzweifelter Gestik in den Schoss zurückzufallen. Erst nach mehreren Weinkrämpfen hat sich der Künstler beruhigt. Dann, nach einem unverständlichen Wortschwall, dieser deutlich artikulierte Satz:
„Oh himmlische Engel, leitet meine Kraft in dieses Werk“!
Und seit diesem Moment hat der Komponist das Instrument ohne Unterbruch bearbeitet und die Irrenanstalt in Schwingung versetzt.
Mit einem Satz stürzt Johannes nach vorne und kann den rhythmisch krampfenden und wild um sich schlagenden Musiker gerade noch auffangen. Der Wächter ist stark. Er kann den Patienten mit seinen Armen umschlingen und ihn sanft zu Boden legen. Dort hält er ihn fest, damit er sich nicht verletzt, bis der Mann in einen tiefen Schlaf fällt. Er hebt ihn auf und trägt ihn liebevoll ins Bett. Johannes hat Tränen in den Augen und holt sich einen Stuhl. Dort wacht er bis sein Patient die Augen aufschlägt. Er holt ein Glas Tee und setzt es dem Meister an die Lippen. Diesmal trinkt er. Auf seinem Gesicht breitet sich ein Lächeln aus. Johannes lächelt auch.
Zug Basel-Berlin, Zwickau (Robert Schumann Haus), 7. und 8. Juni 2010
Ich hatte mir eine dreiwöchige Auszeit genommen. Nach Beendigung meines Medizinstudiums war ich ausgelaugt und ausserstande, ohne Unterbruch meine berufliche Karriere fortzusetzen. Ich wollte nochmals zurück nach Berlin. Dort hatte mir damals Professor Siegfried Gottesmann wichtige Impulse gegeben. Er hatte mir in seinen Kursen der Berufs- Klavierklasse beigebracht, wie man die Kraft eines einfachen Tastentones ins tiefste Innere des eigenen Wesens überträgt. Trotzdem hatte ich damals entschieden, meinen Berufsweg zu ändern und mich der Medizin zuzuwenden.
Die Musik schien sich in letzter Zeit wieder vermehrt in mein Leben zu drängen. Und so diente meine Reise nach Berlin einer eigentlichen Reinigung meines Gemützustandes.
Ich hatte bewusst darauf verzichtet, das Flugzeug zu nehmen und wollte mich während der Zugreise in Ruhe auf den Aufenthalt in dieser sich stark wandelnden Stadt vorbereiten. Berlin war damals das Gefäss für meine jugendliche Sturm- und Drangzeit gewesen und ich war neugierig darauf, wie die Stadt mich empfangen, welche Gefühle sie in mir auslösen würde, nachdem ich sie vor sieben Jahren Hals über Kopf verlassen hatte. In der Zwischenzeit hatten sich die Emotionen beruhigt. Mein Interesse galt während der Ausbildung zum Arzt mehr den mentalen als den organischen Aspekten der Medizin. Mehrere Monate hatte ich in psychiatrischen Kliniken zugebracht.
Читать дальше