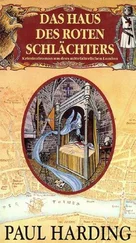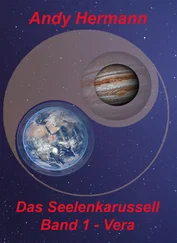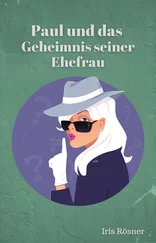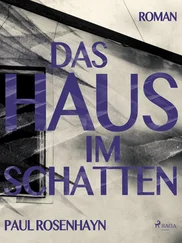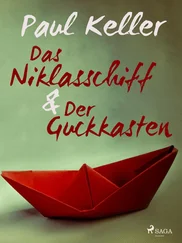So beuteten die USA den Rest der Welt aus. Es war Kolonialismus und letztlich auch Imperialismus pur, mit viel größeren Ausmaßen, als bei den Beutezügen der Spanier in Südamerika oder des Britischen Empire in Indien. Nur, dass der Raub hier über elektronische Verbindungen und undurchsichtige Finanzinstrumente im Verborgenen zustande kam und nicht in offen praktizierten feindlichen Handlungen, wie bei den christlichen Eroberern. Zwar würden die Amerikaner ihre Schulden, welche sich bei den Exportnationen in Form riesiger Handelsbilanzdefizite anhäuften, vollständig wieder zurückzahlen. Nur würden das dann Dollars sein, die nicht mehr den ursprünglichen Wert besaßen. Der altbekannte Trick hieß Inflation. Das fehlende Geld würde einfach nachgedruckt werden.
Man haute sich also gegenseitig übers Ohr und spielte Katz und Maus. Der eine gab dem anderen sein Spielgeld, damit dieser sich reich und mächtig fühle. Der andere gab dem einen dafür billiges Spielzeug oder gute Autos, damit der seinen Spaß haben sollte. Wenn nun der fleißige Produzent sein gespartes Spielgeld eintauschen wollte, bekam er nichts mehr dafür, aber der andere hatte seinen Spaß gehabt.
Deshalb tobte hinter den Kulissen ein geheimer Krieg; denn keiner hatte etwas zu verschenken. Wenn du versuchst, mich für dich arbeiten zu lassen, dann ist es nur recht und billig, wenn ich dir deine Ideen klaue. Damit kann ich mir dann wieder zurückholen, was du mir schuldest. In dieser Auseinandersetzung ging es um die wichtigste Ressource der Menschheit, es ging um das Wissen über neue Technologien. Dieser Krieg kannte keine Fronten, aber er benötigte Soldaten. Bald würde K. einer davon sein. Die Tentakel des Myzels hatten ihn geortet und begannen, ihn zu umranken.
„Bei so viel alter Autoprominenz brauchen sie eigentlich einen eigenen Mechaniker“, sagte K. zu Bockhold.
„Habe ich auch. Das managed mein alter Freund Simon für mich. Der hat finanziell ausgesorgt und besitzt noch mehr Autos, als ich. Unter anderem nennt er einen Original-Porsche-Spyder sein Eigen. Er treibt sich nur noch auf Märkten rum, wo Ersatzteile für die alten Schlitten gehandelt werden.“
Einige Tage später sollte K. auch diesen Simon kennen lernen. Es war ein langer dünner etwas linkischer Typ. Bockhold und er unterhielten sich wie zwei plappernde pubertierende Mädchen, als es um Vintage, also moderne Antiquitäten ging. K. bekam mit, dass die beiden nicht nur alte Autos sammelten, sondern jeder mehrere Exemplare unterschiedlicher Ausgaben der alten 08-Parabellum-Pistole im Schließfach hatte. Auch tauschten sie Auktionskataloge aus, in denen ausschließlich alte Nikons angepriesen wurden.
Interessante und teure Sammelleidenschaften haben die, typische technische Männerhobbies mit dem Mythos der Geheimdienste, dachte sich K., wahrscheinlich haben die zu viel Spionageromane gelesen. Darüber geht nur noch das Sammeln von Panzern und Flugzeugen. Tatsächlich interessierte sich Bockhold auch intensiv für die Anfänge des Raketenzeitalters in Peenemünde. Er hatte alles an Literatur zusammengetragen, was er dazu kriegen konnte. Irgendetwas Geheimnisvolles umwehte diesen Mann.
Die Tage und Wochen waren für K. angefüllt mit zahlreichen Meetings und Diskussionen über Verteidigungsstrategien bei den Gerichtsverfahren, in denen asbestbedingte Gesundheitsschäden verhandelt wurden. Es ging um die Schuldfrage, inwieweit das Inverkehrbringen asbesthaltiger Produkte bei den Anwendern zu Lungenerkrankungen geführt hatte und in welchem Umfang die daran beteiligten Firmen dafür nicht nur haftbar, sondern auch zu bestrafen seien. Insbesondere dieses Punic Damage trieb die Schadenersatz- und Strafzahlungen in Schwindel erregende Höhen.
Die Strategie war schlicht aber aufwendig: Wir machen uns bei den Klägern denkbar unbeliebt, indem wir wissenschaftlich-fachlich und argumentativ so fit werden, dass die Klägerseite davon rennt, wenn sie nur unseren Namen hört.
Anfänglich bereitete K. das intellektuelle Amerikanisch seiner Gesprächspartner, die ausnahmslos in Harvard oder Yale studiert hatten, gewisse Probleme. Sie verwendeten eine Idiomatik, die er vorher so noch nie gehört hatte. Erstaunt war er über das Easy Going in der Kanzlei. Hier wirkte keiner überarbeitet, alle waren relaxed. Eine solche Arbeitsatmosphäre bekommt man nur hin, wenn man zahlungskräftige Mandanten hat. Zermürbend für K. waren die stundenlangen Diskussionen zu Punkten, die er schon längst erledigt wähnte. Er war immer davon ausgegangen, dass Amerikaner rasch entscheiden. Das Gegenteil war der Fall.
Im großen Holzhaus Bockholds am Strand roch es moderig. Es war kein sehr aufdringlicher Geruch, zumal man ihn nach längerem Aufenthalt im Haus nicht mehr wahrnahm. Wie eine Dauerinfektion schleppte man aber diese dünne morbide Fahne in den Klamotten nach außen. Der Geruch begleitete einen dann den ganzen Tag und Leute, die einem zu nahe kamen, mussten meinen, dass man sein Zuhause im schimmeligen feuchten Keller habe.
Immer wenn Bockhold das Haus zusammen mit K. betrat, sog Bockhold die Luft tief ein und sagte ohne nähere Erklärungen abzugeben: „Das kommt von den alten Büchern.“ Das wirkte wie eine Autosuggestionsformel: Ich muss nur die Bücher entfernen, damit der Modergeruch weg ist. Aber warum räumte er die Bücher dann nicht einfach weg, fragte sich K. Einerseits diese Irrationalität und andererseits eine tiefgehende Beschäftigung mit wissenschaftlichen Fragestellungen. Das passte nicht zusammen. Diese Ambivalenz trat auch in seiner unverhohlen zur Schau gestellten Begeisterung für Deutschland und der gleichzeitigen Beschäftigung in einer jüdischen Anwaltskanzlei zu Tage.
Da musste es noch etwas Übergeordnetes geben, etwas, das wichtiger für ihn war, als die Autofirma, sein New York, die Kanzlei, seine Oldtimer und sein Haus, etwas, das sein Verhalten und seine Entscheidungen vor allem anderen dominierte. Vielleicht war Bockhold Mitglied in einem rechtsextremistischen Geheimbund. Überschießende nationale Gesinnungen waren ja in Amerika nichts Außergewöhnliches. K. war mit seinen ausschweifenden Fantasien zur Hintergrundanamnese Bockholds näher an der Wahrheit dran, als er es damals für möglich gehalten hätte.
Auf Einladung Bockholds landeten beide in einem Restaurant in Long Branch, welches deswegen jeden Abend so voll war, weil leidlich schmackhaftes Essen kredenzt wurde und weil die Showeinlagen der Köche die Herzen der Amerikaner höher schlagen ließen. Bockhold hatte offensichtlich den Status eines Stammgastes, denn der Schlitzäugige hinter dem Kochtresen streckte ihm zur Begrüßung die Hand entgegen.
Es war für K. nicht eindeutig auszumachen, ob das jetzt ein chinesisches, ein japanisches oder ein vietnamesisches Lokal war. Jedenfalls standen hinter Garplatten, die mehrere Quadratmeter groß waren, asiatische Köche mit hohen weißen Kochmützen. Rings um die Kochstelle gruppiert konnten die Gäste den Aktionen des Meisters beiwohnen. Bevor der die Shrimps, Rinderfiletstreifen oder das klein geschnittene Gemüse auf die heiße Platte gleiten ließ, zog er eine alberne Show mit Messern und anderen Kochutensilien ab. Die Teile flogen erst in der Luft herum und landeten dann auf seiner Mütze oder wurden von ihm mit der Hand im Rücken gefangen. Dazu erzeugte der Koch mit diversen Besteckteilen laute Klappergeräusche. Die Gäste waren begeistert.
Alkoholhaltige Getränke wurden in diesem Lokal nicht ausgeschenkt. Man brachte sich die Spirituosen selber mit. Bockhold hatte eine Weinflasche in einer braunen Packpapiertüte dabei. Er reichte die Tüte an den Schlitzäugigen. Der sollte die Flasche entkorken.
Alle zehn Minuten ertönte eine Fanfare. Schon wieder hatte einer der Gäste Geburtstag und schon wieder gab es eine mit funkensprühenden Wunderkerzen bestückte Torte, die aufs Haus ging. Es schien so, als wenn alle Einwohner von Long Branch ihren Geburtstag hier und heute feiern würden.
Читать дальше