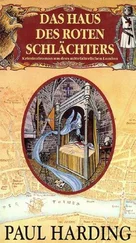Der Lohn für die mühsame Arbeit war immateriell. Häufig war es der Doktortitel. K. tat jetzt nichts anderes, als das, was viele Jahre zurück seine Doktoranden gemacht hatten. Der kleine, aber wesentliche Unterschied bestand darin, dass er zu den Tagessätzen eines wissenschaftlichen Beraters und nicht wie die Studenten umsonst arbeitete. Das respektable Salär sah K. überwiegend als Schmerzensgeld an. Sicherlich war es ein Almosen im Vergleich zu den Beträgen, die der Anwalt kassierte. Für K. war es aber nach seinem beruflichen Crash gutes Geld. Und er konnte hier unbeobachtet arbeiten. Keiner wusste, wo er war - meinte er.
Da war er nun also gelandet, jenseits einer applaudierenden Öffentlichkeit, befasst mit einer mühsamen kleinteiligen Kopfarbeit, deren Erfolg nicht er, sondern andere ernten würden. Er kam sich vor wie der Bergwerksdirektor, der sich auf einmal ohnmächtig allein unter Tage wieder findet und den Flözen nur mit Hammer und Pickel bewaffnet an den Leib zu gehen hat.
Bei der ersten groben Durchsicht der Akten erkannte K. recht schnell, dass Grosser chaotisch gesammelt hatte. Die Themen wechselten in der Reihenfolge der Ordner, aber auch innerhalb der Ordner. Viele Schriftstücke erschienen doppelt. Es hatte den Anschein, als wenn der Sammler teilweise den Überblick über seinen eigenen Bestand verloren hatte, was bei diesem Umfang nicht verwunderlich war.
K. empfand von Tag zu Tag immer etwas mehr heimelige Gefühle in der kargen Umgebung. Es traten nostalgische Stimmungen auf, wenn die Sonnenstrahlen über die trüben Oberlichter in unterschiedlichen Winkeln zwischen die Regale hereinbrachen und im Papierstaub wandernde Lichttrapeze formten. Das hatte etwas Museales. Das alte Institut, die früheren Kollegen und der Übervater Litwin lebten in K.s Erinnerungen wieder auf.
Während er ein dickes Lehrbuch über Mineralogie durchblätterte, fiel ein Bild heraus, welches offensichtlich als Lesezeichen fungiert hatte. Er bückte sich und hob es auf. Es zeigte vier Personen vor dem Eingang eines dunklen Holzhauses. Hinter dem Haus lag dichter Wald. Über der Türe sah man ein großes Hirschgeweih. Es musste Grossers Jagdhaus in der Oberpfalz sein. In die Kamera lächelten rechts außen das stolze Familienoberhaupt und links außen seine indonesische Frau. Aus Java stammte sie, so erinnerte sich K. Zwischen Vater und Mutter standen die beiden Buben, der eine war einen halben Kopf größer als der andere. Beide hatten Lederhosen an.
Er drehte das Bild um, er wollte nachschauen, ob ein Herstellungsdatum auf der Rückseite vorhanden war. 13.08.2003 las er. Aber es stand noch etwas anderes da. Dabei handelte es sich um eine Internetadresse der Firma Delphi mit einem ewig langen Suffix, einer Identifikationsnummer und mehrere Buchstaben-Zahlen-Kombinationen, welche offensichtlich Codes darstellten.
K. hielt den Schlüssel zum größten Geheimnis der westlichen Welt in den Händen und wusste nichts davon.
Er steckte das Bild in seine Jackentasche, als Erinnerung an den verstorbenen Kollegen.
So wie die Familie sich auf dem Bild präsentierte, so waren tausende Familien auf Bildern verewigt worden. Die Abgründe hinter dem Familienglück blieben unsichtbar. Beide Söhne lachten. Der kleinere hatte sich eng an seine Mutter gedrückt. Was musste da passiert sein, dass so einer zur Waffe greift und die Eltern mir nichts dir nichts abknallt? Okay, Grosser taugte nicht als Vater zum lieb haben, sondern eher als Vorbild für einen zielgerichteten, schnörkellosen, und relativ freudlosen Lebensentwurf. Er war Reserveoffizier gewesen, einer der furchtlos stets voran marschiert war. Seine Schultern hatte er immer zurückgezogen, so dass sich sein Brustkorb kräftig nach vorne wölbte. Hindernisse gab es für so einen nicht. Selbst wenn sich vor ihm eine Betonwand aufgebaut hätte, dann wäre er mit seiner eisenhart angespannten Brustmuskulatur durch die Mauer hindurch marschiert. Diese Spannung übertrug sich auch auf seinen Arbeitsstil und die Gestaltung des Privaten, welches bei ihm fließend ins Geschäftliche überging.
Nach ihrer gemeinsamen Medizinalassistentenzeit im Landkrankenhaus in der Oberpfalz gingen die Wege Grossers und K.s auseinander, bis sich ihre Wege wenige Jahre später zum zweiten Mal kreuzten und zwar am Institut von Professor Litwin.
Aus dieser Zeit kannte K. Grosser nur arbeitend. Dabei war sein Interesse an der Abfassung von Gutachten, welche Zusatzeinnahmen versprachen, nur gering. Ein starker innerer Antrieb befahl ihm, sich in seine wissenschaftlichen Arbeiten hinein zu stürzen. Er produzierte Veröffentlichungen am Fließband. In einem Abstand von nur einem knappen Jahr promovierte er in den Ingenieurwissenschaften und in der Humanmedizin. Auf den regelmäßig statt findenden Partys des Instituts wurde er nie gesehen.
Seine akademische Karriere war wie ein Kampf gegen einen imaginären Gegner und der hieß soziales Abseits. Über die Mittlere Reife, ein Fachhochschulstudium und schließlich ein Hochschulstudium erwarb er den Berufsabschluss als Diplomingenieur. In seiner Zeit als wissenschaftlicher Assistent an einem Institut für Verbrennungskraftmaschinen fing er parallel mit dem Medizinstudium an, welches er in Rekordzeit beendete. Der Arztberuf war bei ihm keine Neigungswahl, nein, dieser Beruf versprach ein höheres Sozialprestige als die Ingenieurtätigkeit. Sozialer Aufstieg, das war das alles dominierende Grundprogramm.
Grosser hatte K. erzählt, dass er sich überall, wo er beruflich tätig gewesen war, eine Immobilie gekauft hätte, so auch in der Oberpfalz das Holzhaus mit dazu gehörender Jagd. Diese Häuser und Wohnungen sanierte er dann eigenhändig und wurde nie fertig. Deswegen wohnte er immer auf kleinen oder größeren Baustellen im Provisorium. Faulenzerei und Entspannung gab es nicht.
In diesem permanent aufgeladenen Aktivitätsfeld wuchsen die beiden Söhne auf. Womöglich erwartete er von den Kindern dieselbe Leidenschaft in der Askese. Da machten die aber nicht mit, da konnte Grosser seine Pektoralismuskulatur noch so anspannen, er lief ins Leere. Pubertierende Lümmel können schon arg pelzig und patzig sein. Also waren diverse Sanktionen unausweichlich: Beschneiden von Müßiggang versprechenden Handlungsspielräumen, Kürzung des Taschengeldes, Zeit- und Anwesenheitskontrollen und alles das, was ein hilfloser Familiendespot so an Folterwerkzeugen zur Verfügung hat.
So ähnlich war es wahrscheinlich gelaufen, wenngleich da einige ungeklärte Punkte und Merkwürdigkeiten im Raum stehen geblieben waren. Der Sohn hatte die Pistole des Vaters verwendet, welche dieser sechshundert Kilometer entfernt in einem abgeschlossenen Waffenschrank in seiner Jagdhütte aufbewahrte.
Drei Monate vor dem Mord war der Sohn das letzte Mal in der Hütte gewesen. Man hatte dort seinen zwölften Geburtstag gefeiert. Dazu durfte er drei Freunde mitnehmen. Das Jagdrevier war wie ein großer Abenteuerspielplatz. Und dort gab es keine Computer oder Internetanbindungen, was ganz im Sinne des strengen Vaters war. Es war aber höchst unwahrscheinlich, dass der Sohn zu diesem Zeitpunkt die Waffe entwendet hatte. Denn der Vater ging regelmäßig alle vier Wochen in seinem Revier zur Jagd. Die Gefahr, dass ihm der Diebstahl auffallen würde, war daher groß.
Dass sich ein Zwölfjähriger von zu Hause heimlich wegstehlen kann, um die eine knappe Tagesreise entfernt deponierte Waffe zu entwenden, auch diese Möglichkeit schied weitgehend aus. Aber wie war er dann an die Pistole gekommen? Die Kriminalpolizei wusste keine andere Erklärung, als die, dass der Vater selber die Waffe von seinem letzten Jagdausflug mitgebracht haben musste. Hatte er sich bedroht gefühlt?
Der jüngere Sohn Patrick nahm sich jedenfalls die Pistole des Vaters. So stand es im Polizeibericht. Kurz vor dem gemeinsamen Abendessen, die Mutter hatte gerade den Tisch gedeckt und war auf dem Weg in die Küche. Da drückte er im Flur ab. Die Kugel traf seine Mutter direkt ins Herz. Sie sackte in sich zusammen. Ihr war nicht mehr zu helfen. Aber wieso erschoss er zuerst die Mutter, wo es doch um den Vater ging?
Читать дальше