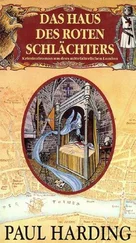K. war unruhig. Er fürchtete, dass auch noch ein Vertreter der örtlichen Zeitung auftauchen würde. Ihre Familie und sie galten als recht schaffende Glieder der katholischen Gemeinde, welche durch Gottesehrfurcht, Bescheidenheit und CSU-Mitgliedschaft ihre hehre Gesinnung unter Beweis stellten und im Örtchen bestens vernetzt waren.
Ausgerechnet jetzt war eine der Infusionsflaschen leer gelaufen. K. drückte sich als verantwortlicher Arzt – der Chefarzt hatte sich wie immer in solchen Situationen unauffindbar gemacht – in der hintersten dunklen Ecke des Krankenzimmers herum. Ihm fehlte einerseits der Mut sich zu entfernen, andererseits musste er jetzt all seine Courage zusammen nehmen, um nach vorne ins Kerzenlicht zu treten, damit er die leere gegen eine volle Infusionsflasche auswechseln konnte. Es war klar, dass es völlig gleichgültig sein würde, ob da noch etwas Flüssigkeit in diese arme Kreatur hineinlaufen würde oder nicht. Trotzdem musste er dafür sorgen, dass die Infusion weiter lief, weil es sonst natürlich geheißen hätte, dass die Unterbrechung der venösen Flüssigkeitszufuhr ihr endgültig den Garaus gemacht habe.
Also begab sich der junge Assistenzarzt K. mit der Flasche in der Hand zum Infusionsständer. Nur widerwillig teilte sich die Menschenmenge. Du bist schuld, dass dieses brave Menschenkind jetzt sein Leben aushauchen muss. Du hast die Pneumonie nicht rechtzeitig diagnostiziert. Sie war doch bei dir! Du hast sie abgehört und dann zu ihr gesagt: Ist nicht so schlimm, du hast einen schweren grippalen Infekt, geh nach Hause, leg dich hin und trinke viel. Und jetzt kommt dieser Exekutor und legt letzte Hand an.
Egal was er gemacht hätte, alles wäre falsch gewesen. Mehr als 10 Augenpaare beobachteten, wie er ungeschickt die Flaschen umstöpselte. Er vermied Augenkontakt und stolperte wieder zurück in die schützende Dunkelheit des hinteren Raumes. In der gespenstischen Szenerie hörte er das Gemurmel der im Bittgebet Versunkenen, die Perlen der Rosenkränze glitten durch die Finger der Gläubigen, manch einer bekreuzigte sich und K. wollte nur noch weg.
Der Einzige, der ihm Unterstützung gewährte, war Grosser, ein anderer blutiger Anfänger. Er hatte einige Monate nach K. auf der Station angefangen zu arbeiten. Seine Schicht war schon längst zu Ende gegangen. Trotzdem harrte er im Sterbezimmer mit aus.
Chefarzt Ebel blieb wie vom Erdboden verschluckt. Man kannte das bereits zur Genüge. Je prekärer die Situation, desto flüchtiger war Ebel. Neulich beim Herzstillstand einer Dreiundachtzigjährigen war er im Krankenzimmer zugegen gewesen. Da konnte er nicht abhauen. K. sah, wie er notgedrungen eine Herzdruckmassage startete und den typischen Fehler aller ungeübten Reanimateure beging. Er ließ die alte Frau im weichen Bett liegen. Die Druckstöße, ausgeführt mit seinem auf das Brustbein aufgesetzten Handballen komprimierten die Matratzenfedern aber nicht den Brustkorb der alten Dame. Vor lauter Hektik vergaß er die Mund-zu-Mund-Beatmung.
K. konnte das nicht mehr mit ansehen. Er schob den Chef zur Seite und zerrte die Patientin auf den harten Boden. Bei seinem ersten Bruststoß knackten einige Rippen, das zeigte den richtigen Kraftaufwand an.
„Ich drücke hier weiter und sie machen die Beatmung“, befahl er dem Chefarzt. Dieser schaute ihn verständnislos an.
„Nun los, machen sie schon“, keuchte K. Er täuschte körperliche Überanstrengung bei der Herz-Druck-Massage vor, um dem Chef ja keine Möglichkeit zum Entwischen zu geben. Dr. Ebel schaute angewidert auf die dünnen schrundigen Lippen der alten Dame, eine Schleimspur lief ihr aus dem rechten Mundwinkel, und wieder traf er die falsche Wahl. Anstatt ihr den Mund zuzuhalten und sie über die Nase zu beatmen, presste er seine Lippen auf die welke Mundpartie. K. beobachtete das mit klammheimlicher Freude, er hatte den angenehmeren Part.
K. sah, wie die Oberkieferzahnprothese der Dame verrutscht war. Er herrschte den Chef an: „Entfernen sie doch vorher die Zähne!“
Ebel griff mit spitzen Fingern in den Mundraum und fischte die Prothese raus. Daran hingen noch Reste des Spinats, den es zum Mittagessen gegeben hatte. Das ist nur eine kleine Strafe für dein permanentes Verpissen, dachte sich K.
Erst vor ein paar Tagen hatte Ebel K. wieder mal sitzen lassen. Mit dem Krankenwagen war eine junge Frau mit einem frischen Schlaganfall und ausgeprägten neurologischen Ausfällen eingeliefert worden. Es sprach alles für eine Massenblutung im Gehirn, wahrscheinlich aus einem geplatzten Aneurysma. Der Frau ging es zunehmend schlechter, sie war kaum noch ansprechbar. Hier wäre eine dringende neurochirurgische Intervention mit Öffnung des Schädels und Unterbinden der Blutung erforderlich gewesen. Doch einen solchen Eingriff beherrschte keiner im kleinen Landkrankenhaus. Die nächste neurochirurgische Abteilung war jedoch 60 Kilometer entfernt.
„Was sollen wir bloß tun?“, fragte K. den Chefarzt verzweifelt, „sie wird uns unter den Händen sterben.“
„Das glaube ich nicht, sie ist jetzt mit allem was uns zur Verfügung steht, versorgt worden. Wir lassen sie mit Blaulicht zum neurochirurgischen Kollegen bringen.“
„Aber das wird sie nicht überleben. Bis sie da unter das Messer kommt, vergehen noch mindestens drei Stunden.“
„Herr Kollege, ich empfehle die Verlegung.“ Ebel klang sehr bestimmt. „Wir können bei uns nichts mehr weiter tun. Der Krankenwagen ist schon da. Wenn sie die Formalien noch übernehmen könnten. Ich habe einen dringenden Termin.“ Sprachs und wart nicht mehr gesehen.
Mit einem äußerst unguten Gefühl übergab K. die Patientin den Sanitätern und empfahl, ordentlich Gas zu geben. Dann informierte er telefonisch den neurochirurgischen Kollegen, was da auf ihn zukommen würde. Nach knapp zwei Stunden rief ihn dieser zurück.
„Sagen sie mal, machen sie das immer so?“, fragte der Kollege am Telefon.
„Was meinen sie damit?“ K. ahnte, worauf der hinaus wollte.
„Na, dass sie Patienten zum Sterben im Sanka über Land fahren lassen?“
„Eigentlich ist das nicht mein Stil“, stotterte K., „aber Herr Chefarzt Ebel war der Meinung, dass sie gut versorgt sei und den Transport auch gut überstehen würde.“
„So, so, Chefarzt Ebel, na dann sagen sie dem Mann mal schöne Grüße. Ich habe den Verdacht, dass er die Sterbestatistik auf seiner Abteilung zu unseren Lasten anhübschen will. Das war ja nicht das erste Mal, dass ihr uns Leichen geliefert habt.“
Ohne, dass K. noch etwas sagen konnte - ihm wäre sowieso nur Stammelei über die Lippen gekommen - hatte der Kollege aufgelegt.
Dieser Mistkerl hat mich vorgeschickt, damit er selber bei diesen Tricksereien nicht direkt verantwortlich gemacht werden kann. Auf den Formularen für den Krankentransport steht meine Unterschrift und nicht seine, resümierte K. zornig.
Ebel hatte neben der Sterbestatistik noch eine weitere Statistik im Hinterkopf, wie im Übrigen fast alle Chefärzte zu dieser Zeit, und das war die Belegung seiner Krankenstationen. Der Klinikbau war von der Kommune finanziert worden. Die laufenden Kosten hingegen wurden über die Tagespauschalen, vorher mit den Krankenkassen vereinbarte feststehende Honorarsätze pro Liegetag, abgedeckt. Bei der Chefarztvisite galt Ebels Augenmerk weniger der Genesung seiner Patienten, als vielmehr deren Liegedauer. Unter zwei Wochen kam kaum einer davon, egal was für eine Gesundheitsstörung er hatte. Insbesondere ältere Herrschaften mit chronischen Erkrankungen am Rande der Pflegebedürftigkeit schätzten die Umsorgung und das gute Essen im Krankenhaus. Spezielle Diäten waren verpönt. Es sollte ja schmecken. Die Patienten sollten wiederkommen.
Auch die Angehörigen waren froh, wenn die quengelnde Oma mal wieder in die Klinik eingewiesen wurde und dort mehrere Wochen bleiben konnte. So wurde die Solidargemeinschaft der Versicherten schamlos ausgebeutet, für die Erhaltung überflüssiger Bettenkapazitäten und zum Wohle der nächsten Angehörigen. Das wirkte wie ein regionales Beschäftigungsprogramm für Ärzte und Pflegepersonal. Auch deswegen war Chefarzt Ebel ein angesehener Mann im Örtchen.
Читать дальше