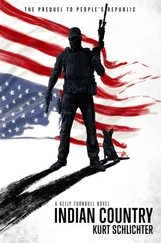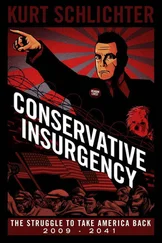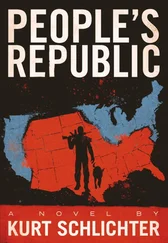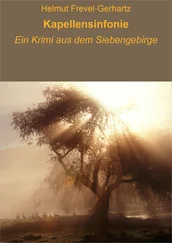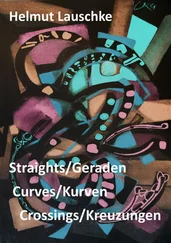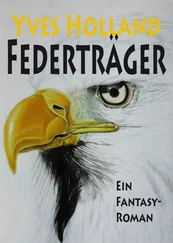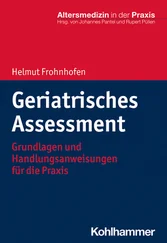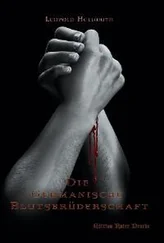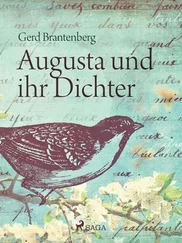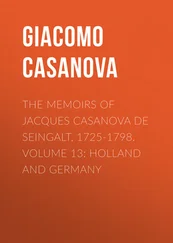Ich trat ein und musste mich zunächst an das Dämmerlicht gewöhnen. Der Raum erstreckte sich über das ganze Haus und bekam durch vier Fenster in den Dachgauben nur spärlich Tageslicht. Mitten in dem riesigen Raum, der auf mich wirkte wie ein gut aufgeräumtes Sperrmülllager oder eine vergessene Bibliothek, stand ein Schreibtisch, darauf ein Apple-Computer, eine Zigarren-Klimabox und das Bild einer attraktiven, jungen Frau. An der Wand hing ein gerahmtes Foto. Es zeigte eine Masse von Menschen, davon viele in Uniform, die die rechte Hand zum Hitlergruß erhoben hatten. Nur ein Mann stand da und hielt seine Arme verschränkt.
Heinrich Weinrich bemerkte, dass ich etwas ratlos auf das Foto schaute und begann, es zu erläutern: „Auf den Führer scheiß‘ ich, dachte der Arbeiter Landmesser im Jahre Neunzehnhundertneununddreißig. Er weigerte, sich den Führer zu grüßen, dafür musste er mit dem Leben büßen. Von ihm wäre nichts geblieben, hätte ich nicht über ihn geschrieben.“
Ganz kapiert hatte ich das nicht. Einige Tage später habe ich recherchiert, was es mit dem Foto auf sich hat. Im Frühjahr 1939 hielt Hitler in Hamburg bei der Werft Blohm + Voss die Taufrede beim Stapellauf des Schlachtschiffs „Bismarck“. Während alle Mitarbeiter den Führer mit dem deutschen Gruß ehrten, verschränkte der Arbeiter August Landmesser als Einziger auf dem Foto die Arme. Der Grund: Weil er ein jüdisches Mädchen liebte, war er wegen Rassenschande verurteilt worden.
„Wie geht es dir so?“, begann ich mit dieser unverbindlich-doofen Standardfrage das Gespräch, setzte dann hinzu: „Reimst du immer noch andauernd?“ Heinrich Weinrich lächelte mich undurchdringlich an, sodass mir nicht klar wurde, ob er mich auf den Arm nehmen wollte oder seinem Reimzwang folgte: „Ruhig Blut, mir geht es gut. Ich sitze über den Dächern der Stadt und fresse mich an miesen Texten satt. Korrigiere der Kollegen Orthografie und hüte die Worte wie der Bauer das Vieh. Nach wie vor ist mir das Reimen Lust, es erspart mir manchen Frust.“
„Mal ehrlich“, versuchte ich den kollegialen Frontalangriff, „kannst du nicht auch ganz normal wie wir alle reden und schreiben?“
Seine Antwort kam so schnell, wie andere ungereimt reden: „Normal, das ist mir zu pauschal. Klar kann ich reimlos reden und auch schreiben. Doch dann könnte ich mich selber nicht mehr leiden. Auch der Psychiater, bei dem ich auf Buddhas Wunsch zur Untersuchung war, schreibt in seinem Bericht ganz klar …“ Der schlichte Dichter fischte aus dem Sakko, das er über die Lehne seines Schreibtischsessels gehängt hatte, ein Stück Papier, auf dem ich als Briefkopf lesen konnte „Institut für Psychiatrie und Psychotherapie Charité Berlin“. Weinrich legte seine halb aufgerauchte Zigarre nahezu feierlich auf den Rand des Aschenbechers und zitierte betont langsam aus dem Brief des Arztes: „Herr Heinrich Weinrich hat kein gestörtes Ich. Auch das Über-Ich ist es nich. Weder sehe ich ein Krankheitsbild, noch führt der Patient Böses im Schild. Seine Lust an der Poesie benötigt keine Therapie. Er ist gesund wie ein junger Hund. Doch, dies sei eingeräumt, niemals zuvor hat ein Psychiater von Reimlust und Reimzwang auch nur geträumt. Ungelogen, dieser Fall ist eher ein Fall für Philologen.“
Triumphierend reichte mir der wohl doch nicht irre Reimer den Brief des Irrenarztes und lud mich am Abend zur Feier seines neuen Jobs auf ein „Bier wie ich dir“ in die Adlerklause ein.
Ich verabschiedete mich mit einem Reim: „Zwischen Leber und Pils passt immer noch ein Pils“, und fragte mich, während ich die steile Treppe herunterstieg, ob Reimzwang ansteckend sein könnte. Oder wollte der Psychiater seinen Patienten und den Auftrag gebenden Chefredakteur verarschen mit seiner gereimten Diagnose? Die ging wohl in die Hose.
Als Sportredakteur fühlte ich mich dazu verpflichtet, Vorbild zu sein. Deshalb ignorierte ich wie üblich den Aufzug. Ich lief durchs Treppenhaus und stellte mir vor, wie Heinrich Weinrich, durchaus bekannt für seinen herben Charme, mit seinem Reimtick bei der Kanzlerin ankommen würde, wenn er sie jemals wieder interviewen dürfte. Was geschieht wohl, wenn er ein Gespräch eröffnet mit der Frage: „Frau Merkel, wer im Kabinett ist das größte Ferkel?“ Oder wenn er über den Papst schriebe: „Ob Benedikt noch richtig tickt?“
Zu Löw fiel mir kein Reim ein.
Lustlos setzte ich mich an meinen Schreibtisch. Die Pflicht rief und ich traute mich nicht, wegzuhören. Heute war der Vorbericht zum Spiel am Samstag fällig. Er musste wie üblich eine Gratwanderung werden. Zum einen wäre es wider die Ehre, wollte ich meinen Fußballverstand leugnen, zum anderen konnte ich mit Rücksicht auf unsere verbliebenen Fans nicht meine wahre Meinung veröffentlichen, dass wir nämlich gegen den FC Bayern keine Chance und in der Ersten Bundesliga nichts mehr zu suchen hatten. Vielleicht könnte ich mit dem Bonmot anfangen oder enden: „Wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist“. Während ich googelte, welcher kluge Mensch das mal gesagt hatte, meldete sich mein Handy mit der Titelmelodie aus „Titanic“, die mir meine liebe Freundin ausgesucht hatte.
Es war Thilo. Der hatte mir gerade noch gefehlt. Wir hatten uns auf der Journalistenakademie kennengelernt. Ich konnte ihn nie besonders leiden, doch hatte er mir durchaus imponiert. Ich nahm mein Studium ernst, schließlich mussten sich meine Eltern für die Studiengebühren krummlegen. Thilo hatte, obwohl ziemlich talentlos für alles, was mit Schreiben zu tun hatte, irgendwie ein Stipendium ergattert und lebte ziemlich sorglos in den Tag hinein. Nach einem Jahr schmiss er die Ausbildung, ging als Produktions- assistent zu einem obskuren Privatsender. Zwei Jahre später besaß er eine eigene TV-Produktionsfirma, einen nagelneuen Porsche sowie eine nicht mehr ganz frische Lebensgefährtin mit viel Silikon in den Brüsten und langer Fernsehpräsenz in unterschiedlichen Formaten.
Thilo war, wie er sich bei seinen gelegentlichen Besuchen bei mir gerne selber rühmte ein „master of connections“, das sei in seiner Branche der „Kopfnutten“ besser als zweimal summa cum laude promoviert zu haben. Was ich ihm gerne glaubte.
Seit gut einem Jahr produzierte Thilo eine Talkshow für einen Privatsender und war ständig auf der Suche nach Gästen, die ihn wenig kosteten. Unterhaltsam mussten sie sein, sich von der Silikon-Frau auch sehr privat befragen lassen und Quote machen. Ich habe ihm zwei- oder dreimal einen Tipp gegeben, wenn mir in unserer eher biederen Stadt mal jemand geeignet schien für seine Show.
Ob ich Zeit für einen Café olé olé habe, fragte mich Thilo. Da mein windelweicher Vorbericht mir schwer im Magen lag, sagte ich zu, aber nur auf die Schnelle in der zum „Bistro“ aufgehübschten Kantine.
Ich setzte mich ans Fenster. Bevor ich Thilo sah, hörte ich seinen Porsche röhren, den er im absoluten Halteverbot parkte. Von irgendeiner fernen Sonne gebräunt, betrat, ach was: stolzierte Thilo ins „Bistro“, knallte seinen Wagenschlüssel auf den Tisch, setzte sich mir gegenüber, das Fenster im Rücken, und röhrte, ohne mich begrüßt oder gefragt zu haben, durch den Raum „zwei Café olé olé.“
Ich beeilte mich, ihm mitzuteilen, dass hier Selbstbedienung angesagt sei, als die Kassiererin den lauten Gast anlächelte und sagte: „Kommt sofort.“ Mir war entfallen, dass Thilo bei unserem letzten Treffen seinen Kaffee mit einem Zwanzigeuroschein und einem „Stimmt so!“ bezahlt hatte. Er grinste mich an: „Für mich ist Selbstbedienung hier abgeschafft.“
Am liebsten hätte ich ihm die großspurige Fresse poliert. Stattdessen beobachtete ich voller geheimer Schadenfreude durchs Fenster, wie eine Mitarbeiterin des Ordnungsamtes das Kennzeichen von Thilos Porsche im Halteverbot notierte.
Читать дальше