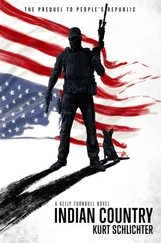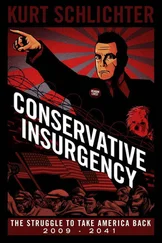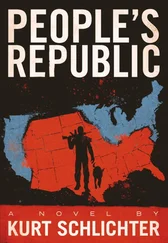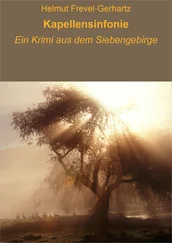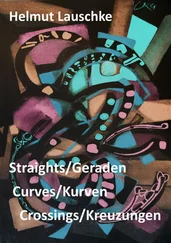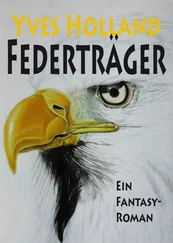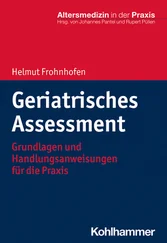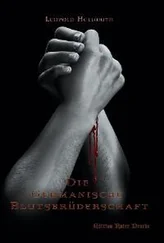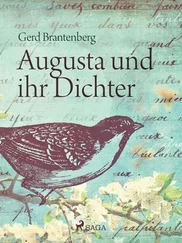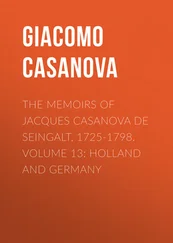Kaum hatten wir bei Luigi, der aus Pakistan stammte, aber um der „Roma“-Reputation willen vom kalabrischen Patron einen italienischen Vornamen erhalten hatte, bestellt, wurde Lene ernst. „Sag mal, Sven, bist du sicher, dass Buddha die Wahrheit gesagt und er dem Heini den Arsch gerettet hat?“
„Hm“, zögerte ich mit der Antwort, „ich bin mir da nicht so sicher, aber vielleicht doch. Die beiden haben hier ja gleichzeitig angefangen, und von Buddha habe ich in all den Jahren kein böses Wort über Heini gehört.“
„Also, was ich dir jetzt sage, ist absolut entre nous“, – diese Formulierung liebte Lene – „nur Heini kannst du es sagen, solltest du sogar, damit er weiß, woran er ist. Ihr beiden seid doch befreundet. Oder irre ich mich da?“ – „Na, da bin ich mir nicht so sicher“, dachte ich laut nach, „so’n Zwischending zwischen guten Kollegen und Freunden. Wir sind ein paarmal zusammen beim Fußball gewesen; er hat gelegentlich, wenn er mal in der Redaktion war und nicht irgendwo in der weiten Welt, meine Texte verbessert, ohne dass er sich damit Kollegen gegenüber gebrüstet hätte. In seiner Stammkneipe, der ‚Adlerklause‘ am Alten Markt, haben wir auch schon mal zusammen ein Bier getrunken. Ich glaube übrigens, Heini und die Wirtin, also da ist mehr.“
„Weiß ich doch, ist ja auch ein attraktiver Kerl, der Heini, einer, bei dem sich Frauen wohlfühlen, nicht nur weil er so etwas Bäriges hat. Er kann Menschen und speziell Frauen gut unterhalten und zum Lachen bringen, jedenfalls langweilt man sich nicht bei ihm“, schwärmte Lene.
Ich guckte sie neugierig an. „Nein, nicht was du nun wieder denkst. Heini und ich, wir waren immer nur gute Kumpel. Ach du Scheiße“, unterbrach sie sich, „jetzt habe ich schon ‚waren‘ gesagt. Wir sind gute Kumpel und wollen es bleiben, auch wenn er nun nicht mehr Chefreporter ist, Heini, der Reimer. Ich fass’ es nicht.“
„Aber was wolltest du mir denn Geheimnisvolles anvertrauen, so ganz entre nous?“, lächelte ich sie verschwörerisch an.
Da der pakistanische Luigi gerade den Teller mit der üppigen Portion Spaghetti auf den Tisch gestellt hatte, wickelte Lene eine mundgerechte Portion um die Gabel. Ohne einen Löffel zu benutzen, stopfte sie sich die Teigwaren in den Mund, kaute genüsslich und schaute mich mit ihren grünen Augen an.
„Buddha wollte Heini loswerden, rausschmeißen. Ich weiß das deshalb, weil sie mir das selbst gesagt hat. Ganz konsterniert war die Verlegerin. Ich war nämlich gestern zur Vertretung im Chefsekretariat, weil Madame“ – so nannten wir wegen ihres vornehmen Getues die eigentliche Assistentin der Verlagsinhaberin – „ihre Tage hatte oder nicht kacken konnte oder warum auch immer. Und Buddha war beim Vieraugengespräch mit der Chefin. Und als der raus war, musste ich sie mit dem Justiziar verbinden. Und als das Gespräch beendet war, kam sie raus und war ganz bleich, wollte einen Cognac haben, obwohl sie doch sonst nie Alkohol trinkt. Und dann ist es ihr nur so rausgeplatzt. ‚Wie kann man sich in einem Menschen so täuschen‘, hat sie gesagt, ‚da denkt man, der Herr Chefredakteur und unser allseits hochgeschätzter Chefreporter seien ein kollegiales Team, dass sie einander sogar mögen, und dann so etwas. Da will er die Existenz eines Menschen vernichten, zumindest die berufliche, nur weil der so eine Art Reimzwang hat. Aber nicht mit mir. Ich rede ja grundsätzlich nicht in die Redaktion hinein, aber diesmal habe ich es getan. Heinrich Weinrich bleibt.‘ Ja, das hat sie gesagt, die Chefin, und dafür hätte ich sie am liebsten geküsst.“
Mir fiel nach dieser Offenbarung nichts anderes ein als zu fragen: „Warum hast du es nicht getan? Es heißt doch, sie stehe auf Frauen“ – „Ich aber nicht“, stellte Lene genussvoll kauend fest.
Was Lene mir zum Weitererzählen anvertraut hatte, das hatte mich ziemlich erstaunt. Es war tatsächlich höchst ungewöhnlich, dass die Verlegerin, die sich selbst niemals so nannte, sondern Mehrheitsgesellschafterin, eine Entscheidung des Chefredakteurs missbilligte und sogar widerrief. Zumal, wenn dies Geld kostete, ihr Geld.
Ich war ihr ein paar Mal begegnet, meist auf Reitturnieren. Früher, als junge Frau, war sie, wie ich in Archiven überregionaler Blätter recherchiert hatte, eine talentierte Amazone und wäre beinahe in die Nationalmannschaft der Dressurreiterinnen gekommen. Wenn wir uns trafen, war ich immer bemüht, meine mangelnden Reitsportkenntnisse zu kaschieren. Ich bin nun mal ein Fußballmensch. Obwohl sie merken musste, dass ich von ihrer Leidenschaft bestenfalls Wikipedia-Wissen hatte, war sie gleichbleibend freundlich, kühl-freundlich.
Einmal, als ich erst kurz bei ihrer Zeitung angestellt war, ihre Marotten noch nicht kannte und sie mit „Ah, meine Verlegerin“ linkisch begrüßt hatte, wies sie mich höflich zurecht: „Lassen Sie das. Verlegerin, das macht mich ganz verlegen. Ich verlege höchstens meine Brille.“
„Ja, aber …“, widersprach ich. „Kein aber. Mein Vater, der war Verleger mit Leib und Seele. Mein Bruder wäre es geworden, ganz sicher, wenn er …“ Der Satz verhungerte unvollendet. Sie fuhr fort: „Ich bin nur die Erbin, die Verwalterin eines gelegentlich bedrückenden Nachlasses. Aber lassen wir das. Schauen Sie sich lieber die elegante Gangart dieser Schimmelstute an.“ Ich gehorchte.
Nach diesem Gespräch mit der verlegenen Verlegerin fragte ich am nächsten Tag Heinrich Weinrich, der gerade von einer Reportage über das Albert-Schweitzer-Hospital in Gabun zurückgekehrt war, ob er mich über die Geschichte der Zeitung und der Verlegerfamilie aufklären könne. „Klar, mache ich gerne und sofort“, grinste der Chefreporter, der zu jener Zeit noch ganz normal und reimlos sprach, „ich suche nämlich gerade nach dem besten Einstieg in die Lambarene-Story, und weil mir bisher keiner eingefallen ist, bin ich für jede Ablenkung dankbar.“ Er fingerte aus einem auf dem Schreibtisch stehenden Humidor eine mittelgroße Zigarre, biss mit seinen gelblichen Zähnen ihren Kopf ab und entzündete sie mit höchster Konzentration. Eigentlich herrschte im gesamten Verlagsgebäude auf Anordnung der Verlegerin, die nicht so tituliert werden wollte, Rauchverbot seit den Tagen, als sie selbst mühsam dem Nikotin entsagt hatte. Aber Heinrich Weinrich als privilegierter Einzelzimmerbewohner ignorierte diesen Ukas wie viele der älteren Redakteure.
„Also, lieber Kollege, es folgt die Geschichte unserer kleinen, aber immer noch feinen Zeitung im Schweinsgalopp, und zwar so, wie sie nicht im Internet steht. Sie beginnt Ende der 30er Jahre, als der Gründer, ein knorriger Sozialdemokrat, vor den Nazis nach England ins Exil flüchtete. Die Braunen nahmen ihm weniger sein Sozi-Sein übel, sondern dass er sich nicht von seiner jüdischen Frau scheiden lassen wollte. Im Exil hat er sich mehr schlecht als recht durchgeschlagen mit Schreiben, obwohl das nie seine Stärke war. Immerhin hat er mit Thomas Mann korrespondiert, wird sogar mehrfach in dessen Tagebüchern erwähnt, wenn auch nicht immer schmeichelhaft. Nachdem der Nazi-Spuk vorbei war, bekam er von den Briten die Lizenz fürs Zeitungsmachen, das war kurz nach dem Krieg gleichbedeutend mit der Erlaubnis, Geld zu drucken.“
„Wie, musste man damals eine Lizenz haben, um eine Zeitung zu gründen?“, fragte ich; Geschichte hatte mich in der Schule nämlich immer gelangweilt. „Ja, musste man“, erklärte mir der Chefreporter nachsichtig, „nun hatte er also die Lizenz und suchte Redakteure, ein paar kannte er, oder sie wurden ihm von der SPD empfohlen. Dann stellte er den Walter Wiese ein. Sagt dir der Name was?“
„Nee“, zuckte ich mit den Schultern.
„Also, Wiese war ein glänzender Organisator und guter Schreiber. In seinem Lebenslauf hatte er auch nicht verschwiegen, dass er im Krieg Offizier war. Doch hatte er vergessen zu erwähnen, dass er dies nicht in der Wehrmacht, sondern in der Waffen-SS war. Unser Verleger hatte dem Wiese völlig vertraut. Als er die Wahrheit erfuhr, irgendwann in der späten 50ern, war er fix und fertig. Das hat er mir selbst mal so erzählt.“
Читать дальше