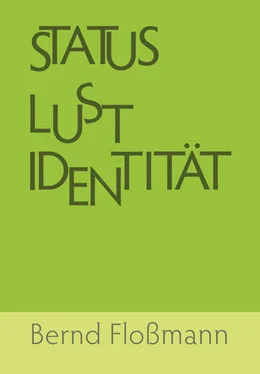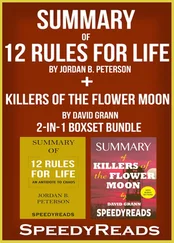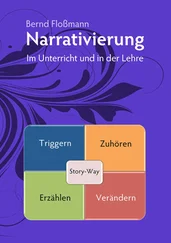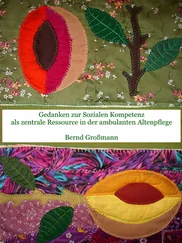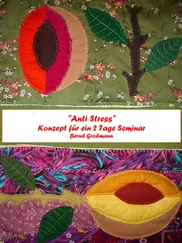Marxistische Theorien betonen die Bedeutung der Gestaltung ökonomischer und technischer Bedingungen für die Entwicklung von Lernen und Führen. Feministische Theorien decken die einseitige Vorherrschaft männlicher Denksysteme auf. Psychologische und psychotherapeutische Zugänge zum Lernen finden sich vor allem in den Randbereichen der Pädagogik, der Hochbegabtenförderung und in der Benachteiligtenförderung. Auch wenn Psychologen und Psychotherapeuten einander gelegentlich die Kompetenz absprechen, findet sich in den von ihnen verwendeten Techniken jedoch sehr viel Material für Lehr- und Lerntechniken. Besonders hervorzuheben ist hier der Ansatz der hypnotischen Sprachmuster von Milton Erickson und der Körper- und Bewegungsansatz von Virginia Satir, der vor allem in der Familienaufstellung und der Skulptur angewendet wird. Dabei ist jedoch immer darauf zu achten, dass im Gegensatz zur autoritativen Art und Weise wie Bert Hellinger diese Techniken anwendet, Interpretation, persönliche Integrität und Freiheit immer auf der Seite der Teilnehmer und Teilnehmerinnen zu bleiben haben.
Viele Lernhindernisse und Spannungen lassen sich mildern oder gar positiv ausnutzen, wenn die psychische Seite behutsam und voller Zuneigung zu den Teilnehmerinnen und Teilnehmern berücksichtigt wird. Natürlich soll die Therapie Sache der professionellen Therapeuten sein und bleiben, Lernen hat aber auch immer eine therapeutische Komponente und diese muss zumindest bewusst sein und berücksichtigt werden. Deshalb fliessen Techniken aus dem Konvolut des Neurolinguistischen Programmierens behutsam in die Gestaltung von teilnehmerzentrierten Lernsituationen ein.
Virginia Satir hat dazu ihre Grundhaltung in den »Fünf Freiheiten« ausgedrückt, zu denen sie ihren Patienten verhelfen wollte:
• Die Freiheit zu sehen und zu hören, was im Moment wirklich da ist - anstatt das, was sein sollte, gewesen ist oder erst sein wird.
•Die Freiheit, das auszusprechen, was ich wirklich fühle und denke und nicht das, was von mir erwartet wird.
•Die Freiheit, zu meinen Gefühlen zu stehen und nicht etwas anderes vorzutäuschen.
•Die Freiheit, um das zu bitten, was ich brauche, anstatt immer erst auf Erlaubnis zu warten.
•Die Freiheit, in eigener Verantwortung Risiken einzugehen, anstatt immer nur auf ›Nummer sicher zu gehen‹ und nichts Neues zu wagen. 1
Weiter sind der Ansatz von Jaques Lacan zum Spiegelstadium 2 und zum Begehren und die Freudschen Ansätze zur Lust, zur Übertragung und zur Neurose eingeflossen. Von Lacan ist besonders die Unterscheidung von Realem, der Differenz zwischen bisher gekonntem und realem Können, die unfassbare und unerwartete Realität, von Imaginärem, in inneren Bildern vorliegendem Selbstbild, die Vorstellungswelt und Symbolischem, der erlernten und geübten Sprache, den Zeichen, dem Verhältnis und der Verwirrung von Signifikanten und Signifikaten für meine Lehre bedeutsam.
Weitere Einflüsse sind in diesem Buch mit dem Ansatz der Themenzentrierten Interaktion (TZI) von Ruth Cohn, der Transaktionsanalyse von Eric Berne und der Theorie der bio-psycho-sozialen Einheit Mensch von Karl-Friedrich Wessel zu finden.
Im Führungsprozess wie im pädagogischen Prozess unterscheiden Rubner/Rubner 37fünf typischen Gruppenphasen:
1 Die Phase der Orientierung
2 Die Phase des Kampfes und der Flucht
3 Die Phase der Interdependenz
4 Die Phase des Vertrauens
5 Die Phase des Übergangs
In ihrer weiteren Forschung fügen Rubner/Rubner zwischen die erste und die zweite Phase noch eine weitere Phase ein, die Phase der Annäherung und Zusammenarbeit. Nach meiner Ansicht wird diese Phase aber durchaus ausreichend mit der zweiten und dritten Phase repräsentiert. Ich korreliere daher fünf Phasen mit diesen Hauptmotivatoren:
1 Kontakt
2 Status
3 Lust
4 Identität
5 Transfer.
Diese fünf Phasen bilden die Struktur dieses Buches, ergänzt durch philosophische, pädagogische und psychologische Grundlagenkenntnisse und Methoden zur Gliederung von Prozessen und Basisfertigkeiten, ohne welche jede Führung und jede pädagogische Intervention zum Scheitern verurteilt ist.
Denn jeder, der sein innres Selbst nicht zu regieren weiß, regierte gar zu gern. [Goethe]
Die Vasen von Erbtante Erika
Klein Lieschen hat die Vase von Erbtante Erika heruntergerissen, sie steht vor dem Scherbenhaufen und weint. Mutter hat das Geräusch gehört, kommt gelaufen und schimpft: »Warum hast du das getan?«
Was haben wir hier?
Zunächst haben wir das Ergebnis einer Bewegung. In diesem Fall ist es ein Scherbenhaufen. Klein Lieschen weint, weil sie mit dem Ergebnis ihrer Handlung nicht zufrieden ist. Mutter schimpft aus demselben Grund. Aber da ist noch mehr.
•Warum ist Lieschen nicht zufrieden mit dem Ergebnis ihrer Bewegung der Vase?
•Was will Lieschen mit dem Weinen erreichen?
•Ist Lieschen jetzt für immer böse und wird ein schlimmes Ende nehmen?
•Wieso kommt Mutter auf die Idee, dass die Vase von Lieschen mit einer Intention, also absichtlich, zerschmettert wurde?
•Was geschieht nun mit Lieschen?
•Wird sie sich eine Begründung »post festum« ausdenken?
•Wird es eine gerechte Strafe geben und was wäre das eigentlich?
•Kann eine solche Strafe zukünftiges Verhalten von Lieschen, insbesondere in Bezug auf die anderen zwanzig Vasen von Erbtante Erika verändern?
•Warum schimpft Mutter, obwohl sie die Vasen von Erbtante Erika selbst nie benutzt und in Wirklichkeit hasst, weil sie sie hässlich findet?
•Hätte das Handeln von Lieschen verhindert werden können, hätte sie rechtzeitig eine Fortbildung über den Wert der Vasen und das Verhalten in Wohnzimmern erhalten?
Mutter unterstellt Lieschen ein Motiv, eine Absicht. Sie kann nicht glauben, anerkennen, dass es sich einfach nur um eine Bewegung mit unvorhergesehener Wirkung gehandelt haben könnte. Und selbst wenn sie das annehmen würde, könnte sie sich in Anbetracht der anderen zwanzig Vasen und den damit verknüpften Hoffnungen auf das Erbe von Tante Erika nicht mit einem solchen unkontrollierten Verhalten abfinden.
Mutter nimmt Ziele und Beweggründe an und verwandelt so Lieschens Bewegung in ein Handeln. Aus diesem Handeln von Lieschen sollen daraufhin in einem ersten Schritt Strafen, Belohnungen und andere Interventionen abgeleitet werden. Diese sollen in einem zweiten Schritt dazu führen, dass ein bestimmtes unerwünschtes Verhalten nicht wiederholt oder ein bestimmtes erwünschtes Verhalten wiederholt wird. Mutter hofft auf eine bleibende Verhaltensänderung, darauf, dass Lieschen aus der Kombination von Untat und Beschimpfung etwas gelernt hat.
Die Belehrung Lieschens durch Mutter mittels pädagogischer Methoden ist ein Machtakt mit dem Ziel der Verhaltensänderung und so wird er auch von Lieschen empfunden. Deshalb weint sie. Ob das Weinen aus dem Gefühl der Ohnmacht kommt oder aus der Angst vor der Strafe oder aus dem Schreck über die Folgen einer Handlung, welche die von ihr geliebte Mutter vielleicht traurig macht, ist nicht eindeutig bestimmbar.
Die Frage, warum jemand etwas tut, oder warum jemand etwas getan hat, stellt sich, abhängig vom Ergebnis einer Handlung, mehr oder weniger ernsthaft und intensiv. Ob es um die Vase von Erbtante Erika oder um ein Ventil im Atomkraftwerk Tschernobyl geht oder um die politische Entscheidung für ein Eingreifen in einem lokalen Konflikt, die Struktur des motivierten Handelns ist ähnlich. Die Folgen dieses Handelns aber betreffen uns und je nach dieser Betroffenheit sind wir an der Beeinflussung von Verhalten interessiert.
Aristoteles, der Zusammenfasser des Wissens zu seiner Zeit, ging bei seiner Untersuchung des Handelns in der »Nikomachischen Ethik« davon aus, dass jedes Handeln einem Zweck oder einem Ziel, der Erreichung eines Gutes zu dienen scheint. Das Höchste dieser Güter war für ihn die Glückseligkeit.
Читать дальше