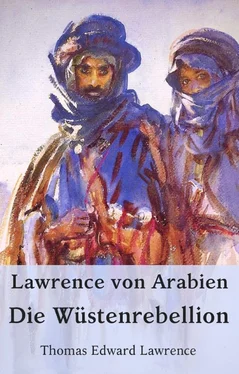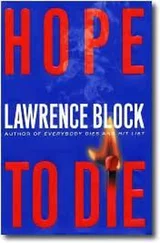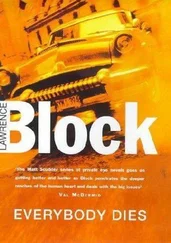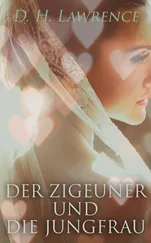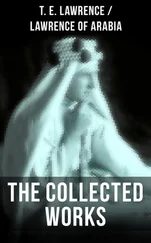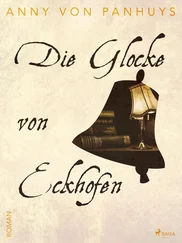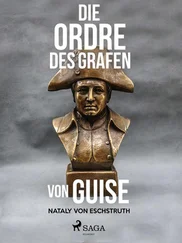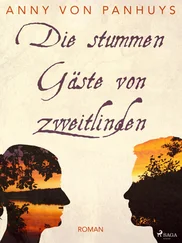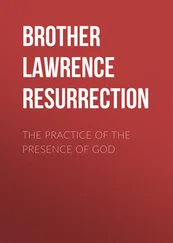Nach seiner Art durchstreifte er ganz allein und zu Fuß mit wenig Geld und noch weniger Gepäck vier Monate lang in der heißesten Jahreszeit kreuz und quer die Länder zwischen Jordan und Euphrat. Der Oxforder Student entsagte allen gewohnten Vorzügen europäischer Zivilisation. Er wanderte von Dorf zu Dorf, aß mit den Bewohnern aus der gemeinsamen Schüssel, wobei die Finger Messer und Gabel ersetzen mußten, und übernachtete in ihren ärmlichen Behausungen. Was das heißt, kann nur der ermessen, der je in den von Schmutz und Ungeziefer starrenden Lehmhütten der Beduinen vergebens Schlaf zu finden suchte. Aber bei dieser Art des Reisens erlernte er rasch die Sprache der Araber, drang in ihre Denk- und Lebensweise ein und erwarb sich Übung in dem oft recht schwierigen Umgang mit ihnen – wiederum die beste Vorbereitung auf die Aufgabe, die, ihm noch unbekannt, seiner wartete.
Nachdem er auf der Universität seinen Grad erworben hatte, kehrte er sehr bald wieder nach dem Orient zurück. Zusammen mit andern leitete er die von einer britischen wissenschaftlichen Gesellschaft unternommenen Ausgrabungen einer alten Hettiterstadt in Djerablus am oberen Euphrat, und zwar – seltsames Spiel des Zufalls – just an einer Stelle, in deren unmittelbarer Nachbarschaft deutsche Ingenieure die große Brücke über den Euphrat bauten im Zug der England so mißliebigen und auch nie vollendeten Bagdadbahn.
Dort in Djerablus blieb er vier Jahre, bis er 1913 zu der getarnten Erkundungsexpedition nach dem Sinai, wie oben erwähnt, abberufen wurde und so zum erstenmal in geheimem Auftrag in den Dienst seines Vaterlandes trat.
Inzwischen spitzten sich die nationalen Gegensätze zwischen Türken und Arabern immer mehr zu. Bereits im Februar 1913 erschien Emir Abdullah, einer der Söhne Husseins, Großscherifs von Mekka und Vasalls des Sultans, bei Lord Kitchener in Kairo und teilte ihm unter dem Siegel der Verschwiegenheit mit, daß sein Vater den kühnen Wunsch hege, die türkische Oberherrschaft abzuschütteln und für den Hedschas mit den Heiligen Städten Mekka und Medina die Unabhängigkeit zu erkämpfen. Der Abgesandte fand, wie sich denken läßt, einen sehr verständnisvollen Zuhörer.
Während des Weltkrieges wurden die vor seinem Ausbruch angeknüpften Fäden weitergesponnen. Nach langem Hin und Her und schwierigen Verhandlungen gelang es England Anfang des Jahres 1916, den mißtrauischen Hussein aus seiner vorsichtigen Reserve herauszulocken. Gegen das Versprechen, Herrscher eines unabhängigen arabischen Reichs zu werden, sollte Großscherif Hussein die Fahne des Aufstands gegen den türkischen Oberherrn entrollen. Die britische Zusage enthielt nichts über Größe und Grenzen des zukünftigen Araberstaates, auch waren einige unbestimmte Vorbehalte eingeflochten.
Es ist nicht anzunehmen, daß der verschlagene und in allen Winkelzügen der Diplomatie erfahrene Hussein sich über die Doppelsinnigkeit und Verzwicktheit der Paktabmachungen getäuscht haben sollte, da er verschiedene Einwendungen erhob. Aber ein längeres Zögern hätte die ganze Erhebung überhaupt in Frage stellen können. Dem Türken war das geheime Spiel zwischen Mekka und Kairo natürlich nicht verborgen geblieben. Dschemal Pascha, der allmächtige Oberbefehlshaber von Syrien und Palästina, schlug mit starker Hand zu. Er ließ eine ganze Anzahl Verdächtiger aus den ersten arabischen Familien ohne viel Federlesens aufhängen, viele andere wurden in entfernte Reichsteile verbannt. Faisal, einer der Söhne Husseins, von dem in diesem Buch viel die Rede ist, weilte damals als widerwilliger Gast im Hauptquartier Dschemals. Er wurde genötigt, der Hinrichtung seiner arabischen Gesinnungsgenossen zuzusehen. Diese Abschreckungsmaßnahmen unterdrückten die geplante Erhebung in Syrien und verhinderten später auch die tätige Mitwirkung der dortigen Bevölkerung bei dem arabischen Vormarsch.
Gleichzeitig wurde von der türkischen Heeresleitung eine starke Truppenmacht entsandt, um Mekka und Medina zu besetzen. Damit sah Großscherif Hussein nicht nur seine eigene Herrschaft, sondern auch seine schönen Zukunftsträume gefährdet. Es blieb ihm nichts übrig, als rasch zu handeln, ohne mit England ganz ins klare gekommen zu sein.
So brach denn der Aufstand vorzeitig und schlecht vorbereitet im Juni 1916 aus. Nach einigen ersten Überraschungserfolgen kam der Rückschlag. Die aus Beduinenstämmen hastig zusammengeraffte Armee Husseins glich mehr »einer Horde wild gewordener Derwische«, wie sich ein Engländer nicht unzutreffend ausdrückte; gegen die geschulten türkischen Truppen vermochten sie wenig auszurichten. Der Sturm der ersten Begeisterung flaute merklich ab. Der ganze Aufstand drohte zusammenzubrechen, wenn ihm nicht von außen frisches Leben zugeführt wurde. Darüber waren sich London und Kairo nicht einig. Die britische Regierung, die überhaupt den Vorgängen im fernen Arabien nur geringe und jedenfalls keine entscheidende Bedeutung beimaß, war geneigt, das anscheinend wenig aussichtsreiche und zudem sehr kostspielige Unternehmen ganz fallen zu lassen. Das Hauptquartier in Kairo sah dagegen in der arabischen Erhebung sein ureigenstes Werk und wollte das Begonnene, wenn irgend möglich, auch zu Ende führen.
Lawrence, der Leutnantsrang erhalten hatte, war bis dahin beim Nachrichtendienst in Kairo beschäftigt, wo seine arabischen Kenntnisse und Erfahrungen am besten verwendet werden konnten. Im Frühjahr 1916 spielte er, wie einer seiner Biographen berichtet,Liddell Hart, »Lawrence in Arabia and after«. Deutsche Ausgabe, Berlin 1935. aus weiter Ferne eine geheimnisvolle Rolle bei der »Eroberung« von Erserum durch die russische Kaukasusarmee – nach einer auffallend schwachen Verteidigung durch die Türken. Ermutigt durch diesen Erfolg, wurde Lawrence kurz darauf in geheimer Mission nach Mesopotamien entsandt, wo der britische General Townsend mit seiner Truppe bei Kut el Amara rettungslos eingeschlossen war. Lawrence hatte den Auftrag, den türkischen Oberbefehlshaber Halil Pascha zu bestimmen, gegen die großzügige Abfindung von einer Million Pfund Sterling den englischen Truppen freien Abzug aus Kut el Amara zu gewähren. Aber diesmal mißglückte der Versuch mit den silbernen Kugeln.
Lawrence gehörte zu den wenigen begeisterten Anhängern des arabischen Aufstands. Als nun die Lage kritisch wurde, entsandte man Sir R. Storrs, Sekretär der Britischen Residentschaft in Kairo, nach dem Hedschas, um festzustellen, welche Aussichten noch für die Erhebung beständen und wie man ihr den Rücken stärken könnte. Lawrence benutzte einen Urlaub, um sich ihm anzuschließen. Mitte Oktober 1916 landeten sie in Dschidda, der Hafenstadt Mekkas. An dieser Stelle setzt die Erzählung ein, der wir hier nicht vorgreifen wollen. Sie schließt mit dem siegreichen Einzug in Damaskus zwei Jahre später.
Es bleibt noch übrig, einen kurzen Blick auf die ferneren Ereignisse zu werfen.
Lawrence, mit dreißig Jahren Oberst geworden, blieb nur wenige Tage in Damaskus. Nach dem feierlichen Einzug Faisals nahm er Urlaub und reiste nach London. Nun an Stelle des Waffengangs die Politik getreten war, fühlte er sich als Christ und Fremdling fehl am Platze. Mehr noch schmerzte ihn die Scham, seinen Freunden unerfüllbare Versprechungen gemacht oder – wie er selbst sagt – »die höchsten Ideale und die Freiheitsliebe der Araber als bloße Werkzeuge im Dienste Englands ausgebeutet zu haben«. Nach seiner Rückkehr in die Heimat sandte er die ihm für seine Verdienste um den arabischen Aufstand gewordenen Auszeichnungen an seinen König und dessen Verbündete zurück.
Die Auseinandersetzungen unter den verbündeten Mächten über die Siegesbeute im Orient zogen sich über Jahre dahin. In das wirre Gestrüpp der Verhandlungen, der kreuz und quer laufenden Interessen und Ansprüche, der fortwährend wechselnden Ereignisse, der geheimen wie offenen Kämpfe einzudringen, erscheint an dieser Stelle nicht notwendig. Die Darlegung würde ein Buch für sich erfordern. Es genügt, aufzuzeigen, was schließlich aus den arabischen Ländern geworden ist.
Читать дальше