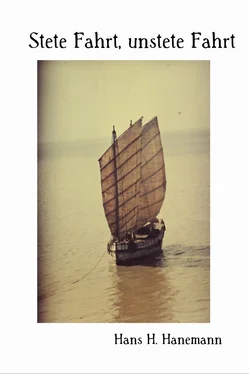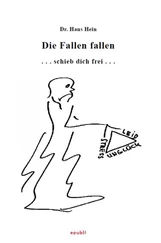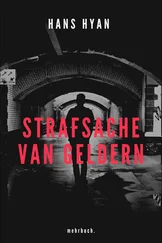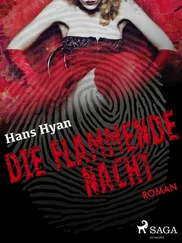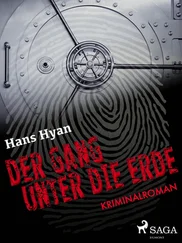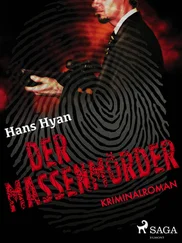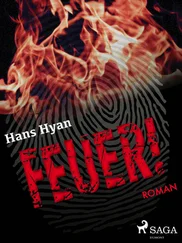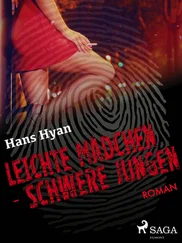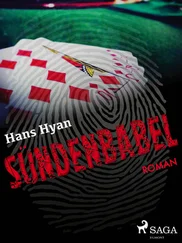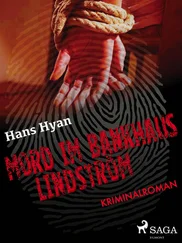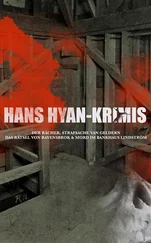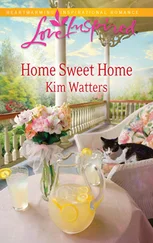*)Anlässlich einer Ermahnung, die mir Frau Arnold wegen eines Vergehens erteilt, sagt sie mir, sie habe es jetzt sehr schwer wegen der neuen Schulpolitik der Regierung, und daß die Schulbehörde dem Leiter der Hindenburgschule eine Kontrollbefugnis über ihre Privatschule zugestanden habe. Während einer Klassenarbeit in Latein ließ ich der vor mir sitzenden Isi von meiner Arbeit abschreiben und sagte ihr auch leise vor, wenn sie mich ebenso leise nach einer Vokabel fragte. Meine Arbeit ist nicht ganz fehlerfrei; aber Isi ist nach Meinung der Lateinlehrerin in ihrem Fach eine völlige Versagerin. Nun ist ihre Arbeit viel zu gut geraten, jedoch mit dem selben Fehler wie ich ihn habe, es ist ja nur einer; in Latein bin ich recht gut, und Isi sitzt direkt in meiner Nachbarschaft. Da ist die Schlussfolgerung einfach. Wir erhalten beide eine Bemerkung unter unsere für ungültig beurteilte Klassenarbeit, die wir den Eltern vorzeigen und unterschreiben lassen sollen. Mein Bruder KW, der gern Unterschriften nachmacht, erbietet sich, Vaters Unterschrift zu fälschen. Die Sache fliegt auf, ich muß zur Direktorin. Sie schilt erst heftig mit mir, wird dann aber milder, erklärt mir, woran sie die Fälschung erkannte und erzählt mir dann von ihren Problemen mit der neuen Schulpolitik. Sie entläßt mich mit den Worten „Sei ein lieber Junge“. Ich habe Glück, es folgt nichts weiter danach.
Wenn ich das Schubertlied „Frühlingsglaube“ nach dem Text von Ludwig Uhland höre, muss ich an meine Zeit an dieser Schule denken. Im Schuljahr 1937/38, dem letzten Jahr ihres Bestehens, findet dort noch einmal ein Sommerfest statt. Alle Klassen haben irgendetwas darzubieten. Ich soll in einem Märchenspiel eine Rolle übernehmen, was mich sehr verdrießt, weil sie mir zu kindlich vorkommt. Aber unsere Klassenlehrerin läßt sich nicht erweichen, mir eine andere Rolle zu geben. Das Schubertlied wird auf dem Fest von den beiden Schwestern Margret und Elisabeth (Isi) gesungen, von unserem Musik- und Turnlehrer Stave am Klavier begleitet.
Die linden Lüfte sind erwacht,
Sie säuseln und weben Tag und Nacht,
Sie schaffen an allen Enden.
O frischer Duft, o neuer Klang!
Nun armes Herze sei nicht bang!
Nun muß sich alles, alles wenden.
Die Welt wird schöner mit jedem Tag,
Man weiß nicht, was noch werden mag.
Das Blühen will nicht enden.
Es blüht das fernste, tiefste Tal:
Nun, armes Herz, vergiß die Qual!
Nun muß sich alles, alles wenden.
Episoden aus der Jugendzeit
Im Frühjahr 1933 fahren KW und ich ins Butjadinger Land nach Stollhamm zu einer Familie, die eine Schlachterei betreibt. Sie wollte zwei Jungen als Ferienkinder für die Zeit der Osterferien aufnehmen. Der „Stahlhelm“ hatte seine ländlichen Mitglieder aufgefordert, sich an dieser Aktion zu Gunsten kinderreicher städtischer Mitglieder zu beteiligen. Das Ehepaar hat einen erwachsenen Sohn Georg, der auch schon Schlachtermeister ist und mit seinem Vater gemeinsam die Schlachterei betreibt, eine erwachsene Tochter, die aber nicht mehr im Hause ist, und einen schwer behinderten Sohn Otto, der fast blind, zum Teil verkrüppelt, aber intelligent und sehr sensibel ist. *)Er wird vor allem von seiner Großmutter betreut, die ihm täglich aus der Zeitung vorliest, wobei er zu jedem Artikel seinen Kommentar abgibt. Ich bin stark interessiert an seiner Behinderung und habe sicher nicht immer Fragen dazu gestellt, die einsichtig genug sind, um das Schmerzliche der Situation zu würdigen. 1936 in den Sommerferien fahre ich mit dem Fahrrad spontan wieder zur Familie nach Stollhamm. Sie nimmt mich gleich gut auf und es entwickelt sich dadurch ein Verhältnis zwischen ihrem Geschäft und Vater, der nach seiner Reaktivierung als Oberzahlmeister der Artillerie-Abteilung in der alten Dragonerkaserne in Osternburg Chef der Verwaltung geworden ist.
*)s. Fußnote weiter unten
Vielleicht ist das nicht ganz im Sinne einer sauberen preußischen Militärverwaltung anzusehen, aber unser Vater denkt nicht kleinlich und ist auch hilfsbereit anderen gegenüber, selbst wenn er dabei ein wenig die Legalität umgehen muß. Nach dem Kriege, in der Hungerzeit und als er keine Einkünfte hat, danken es ihm einige seiner früheren Mitarbeiter durch materielle Zuwendungen.
1938 im Sommer fahre ich wieder mit dem Fahrrad nach Stollhamm. Jetzt werde ich während dieses Aufenthalts auf die Jahrmärkte des Butjadinger Landes mitgenommen. Die Familie hat eine Würstchenbude, und ich darf mithelfen, die Bude aufzubauen und auch Bock- und Bratwürste auszugeben. Diesmal ist eine junge Schwägerin der in Westfalen verheirateten Tochter bei der Familie, mit der ich dann allein im Einspänner die Aufbauteile der Würstchenbude zum Platz des Jahrmarkts bringe und wo wir die Bude aufbauen. Gertrud, nur Trude gerufen, ist drei Jahre älter als ich, blond und hübsch. Sie überläßt mir manchmal die Zügel des Pferds, bleibt neben mir auf dem Wagen stehen und legt ihren Arm um meine Taille. Einmal nimmt sie meinen Kopf in ihre Hände und küsst mich, wobei sie ihre Zunge kurz in meinen Mund stößt. Es ist der erste Kuss, den ich bewußt von einem weiblichen Wesen erhalte. „Küssen muß ich dir wohl noch beibringen“, sagt sie und lacht. „Hast du noch nie ein Mädchen geküsst?“ Ich gebe zu, daß ich noch keine Gelegenheit dazu erhalten habe. Zu Hause angekommen, beschwört sie mich: „Erzähl bloß niemand, daß wir uns geküsst haben. Sonst lassen die uns nicht wieder alleine los.“ Ich verspreche es ihr, denke aber, daß nicht wir uns, sondern sie mich geküsst hat. Wir gehen ins Haus, nachdem Trude das Pferd abgeschirrt und in seinen Stall gebracht hat. Abends im Bett träume ich vor dem Einschlafen noch von ihr und stelle mir vor, ich läge mit ihr zusammen im Bett und wir streichelten und küssten uns und berührten auch gegenseitig unsere intimen Körperstellen.
Eines Abends sind wir nur mit der Mutter, den beiden Söhnen Georg, der Meister, und Otto, der Behinderte, sowie Trude und dem Lehrling der Schlachterei am Abendbrottisch in der Küche. Georg ist anscheinend etwas alkoholisiert; er spricht undeutlich und lacht manchmal über Nichtigkeiten. Seine Frau scheint schon zu Bett gegangen zu sein und er will ihr nachfolgen. Plötzlich sagt er: „Glieks wullt wi mol een kolet Enne innen warmen Buk schewen.“ „Georg, de Kinners“, sagt seine Mutter besorgt. Trude sieht mich an und feixt. Otto ist empört und schilt: „Sowas brauchst du überhaupt nicht zu erzählen. Das geht uns nichts an, was du mit Hanni machst. Ich will das nicht von dir hören.“ „Na ja, denn man gute Nacht“, sagt Georg, steht auf und verläßt die Küche.
Der schwerbehinderte Otto ist sehr feinfühlig und lehnt frivoles Gerede ab. Er spricht immer hochdeutsch und versucht stets, sich deutlich und einigermaßen gewählt auszudrücken. Das, was sein älterer Bruder da sagte, hat ihn sehr aufgeregt. Seine Mutter muß ihn beruhigen, als Georg die Küche verlassen hat.
Schwerbehinderte wie Otto erhielten in der Nazizeit keine therapeutische Unterstützung. Sie wurden im Gegenteil als „nutzlose Esser“ bezeichnet. Mit vielen anderen geistig und körperliche Behinderten, die auf ausdrückliche Initiative Hitlers in Sondereinrichtungen für solche Behinderungen eingewiesen und dort von amtiuerenden Ärzten und Pflegern mit Giftinjektionen ermordet wurden, kann auch Otto dieses Schicksal geteilt haben. Ich habe nach meinem letzten Besuch bei der Familie keine Verbindung mehr zu ihr gehabt. Meine späteren Briefe während des Krieges wurden nicht beantwortet; Schreiben gehörte nicht gerade zu ihren Fähigkeiten. Vielleicht ließ ja auch der Inhalt meiner Briefe keine Antwort erwarten. Oder es gab in der Familie gerade wegen des schwerbehinderten Otto Sorgen, die ihr Gedanken an Nebensächlichkeiten nicht mehr erlaubten.
Читать дальше