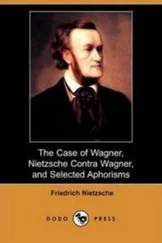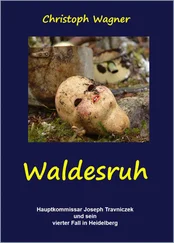Tic Tac Toe
„Ist der Ruf erst ruiniert …” (2000)
Pass bloß auf, Alter, wir sind unheimlich böse jetzt, echt. Keine Girlies mehr, nee, nee. Sondern Grrrls! Wir sagen „ficken“! Jaaa! In unserem Video gibt es Maschinenpistolen, mit denen die Bullen voll Stress machen, es aber nicht schaffen, uns zu töten, weil wir die Superzicken sind, die unsterblichen, gecheckt? Und weißte was? Wir ham jetzt Gitarren! Das kracht, ey. Das finden bestimmt jetzt auch 19-Jährige cool. Sagt Börger, der uns wieder die Texte in den Mund gelegt … äh … vom Maul abgeschaut hat. Und jetzt verpiss dich, Alter, sonst ziehen wir die Springerstiefel aus und hauen sie dir über die Rübe, während wir unheimlich böse „ficken!“ kreischen. Verstehste.
Till Brönner
„Chattin with Chet” (2000)
Willkommen im Vorgestern, Till. Der stets nach Hipness strebende, technisch tadellose Jungtrompeter mit dem Miles-Davis-Komplex wandelt nun auf den Pfaden einer weiteren (von ihm sogar gesampelten) Blaslegende, Chet Baker nämlich. Doch er tut das mit den – das geht schnell heutzutage – veralteten Stilmitteln von Drum & Bass, Bossa Nova und James Last. Schon sechs Alben lang hechelt der gute Brönner wechselnden Aktualitäten hinterher; zuletzt waren es groovender Soul, dann Loungejazz. Das ist rührend, macht die Sache für ihn aber kaum besser, wäre er doch megagern einmal, ein einziges Mal, die Speerspitze eines Trends und nicht der Rattenschwanz. Schau einfach mal nicht zurück, Till, sonst erstarrst du noch zur Salzsäule.
Tim Finn
„Say it is so” (2000)
Nein, Tim ist nicht Neil, aber auch er war, wie sein Bruder, Mitglied von Split Enz und Crowded House. Auf seinem neuen Soloalbum singt er gepresst und heiser wie einst Gerry Rafferty, als der noch ein Folkie bei den Humblebums war. Finns Gitarrenpop gibt sich allerdings moderner, als es der Gesangsstil vermuten lässt. Lächelnd ließ er es zu, dass der Produzent Jay Joyce das Album auf sympathisch verspielte Weise überproduzierte, es mit Samples und Computern vor allzu großer Zugänglichkeit bewahrte. Obgleich in Nashville produziert, schafften es kaum Countryelemente aufs Album; die meisten vielleicht im Opener „Underwater Mountain“, dem schönsten Stück der Platte. Ein Album für Leute, die Musiker dafür lieben, dass sie das Chartspotenzial, das sie haben, mit trotzigem Lächeln nicht ausschöpfen. So einer ist Tim Finn.
Tim Gibbons
„Shylingo” (2000)
Was ist Glück? Eine von einer Million Definitionen könnte sein: den richtigen Menschen zur richtigen Zeit zu treffen. Jahrelang zog Tim Gibbons mit gekrächzten Songs und Gitarre durch die Kneipen Ontarios und würde das wahrscheinlich noch heute tun, wäre er nicht dem Produzenten Daniel Lanois begegnet. Schon lugte die Welt um die Ecke. Sein höchst atmosphärisches Zeitlupenalbum „Shylingo“ produzierte Lanois’ Toningenieur Mark Howard, der auch den Sound auf Dylans „Time out of Mind“ verantwortete und dessen hallende Tiefe er mit herübernahm zu Gibbons. Diese Musik scheint vom Grund des Grand Canyons zu kommen, sie klingt wie die nächtliche Kühle der Wüste. Alle Instrumente, vor allem Gibbons’ Lanois-geschulte Tremologitarre, schweben eine Handbreit über dem Boden. Ein verwunschenes Meisterwerk mit gekrächzten Songs von fernen Orten, Zeiten und Schatten. Es wäre jammerschade gewesen, hätten nur die Menschen in den Kneipen von Ontario dieses Wunder erlebt. Dieses Glück.
Tim Hutton
„Everything” (2000)
Vor Jahren wurde Beth Orton einmal nachgesagt, sie habe ein Genre kreiert: TripFolk. Das stimmte nicht. Erst Tim Hutton füllt den Begriff mit Inhalt. Er ist Englands Antwort auf Jay Jay Johanson, doch schlägt in ihm auch das Herz eines Singer/Songwriters. Grooves und Gitarren, Jazz und TripHop verstehen sich wortlos unterm Einfluss von Huttons sanfter, wenngleich beharrlicher Integrationskraft. „Das Experimentelle sollte in klassischen Songstrukturen funktionieren“, sagt Hutton. Seine Musik aber klingt bei weitem weniger technokratisch als Huttons Methode. Sie ist sinnlich und dunkel, aber ohne Schwere. Herbst, kannst kommen.
Tin Hat Trio
„Memory is an Elephant” (2000)
Auffällig ist die konzentrierte Ruhe und Klarheit, die das US-Trio mit der Kerninstrumentierung Akkordeon, Violine und Gitarre ausstrahlt. Bob Burger, Caral Kihlstedt und Mark Orton können was, aber sie lassen es nicht raushängen. Ihr Motto: Flair statt Virtuosität. Sie haben den Tango gelöffelt, den Swing, den Sintijazz, sie haben Piazzolla studiert und sogar die Zusammenarbeit mit dem New Yorker Lärmberserker John Zorn überstanden – alles, ohne sich aus der Ruhe bringen zu lassen. Einziger Schwachpunkt ihrer hochinteressanten CD: der (überflüssige) Ausflug ins avantgardistische Kunstlied am Ende.
Tom Liwa
„St. Amour” (2000)
Schaut mal in dieses Gesicht. Es ist das eines vernarbten, traurigen Bohemiens. Hört mal diese Stimme, sie ist ganz anders: die eines träumerischen Erstsemesters. Und denkt mal nach über diese Texte. Sie sind voller Selbsterkenntnis, dabei fatalistisch und nachsichtig, als habe Tom Liwa schon ein ganzes Leben hinter sich. „Fehler für Fehler/komm’ ich mir näher“, singt er. Die Flowerpornoes hat Liwa abgeschüttelt und sich damit befreit zum akustischen Songwriterpop zwischen Nikki Sudden und Element Of Crime, zwischen dem Flair von Montmartre und der Aura einer langen Fahrt durch amerikanische Canyons. Sein Album „St. Amour“ lächelt dich an. Vernarbt und traurig. Und glücklich.
Tuey Connell
„Is this Love” (2000)
Als träfe ein junger, von durchzechten Nächten angenehm erschöpfter Sinatra auf Dave Brubeck, der zuletzt ziemlich viele Booker-T-Platten gehört hat: So klingt dieses erstaunliche Debüt. Oder tun wir dem jungen Jazzsänger und -Songschreiber Tuey Connell aus Chicago damit unrecht, wenn wir ihn mit den Größen der Vergangenheit vergleichen? Nicht besonders. Seine Kunst wurzelt tief im Gestern; sie versucht, den Barjazz am Leben zu erhalten – und das mit jenem nachtfarbenen Understatement, mit jener Coolness der schweren Lider, die beide nötig sind, damit wir beim Trinken unserer Drinks nicht aus der Ruhe geraten. Bei Connells Musik schmelzen keine Eiswürfel im Glas, aber sie vibrieren leicht. Als wollten sie swingen.
U2
„All that you can’t leave behind” (2000)
Auf so viel unwiderstehlichen Pop hätte keiner gewettet. Bonos noch immer aphrodisiakische Stimme singt die strahlendsten Songs seit dem Klassiker von 1987, „The Joshua Tree“; das ganze Album markiert eine Rückkehr zum kristallen schimmernden Poprock von erhabener Größe, der sich liebevoll um Songs und Melodien kümmert und nicht mehr um avantgardistische Bedeutungshuberei, die seit „Zooropa“ die Musik von U2 im Klammergriff hatte. Die Zeit der Experimente, als U2 verbissen die innovativste aller Megabands sein wollten, ist vorbei. Jetzt relaxt der Riese – und singt schlichte schöne Songs, statt Bosnien zu retten. Das Album liegt da wie ein sonnengesprenkelter Pool: aufs Sprungbrett und kopfüber hinein. Und dann tauchen und tauchen. „Die Songs haben keine großartigen Melodien“, sagte Bono einst über „Achtung Baby“, „aber sie gehen unter die Haut.“ Diesmal gehen sie unter die Haut, haben aber auch großartige Melodien. Und ehrlich gesagt: Das ist noch besser.
Uusitalo
„Vapaa Muurari live” (2000)
Es ist, als sähe man Robotern beim Arbeiten zu, in einer menschenleeren Halle. Die Musik von Uusitalo ist dennoch nicht ganz antibiotisch. Doch jene Frauenstimme, die manchmal aufkommt, verkörpert nur die Einsamkeit eines Organismus in einem digitalen Maschinenpark. Diese Inkarnation von Vladislav Delay, der unterm Pseudonym Luomo auch minimalistischen House erschafft, bedient sich der Sezierkünste des Dub, um die Strukturen von Techno, Elektronik und Beats freizulegen. Dank elektronischer Flächen haben wir dennoch nicht das Gefühl, das Skelett eines Cyborgs vor uns zu haben. Diese Roboter tragen Kleider, und sie sind wunderschön.
Читать дальше