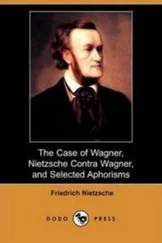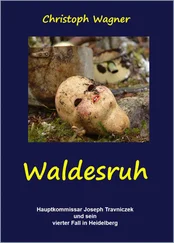Dieses Album klingt, als hätte die Band einen Minderwertigkeitskomplex – etwa weil sie aus dem Popländchen Dänemark kommt? Die Sängerin Gry jedenfalls hat eigentlich genug Reputation (etwa durch ihr Multimediaprojekt mit FM Einheit), um die Band, die gleich mit dem ersten Album beweisen will, dass sie weitgehend alle Chartsstile beherrscht, einzunorden. Tat sie aber nicht. Deshalb klingen Cantina überkandidelt, überambitioniert – wie David, der mit Macht beweisen will, dass er in Wahrheit Goliath ist. Ihr Mainstreampop bedient sich beim Schwung der alten Vaya Con Dios, steppt seitwärts Richtung Baccara, plustert sich an anderer Stelle mit modischen Latinbläsern und lässt auch gerne mal Streicher im Wind flattern, wenn es balladesk werden soll. Zu viel des Guten macht eben am Ende alles schlecht.
Carly Simon
„The Bedroom Tapes” (2000)
Der logische Fehler in „You’re so vain“ – „You probably think/this song is about you“ – verhinderte nicht seine Karriere als Welthit, doch danach glänzte die US-Songwriterin im Wesentlichen nur noch mit einem unglaublich breiten Mund, den viele Jahre später erst Julia Roberts wieder so hinbekam. Ihre aktuellen Beziehungsgeschichten im Songwriterrockstil unterscheiden sich kaum von Simons Alben aus den 70ern: Sie sind eingängig, ein wenig melancholisch und haben einen Hang zum Edlen. Wären sie so bissig wie Carlys biografischer Infotext, uns allen wäre mehr gedient. Dort heißt es über den damaligen Dylan-Manager Albert Grossman: „Er bot mir seinen Körper gegen weltweiten Erfolg. Leider war sein Körper nicht von jener Sorte, für die du dich leichtherzig verkaufst. Mein Album produzierte dann Bob Johnson – und auch der war unglaublich versaut.“ Carlys Autobiografie dürfte eindeutig aufregender sein als dieses Album.
Cashma Hoody
„And the Light within” (2000)
Wahnsinn, was dieser Band für ein Ruf vorauseilt. Nämlich der: „als einzige Band ohne Plattendeal im letzten Jahrtausend die Batschkapp ausverkauft zu haben“. Zitat Ende. Nichthessen wissen wohl nicht, dass die Batschkapp ein mäßig großer Frankfurter Club ist. Noch weniger Leute wissen, was Cashma Hoody ist: eine Frankfurter Band nämlich, was – in Anbetracht der üblichen Mobilisierung aller Freunde und Familienmitglieder – das Ausverkaufen der Batschkapp deutlich relativiert. Ihr lustvoller Reggaerock vermag ein Livepublikum sicher in eine Masse wogender Leiber zu verwandeln, doch auf CD ist das alles blutarm, da tendenziell überproduziert. Außerdem will mir partout kein Argument einfallen, warum ich Reggae aus Frankfurt hören soll. Oder Country aus Kamen. Oder Irish Folk aus Winsen an der Luhe.
Cherry Poppin’ Daddies
„Soul Caddy” (2000)
Die Band aus Oregon gehört im weiteren Sinn zum New-Swing-Revival, das Brian Setzer anführt, doch ihre Mixtur ist rock- und boogielastiger; sie verstehen es besser, einem die uralten Stile im kunterbunten Popkleid unterzujubeln – und oft genug auch in einer löchrigen Rockerlederkluft mit Punkstickern. Nur für kochenden Soul ist Steve Perrys Stimme etwas zu dünn. Manches Stück legt los mit Bläserbreitseiten und verebbt im schmutzigen Schweinerockriff. Und immer trägt Perry dazu seine kniehohen silbernen Schnürstiefel, als wenn Elvis’ Mitt-70er-Glamanzug nicht Ziel- und Endpunkt dieses egomanischen Stils gewesen wäre. So wird der Mann es noch weit bringen.
Coldplay
„Parachutes” (2000)
Am beeindruckendsten sind nicht die Songs, obgleich sie wunderbar sind. Sondern die Gelassenheit, mit der Coldplay sie vortragen. Dabei würden die Lieder mit ihrem epischen Understatement schon ausreichen, diese Band berühmt zu machen. Doch Coldplay hätten sie zerstören können, wären sie so hibbelig, wie man es Newcomern gern verzeiht. Ihre Ruhe aber ist überwältigend. Diese Band glaubt an sich, vielleicht sogar an eine Mission. Sie bringt Größe und Erhabenheit zurück in den Britrock, sie weiß um die unbezwingbare Kraft eines simplen Akustikgitarrenriffs und um die Wirkung eines Songs, der mit geschlossenen Augen gesungen wird. Ein intensives Album. Kein Ton zu viel, keiner zu wenig. Und nicht einer banal.
Cristian Vogel
„Rescate 137” (2000)
Wenn es „Intelligent Techno“ (IT) gibt, muss dann nicht der große Rest des Genres als strohdumm gelten? Logisch. Cristian Vogel aus Brighton findet allerdings auch IT inzwischen öde. Seine schroffen, bewusst hermetischen Alben der letzten Jahre ließen das auch jeden wissen. Doch das Kritikastertum lähmte auch seine Kreativität. Er musste sich befreien, Input aus alten Genres musste her: Rock, Pop, Funk. So klingt „Rescate 137“ bisweilen erdig wie ein Schamanentanz im afrikanischen Busch. Seine typisch eiskalte Hektik, die einen entweder betäubte oder kirre werden ließ, weicht nun einer gewissen Wärme, analoge Klänge lugen aus dem Dickicht. Doch keine Panik: Wenn der komische Vogel wirklich will, dann klingen seine Breakbeats noch immer absurder als alles andere auf der Welt – Beweis: das Ende von „Wind from Nowhere“.
Dave Matthews Band
„Listener supported” (2000)
Ein Jazzintro: freie Perkussion, ein jammerndes Sax. Erst allmählich kommen jene Stile ins Spiel, die, wohltemperiert gemischt, der Band aus Virginia den immensen US-Erfolg bescherten: Folk, Rock, Country, Latinflair. Dennoch werden die Studioalben überschätzt; erst live, wie auf dieser Doppel-CD, erschließen sich die Gründe der Matthews-Mania. Sie liegen im ausufernd improvisierten Spiel, im Abzweigen auf jene mäandernden Straßen, die einst Grateful Dead planierten. Man spürt, wie beseelend ein solcher Konzertabend sein muss, trotz des mittelmäßigen Gesangs von Matthews. Doch es ist eben die pulsierende, verschachtelte Instrumentalspur, welche die Band auf die Bühne legt wie kaum eine andere. Grateful (Half-)Dead.
David Carretta
„Le Catalogue Electronique” (2000)
Fronkreisch, du hast es gut: Die Houseszene boomt, gallische Elektronik ist ein Hinhörer. Carretta kommt aus Toulouse, vom Rand also, und sein „Catalogue Electronique“ wirkt, als hätte er seine Sounds und Beats nur geschaffen, um ihnen anschließend drei Viertel der Substanz wieder wegzuschneiden. Übrig bleibt ein gleichsam zweidimensionaler Technohouse, der nirgends in die Tiefe geht. Abgehackte Beats grundieren bläserhafte Synthieschlieren; manchmal nähert sich das emotionslose Gewusel gar scheu der Musik von Steve Reich oder den selbstgebastelten Klängen des frühen Wave. Spröde, schroff und packend – ein Gegenentwurf zur Listeningseligkeit, die ja ebenfalls ihre Basis in Frankreich hat.
David Gray
„White Ladder” (2000)
Wenn einen Joan Baez zum „bedeutendsten Dichter seit Bob Dylan“ ausruft, muss das nicht unbedingt erhebend sein. Es könnte sich schließlich a) um den unangemessenen Annäherungsversuch einer ergrauten Folkdame handeln und b) zu einer Bürde werden, die man für den Rest seiner Karriere nicht mehr los wird. David Gray hat auch so seine Probleme gehabt in der Vergangenheit, doch jetzt ist alles fantastisch: Sein Album ist voller brillanter Songs wie „Babylon“ oder „Please forgive me“ und der Erfolg zu Hause in England außergewöhnlich. Grays Gesang hat viel von jener urtümlichen Kraft der mittleren Dylan-Phase, seine Musik aber ist näher an „Series of Dreams“ als an „Tombstone Blues“. Und die Energie seiner Songs, das Beharren auf große Phrasen, die Wiederholungen: All das ist junger Van Morrison. Sagen wir, wie es ist: David Gray ist großartig. Eine Adrenalininjektion fürs Songwritergenre.
Читать дальше