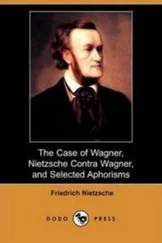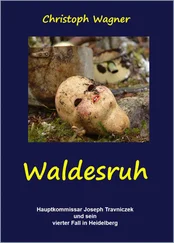Arcadi Volodos
„Rachmaninoff: Concerto No. 3. in D Minor” (2000)
Ob er nun, wie DER SPIEGEL zu wissen meint, wirklich das Zeug zum neuen Horowitz hat, oder wir es gar, wie DIE WELT penibel berechnete, mit „Horowitz hoch drei“ zu tun haben, sei dahin gestellt. Dem oft gehörten Klassiker (und sechs weiteren Stücken) von Rachmaninoff jedenfalls gewinnt der Tastenderwisch Volodos neue Aspekte ab – artistische und lyrische, um genau zu sein. Und so richtig ernst nehmen seine Triller und Triolen den großen Alten auch nicht. Unter Volodos’ flinken Fingern wird Neoromantik zum zeitgemäßen Virtuosenstück. Rachmaninoff, von dem selbst ja auch Einspielungen dieser Komposition vorliegen, würde wahrscheinlich dankend verzichten, forderte man ihn zum Wettstreit mit dem Interpreten auf. Aber dirigieren würde Sergej ihn liebend gerne, das ist mal sicher.
Ash Ra Tempel
„Friendship + Gin Rosé at the Royal Festival Hall” (2000)
Es gehört Mut dazu, nach 30 Jahren im Geschäft noch auf die elementaren Reize zu setzen. Auf jene zwei Töne, zwischen denen die ungeheuer weiten Synthieflächen wehen, ehe tribale Drums zu pochen beginnen und schließlich jene klagende Gitarre des Manuel Göttsching einsetzt. Sein Stil: In weiter Ferne, so nah. Er und sein neuer alter Kumpel Klaus Schulze werden in Frankreich, England, Japan wie Gurus verehrt; es gibt auch kaum einen Gitarristen auf der Welt, der auf so emotionale Weise Rhythmen und Melodien verflicht wie Göttsching, kaum einen einflussreicheren Keyboarder als Schulze. Beide gründeten einst Ash Ra Tempel und schrieben im 68er Berlin als Popavantgardisten Geschichte. Auf diesen zwei CDs finden sie sich wieder nach Dekaden – zu langen Trips, nur alle 20, 30 Minuten durch eine Leerrille unterbrochen. Eine unwiderstehliche Attacke aufs limbische System.
B. B. King & Eric Clapton
„Riding with the King” (2000)
Hier trifft der ganz Alte auf den schon ganz schön Alten, und man weiß beim besten Willen nicht, wer von beiden nun der im CD-Titel erwähnte König ist, selbst wenn der eine King heißt. Was den Blues angeht, können beide jedenfalls gar Anspruch auf den Kaiserthron erheben. Will sagen: Es war eine sehr gute Idee, beide Herrscher zum Gipfel zu bitten. Die bewährte Clapton-Allstar-Band um Steve Gadd (dr) und Andy Fairweather-Low (g) umhegt die beiden Gitarreros mit leuchtenden Augen, und B. B. und Eric kämpfen sich genussvoll durchs reiche Repertoire, vor allem durch das von King („Three o’Clock Blues“, „Days of old“), während Exgott Clapton „nur“ „Key to the Highway“ beisteuert, überraschend in einer gelassenen akustischen Version. Zeitloser, abgeklärter Blues zweier Ausnahmekönner.
Ein einziges Mal steckte das Küken Stephen Jones sein Schnäbelchen aus dem Bastelkellerfenster, blinzelte baff in die Welt, sang „You’re gorgeous“ – und fand sich plötzlich wieder in der Glamourwelt des Pop. Doch der Ruhm, der Majordeal, das Rampenlicht: All das verschreckte unser Babybird. Also zog es sich zurück ins Nest und zwitscherte lieber weiter wie zuvor: schief und schräg und auf jeden Fall so, dass Ruhm und Rampenlicht nicht mehr drohen. Lieber schichtet Jones Spur um Spur aufeinander, so dass ein einziger großer Chorus aus Beats, Gitarren, Electronika, Trompeten entsteht. Songs wie „Out of Sight“ sind immer noch großer Pop, wenngleich ohne den fesselnden „Gorgeous“-Appeal; die meisten Stücke auf „Bugged“ aber vergraben sich selbstverliebt im Bastelkeller. Nicht viele werden sich die Mühe machen, sie unterm Gerümpel freizulegen. Für einige Songs aber lohnt sich die Mühe. Wirklich.
Bats In The Head
„Headroom” (2000)
Ist das eine Reinkarnation von Jefferson Starship, die beschlossen haben, sich an metallischem Alternativerock zu versuchen? Ungewiss. Gewiss ist die Herkunft der Band: aus Berlin. Und gewiss ist, an wen der Gesang von Kristin Target erinnert: an den von Grace Slick. Manchmal zumindest. Schwer zu fassen, diese Band. Der Drummer spielt gern den Heavy-Metal-Prügler. Der Gitarrist hegt heimliche Lieben für Grunge und Boogie, und Kristin weckt, wie gesagt, Assoziationen an US-Westcoast-Psychedelia von circa 1969. Wäre da nur nicht ihr leichter deutscher Zungenschlag, der manchen englischen Text nicht gänzlich unbeschadet lässt. Wären da nur nicht manche statischen Mittelteile in enervierendem Progrockgehabe. Tja, dann wäre die Band nicht schlecht. So hat sie immerhin eines: Potenzial. Vielleicht.
Bebel Gilberto
„Tanto Tempo” (2000)
Bei Gaetano Veloso hat man immer das Gefühl, er sänge mit halbgeschlossenen Augen. Bei Bebel Gilberto auch; auch sie, die Tochter Joao Gilbertos, kommt aus Brasilien (und lebt in New York), auch sie scheint sich, ermattet vom Tanz, in einer Post-Bossa-Traumwelt zu wiegen, in der die Geschichten ins Schweben geraten. Ein Gesang wie ein Trippeln, auf Händen getragen von der jungen elektronischen Bossaschule wie Smoke City oder Amon Tobin – vor allem aber vom Produzenten Suba aus São Paulo, der kurz nach Abschluss der Aufnahmen ums Leben kam. Vorsicht beim Näherkommen: So zart ist diese Musik, dass sie sich auflösen könnte, wenn man sie unachtsam berührt. Und nichts wollen wir weniger.
Belle And Sebastian
„Fold your Hands Child, you walk like a Peasant” (2000)
Es ist schwer, wenn nicht unmöglich, auf dieser Welt größere Schönheit zu finden als jene, die aufstrahlt in der Musik von Belle And Sebastian. Und das gilt gerade für Momente, wo die ästhetische Reinheit gezielt gebrochen wird durch ein Saitenrutschen beim Umgreifen oder ein knappes Verfehlen der Tonlage beim Gesang. Denn das allzu Schöne tendiert schnell zum Kitsch, das weiß der Songwriter Stuart Murdoch gut. Manchmal ist Pop Poesie; seit Nick Drake ist das selten der Fall. Doch wenn diese Musik läuft, umspielt ein weißes, blasses Licht die Wände, auf den Möbeln liegen träumende Katzen, und Spinnwebreste glitzern silbrig in leicht bewegter Luft. Die Arrangements aus Streichern und Akustikgitarren klingen, als hätten die Schotten mit den Tindersticks paktiert, doch Songs wie „The wrong Girl“ strahlen eine traurige Euphorie aus, die nur Belle And Sebastian gelingt. Ein Album, bei dem nicht nur Katzen ins Träumen geraten.
Bill Wyman’s Rhythm Kings
„Groovin’” (2000)
Der Ex-Rolling-Stones-Mann Bill Wyman führt seit vier Jahren eine Opagruppe mit Altstars wie Georgie Fame, Peter Frampton, Gary Brooker und anderen – alles verschmitzte gutsituierte Herren, die ihre Schäfchen schon längst allesamt im Trockenen haben. Nur dann hat man wahrscheinlich jene Lockerheit, die auch das Album „Groovin’“ durchzieht. Unaufgeregt nehmen sich die gesetzten Herren Klassiker und (ein paar) selbstkomponierte Songs vor und schwelgen kollektiv in Gelassenheit. Das dämonische „I put a Spell on you“ wird mit Hilfe von Beverly Skeete zum schwülen Barblues exorziert, und auch die anderen Tracks sind durchweg freundlich statt böse. Eine Rentnerband, die sich wohlfühlt und den Wohlfühlblues beherrscht wie nix anderes.
Biosphere & Deathprod
„Nordheim transformed” (2000)
Dies ist genau die Musik, bei der man nach einigen Minuten einen glasigen Blick bekommt. Bei der das Schummerlicht im Loungeclub Schlieren zu ziehen beginnt an den Wänden. Bei der die Blasen im Cocktailglas nur noch in Zeitlupe aufsteigen. Biosphere und Deathprod bearbeiten die elektronische Musik des Norwegers Arne Nordheim mit der Trägheit von Unterwasserbewegungen und beziehen sich dabei unüberhörbar auf Brian Enos Ambientphilosophie aus den 70ern. Diese Musik steht unbewegt im Raum, sie scheint unantastbar, gleichsam autistisch, und doch verändert sie alles: den Raum, unsere Stimmung. Und unseren Blick, schon nach wenigen Minuten.
Читать дальше