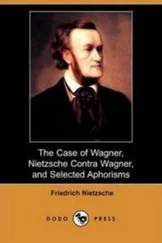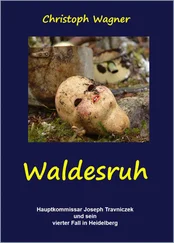„Bei ihm jault die Elektrische, als hätten seit Hendrix’ Tod nicht Legionen von Saitenwichsern ihre eklen Feedbackeiterbeulen öffentlich ausgedrückt.“
aus der Rezension zu „Mother Tongue“ von Mother Tongue
Aerosmith
„Get a Grip” (1995)
23 Jahre lang lieferte Pink Floyds Kuhcover für „Atom Heart Mother“ das rindviehtechnische Optimum. Jetzt kommen Aerosmith: Ihre Coverkuh trägt nicht nur ihr B(r)andzeichen, sondern auch einen Ohrring im Euter. Das ist witzig, und ihr Hardrock ist fulminant: Der breitmäuligste Shouter aller Zeiten, Steven Tyler, singt sich die schwarze Seele aus dem Leib und setzt schrille Harmonika-Fanfaren obendrauf; die Gitarristen Perry, Whitford und Hamilton schrammeln schnörkel- und makellos, Drummer Joey Kramer hat den R’n’B mit Löffeln gefressen. Zusammen mit einer prächtigen Bläsersektion setzen Aerosmith knallharte, eherne Maßstäbe – auch dank brillanter Songs wie „Livin’ on the Edge”. Wie sagt Jon Bongiovi: „Ich wünschte, ich wäre halb so lange halb so gut wie Aerosmith.“ Eine verspielte Krachscheibe, in der manche Melodien unterzugehen drohen, die aber zugleich vergessen lässt, dass die Exkokser nun auch schon 23 Jahre im Geschäft sind. So lange eben, wie Pink Floyds Kuhcover das rindviehtechnische Optimum lieferte.
Bill Laswell
„Axiom Ambient: Lost In The Translation” (1995)
Mehr als andere Musik macht diese CD des New Yorker Avantgardisten Bill Laswell den Sehsinn entbehrlich. Sie verdunkelt die Welt und benutzt Klänge als Fackeln, Kerzen und Halogenstrahler. Der Mann, der schon Anfang der 80er genreübergreifend dachte, verbindet US-Jazz mit afrikanischen Rhythmen, lässt Oboen durch weite Klangräume hallen, um ihnen rätselhafte Technogrooves an die Seite zu stellen. Manche Übergänge sind abrupt; es sind geisterhaft aufsteigende Zitate aus Alben seines Axiom-Labels, die wieder wegdämmern und in Weltmusik oder statischen Soundskulpturen aufgehen. Ein Album gegen MTV und Viva. Ein Album nur für die Ohren – Visionen kommen dann von selber, versprochen.
Die Zukunft des Pop ist bunt. Im Gewitter der Genres werden sich viele verirren, werden Trampelpfade ins Dickicht schlagen, die niemand je wieder betreten wird. Gefragt ist jemand, der die Pfade zusammenführt zum Grand Boulevard des Pop, jemand, der gut weiß, dass sie wichtige Zubringer sind. Björk, das singende Sugarcubes-Aschenputtel aus dem Land der Geysire, ist mit „Post“ zu jener Figur gereift. Sie integriert, was auseinanderdriftet, versammelt fähige Köpfe (Tricky, Nellee Hooper), trommelt die ganze Welt zusammen, um sie mit Ethnofood und im Quartett angerührter feiner Streichersoße zu füttern. Sie bittet zum Tanz und füllt zugleich die Köpfe, sie lässt jazzen und lärmen. Björks Entwicklung ist atemberaubend. Wo „Debüt“ Ideen ausstreute von artifiziellem, ausgetüfteltem Elektropop, ist „Post“ nun am (Zwischen-)Ziel angelangt: bei einer angeschmutzten Steely-Dan-Version zum Tanzen, bei Big-Band-Industrial, bei TripHop zum Hinhören. Die Zukunft des Pop ist bunt. Und seine Prophetin kommt aus Island.
Blur
„The great Escape” (1995)
In jenen Splatterfilmen, wo stets ein Monster aus dem Bauch früh ausscheidender Protagonisten hervorbricht, machen diese kurz davor immer Geräusche, die sich anhören wie „Blööörrh“. Ob die Londoner Band Blur sich darüber im Klaren ist? Ihr aparter Britpop jedenfalls ist dem Splatter so fern wie Mutter Teresa der Callgirlkarriere. In einem Duell, das ganz Britannien fesselt, kabbeln sie sich mit den Prollpoppern Oasis aus Manchester, und das tut der Szene gut. Oasis vs. Blur, das heißt Bauch gegen Kopf, bratzende Gitarren gegen perlendes Piano, Arroganz gegen Nonchalance. Und wenn zwei solche Alben dabei herauskommen – roh und großmäulig zwischen Bowie und Glitter (Oasis) oder dandyhaft-süffig zwischen Bryan Ferry und den Kursaal Flyers (Blur) –, lebt der Britpop noch. Am Ende siegen Oasis 4:3.
Chris & Carla
„Life full of Holes” (1995)
Mit den Walkabouts suchen die beiden das Herz des Rock’n’Roll, als Duo füllen sie die Speicher des US-Volksliedgutes. Chris Eckman und Carla Torgerson aus Seattle sind ein Paar in der Kunst wie im Leben. Sie schreiben und spielen Songs von feiner, unkitschiger Schönheit, von folkverwurzelter Melancholie und unromantischer Todesgewissheit. Auch durch diesen leisen, von Gästen wie Peter Buck (R.E.M) oder den Tindersticks unterstützten Liedzyklus geistert der Tote des Jahrzehnts, Kurt Cobain. Daran wird die Popgeschichte noch lang zu schlucken haben, aber auch ihre Mythen aufbauen – ob sie nun die Gefilde des Rock’n’Roll erforscht oder jene des Folk.
David Bowie
„Outside” (1995)
„I think I lost my way“, singt Bowie. Falsch. Das Popchamäleon, das sich seit 1967 geschmeidig an die Zeitläufte schmiegt und sie oft genug prägte, findet auch in den 90ern seinen Weg. Oder besser: seine Wege. Denn „Outside“ ist so komplex wie noch keine Bowie-Platte – pure Popavantgarde. Piano und Perkussion bilden die Basis, darüber fließen Klangströme mit westlichen und östlichen Nebenarmen. Und manchmal (wie in „Hearts of filthy Lesson“) gelingt es Bowie sogar, die spirituelle Kraft von Santana/McLaughlins legendärer Coltrane-Hommage „Love Devotion Surrender“ (1973) mit groovendem Ambientrock zu verbinden. Der Mann lässt sich einfach nicht abhängen.
Disco
„Kitsch Space Creatures” (1995)
Mit rosa Flamingos und gelogenem Namen führt die Hamburger Band uns in die Irre. Dass ihnen so Fans entgehen – wurschtegal, Hauptsache, das Schubladendenken kriegt sein Fett weg. Denn musikalisch haben sie mit Disco nichts am Hut. Dafür aber viel mit beseeltem Glampunk, mit hinreißenden Melodien und hibbeliger Spielfreude. Die Stimme von Stefan Oliver Knoess klingt oft gedämpft und fern, als wehte sie herüber aus der Vergangenheit. Und von dort haben sie auch das sporadische Hawkwind-Synthiezirpen, das ihren Stil in den 70ern verankert. „Put the Blame on me“ dagegen ist die knackige Aktualisierung eines 50er-Klassikers (Eddie Cochrans „Summertime Blues“) – und trotz seiner Fulminanz noch nicht das stärkste Stück: Das ist „Surface“. Hört es und vergesst Green Day.
Elvis Costello
„Kojak Variety” (1995)
Selbst wenn er diese Coverplatte nur gemacht hätte, weil er momentan nicht selber mit der Muse schmust: Es ist eine gute Platte. Costello ehrt die R’n’B-Vorbilder, deren Meisterstücke und Raritäten er sich vorknöpft. Mit einer fantastische Begleitband – darunter der Gitarrist Marc Ribot, die Drumlegende Jim Keltner und der Wurlitzer-Virtuose Larry Knechtel – spielt er Willie Dixon, Burt Bacharach oder Jesse Winchester und hängt sich keuchend und schluchzend rein wie einer, der endlich mit eigenen Songs erhört werden möchte. Doch Elvis Costello will in Wahrheit nur eins: uns auf die fieberhafte Suche nach den Originalen schicken. Am leichtesten fällt das bei Dylans „I threw it all away“, das Costello in ein köstliches Procol-Harum-Ballkleid gesteckt hat.
F.S.K.
„Bei Alfred” (1995)
Mal minimalistisch kratzende NDW-Kataströphchen, mal schauerlich krumme Saloonwalzer: F.S.K. haben bewiesen, dass Volksmusik hüben wie drüben des großen Teichs dieselben Wurzeln hat: den Dilettantismus. Alfred Hilsberg gab den amerikophilen Bayern in den 80ern auf seinem Label What’s So Funny About die Gelegenheit, ihr bizarres Spektrum zwischen Elektrowave und verpunkter Dicke-Backe-Mucke, zwischen Lo-Fi-Ästhetik, Hohlphrasenverarschung („Wenn Du in Liebe bist“) und parodistischer Götterverehrung exzessiv auszuleben. Mit 44 Liedern fürs Volk wird diese ehrenwerte Haltung nun auf zwei CDs gewürdigt, die jene Labeljahre bei Hilsberg resümieren. Und wir sind in Liebe.
Читать дальше