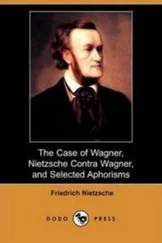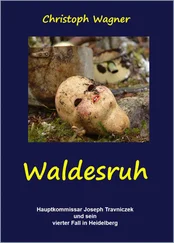Fishbone
„Give Monkey a Brain and he’ll swear he’s the Center of the Universe” (1993)
Der Trend, auf Plattenlänge möglichst viele Genres in möglichst authentischer Form abzuhaken, ist zum Dogma geworden. Kaum ein jüngeres Rock- oder Popalbum, das sich schlicht an einem Stil versucht – anscheinend ist das Ende der Genrealben angebrochen. Der Mixturmanie geben sich auch Fishbone hin: Zwischen Dylan und den Dead Kennedys gilt es ja auch ein riesiges Feld zu bestellen, und sie tun es mit atemloser Hingabe, mit energischem Willen zum Erfolg. Dass ihnen bei dieser schier übermenschlichen Aufgabe nicht die Luft ausgeht, liegt schlicht an den instrumentalen Fertigkeiten der Band. Doch wie so viele Crossoverversuche leidet auch dieses Album unter mangelnder Kompaktheit – für sich genommen klingen viele Songs (sogar die Hardcorenummer) überzeugend, als Konvolut geben sie dem Ganzen kein Gesicht. So bleibt das Beste an dieser CD ihr sarkastischer Titel.
Fred Mc Dowell
„Mississippi Blues” (1993)
Für Fred McDowells Version von „Baby please don’t go“, die nach trägem Beginn schneller wird und schneller, bis sie davonrattert wie ein Wells-Fargo-Zug, der dem flehenden Lover die Geliebte letztlich doch entreißt – für diese Version dürfen getrost sämtliche Scheiben von Robert Gray und Gary Moore im Müll verrotten. Leider ist dieser Klassiker – Pointe! – nicht auf der CD, dafür aber sieben andere Schätze des großen Bluesbarden, eingespielt 1965 mit (etwa) 60 Jahren. Seine Spezialität: die melodiesynchron gezupfte Gitarre mit schleppenden rhythmischen Brücken in den Gesangspausen samt aufs Korpusholz geklopftem Takt. Die Aufnahmequalität ist schlecht, die Songauswahl nicht die beste und dennoch akzeptabel. Bis auf eine Big-Bill-Broonzy-Nummer („Louise“) hat Fred sie alle selbst geschrieben – wobei man dem überkanditelten „Over the hill“ deutlich das Vorbild Robert Johnson anhört.
God Is LSD
„Spirit of Suicide” (1993)
Nachdem der sog. Technovirus monatelang in den Discos getobt hatte, schien das Gegenmittel gefunden: der Impfstoff „Unplugged“ vom Hersteller MTV. Doch der Virus war schlauer, verließ flugs das Ghetto der Tanzschuppen und mutierte. Ihm gelang es, mit anderen Viren zu koalieren. Diese CD dokumentiert seine Fusion mit dem sog. Metalvirus, der seinerseits vom sog. Ethnovirus verseucht ist. Gemeinsam gelang es dem Trio, ins bislang unversehrte Gitarrenland vorzudringen, was vor allem der Hilfe des sog. Samplingvirus zu danken war, den man sich zudem kurzerhand einverleibte. Ein mörderischer Cocktail! Und man mutiert munter weiter.
James Taylor
„Live” (1993)
Episch breit enftaltet der altgediente Songwriter 25 Jahre seines Repertoires, das sich aus aggressionslosem Blues, larmoyanten Folksongs und schlichten Evergreens speist. Live und mit üppiger Folkpopbegleitung behält er bei, was seinen Studioplatten stets eigen(tümlich) war: Die Drogen- und Beziehungsabgründe, in die er zu blicken hatte, waren seinen Songs nie anzuhören. Verzweiflung las sich in Taylors Übersetzung bittersüß, Erschütterndes entschärfte er im Seichten. Selbst am Rande des Abgrunds war er immer der Softie vom Dienst – eben „Sweet Baby James“. Insofern: ein repräsentatives, dazu brillant kompiliertes und abgemischtes Doppelalbum.
John Hiatt
„Perfectly Good Guitar” (1993)
Hiatts Songs riechen nach Erde, Schweiß und Westen, und die Refrains schleichen sich nachts in deine Träume. Ob er’s nun beklagt, dass „those stars“ bühnenöffentlich Klampfen zertrümmern, oder ob er im Stil von The Band das mythentriefende „Buffalo River Home“ beschwört: Hiatt weiß für jedes Sujet die richtige Form; er bleibt auf dem (Gras-)Teppich des US-Bluesrock, während wir abheben, davonfliegen im Fluss der Geschichten und Gitarrenströme, die aus ferner Vergangenheit aufquellen und dennoch weit in die Zukunft weisen. Hiatts Meisterwerk, ein Meilenstein. Woody Guthrie würde sagen: bound for glory.
John Martyn
„Couldn’t love you more” (1993)
Olle Kamellen? Indiz 1: kein neuer Song unter den 15 Titeln dieser CD; Indiz 2: John Martyn ist so alt, dass ihn bereits die wuselig gen Zukunft lärmenden End-70er als BOF (boring old fart) hätten abtun können. Dass es den Schotten (künstlerisch) trotzdem noch gibt, liegt schlicht an seiner musikalischen Integrität. Er ist ein Songschreiber und Musiker, wie es nur wenige gibt. Seine sphärisch-jazzigen Echoexperimente auf der Gitarre, die der Exfolkie live zu hypnotischen Trips ausufern ließ, beeinflussten Legionen von Gitarreros. Und er war der Pionier, der die breite Brücke schlug von keltischem Folk zum US-Soul und Jazz. Doch so sehr seine Kollegen ihn schätzten, so sehr ignorierte ihn das Publikum. Martyn blieb der personifizierte Geheimtip, seine Lorbeeren ernteten andere – etwa Eric Clapton für „May you never“. Bis jetzt. Diese CD könnte alles ändern. Seine schönsten Balladen hat er, unterstützt von Fans wie Phil Collins oder David Gilmour, neu eingespielt, sie gekleidet in Blue-eyed-Soul-Arrangements von sanfter Tiefe, die sich durch Martyns inbrünstigen Gesang und eine filigrane Instrumentierung (incl. Es-ist-3-Uhr-früh-und-die-traurige-Whiskey-Bar-macht-gleich-zu-Saxofon) erst gar nicht in den Ruch der Seichtheit bringen. 15 olle Kamellen, die nunmehr auch dem soulsensiblen Publikum der 90er vorzüglich munden dürften. Die Zeit Martyns als unbekanntester Superstar der westlichen Hemisphäre muss jetzt vorüber sein. Ein für alle Mal.
Leonard Cohen
„The Future” (1993)
Letztmals 1979 traf der Dichter aus Montreal mit „Recent Songs“ einen musikalisch originären Ton. Seither lässt er sich von Streichern umschmeicheln, von Gospelchören anschmachten und von Sequenzern rhythmisieren – wie viele andere auch. Brummbär Cohen trifft ihn nicht mehr, den Ton, der eine Platte einmalig macht. Musikalisch ist er zum Barry White für Akademiker degeneriert. Doch so seicht wie die Musik, so düster die Botschaft: „I’ve seen the future, brother, and it’s murder“. Wir in Deutschland ahnen, was das heißen mag. Und spüren den Drang, mal wieder den jüdischen Poeten Cohen zu lesen. Dazu aber braucht es diese CD weniger als ihr Booklet.
Marla Glen
„This is Marla Glen” (1993)
Dereinst, im Rückblick auf eine große Karriere, wird es heißen: Das Erste, was man auf ihrem Debüt von ihr hörte, war ein kleiner, kehliger Schrei, impulsiv und bebend vor Vorfreude. Glen, in Chicago geboren und Wahlpariserin, versteckt ihre androgyne Stimme gern hinter rauem Ächzen, Hecheln, Keuchen, Bassgebrumm und unriskanten Soul-, Gospel- und Poparrangements. Sie traktiert die Songs mit ihrem erstaunlichen Organ, sie tut viel, fast zu viel – vor allem aber genug, um jene Gänsehaut hervorzurufen, die uns immer dann überläuft, wenn wir bei der Geburt eines Stars zugegen sind. Es träfe die Sache nicht, sie Tom Waits’ Schwester zu nennen oder die Enkelin von Nina Simone oder Joan Armatradings Bruder. Nein: This is Marla Glen. Das wird genügen für lange. Sagt die Gänsehaut.
Negativland
„The Letter U And The Numeral 2” (1993)
Ein verlorener Prozess war Geburtshelfer dieser Kombination aus CD und Magazin: Gegen eine U2-Parodie der Satirecombo Negativland hatte die Plattenfirma Island erfolgreich geklagt – was sowohl das damalige Negativland-Label SST als auch die Gruppe selbst praktisch ruinierte. Island verhielt sich wie ein Elefant, der eine Ameise zermatscht, weil sie es wagte, sich ein Rüsselchen überzuziehen. Das 100-seitige Magazin rollt die ganze (so amüsante wie traurige) Chose anhand von Faksimiles der Originaldokumente auf – inklusive eines erschlichenen Interviews von Negativland mit dem völlig unvorbereiteten U2-Gitarristen The Edge, der am Ende, sichtlich überfordert, finanzielle (!) Hilfe zusagt. Ein Versprechen, das er nie hielt. Auf der beiliegenden Kurz-CD sind Monologe und Sketche aus der Radioshow von Negativland zu hören. Wer das limitierte Kombipaket ersteht, erfährt einiges über korrumpierte, realitätsferne Supergroups (U2), den verbissenen Überlebenskampf kleiner Underdogs und die Macht des Geldes über die Kunst.
Читать дальше