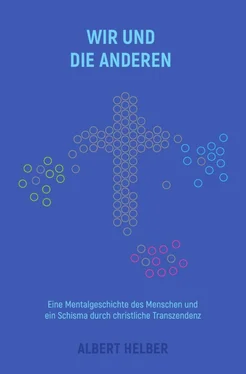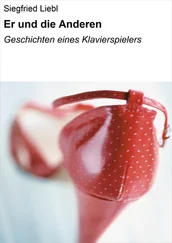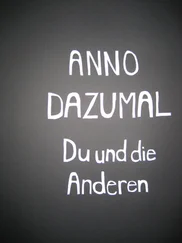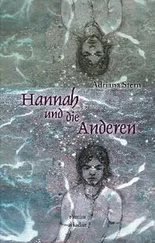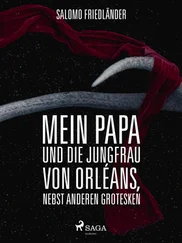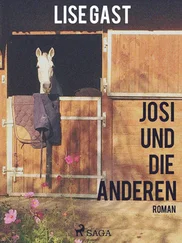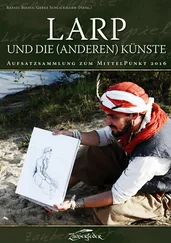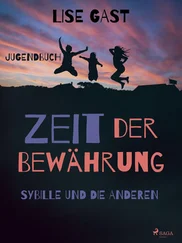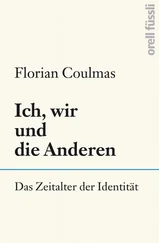Wer die Welt aus einer unstrukturierten Masse, aus einem „Ozean von Ursachen“, aus einem „Urschlamm“ hervor-gehen lässt benutzt natürliche Erfahrungen. Er hat beobachtet, wie in einem unstrukturierten Sumpf aus Wasser und Erde plötzlich Leben sich entfaltet, wie Pflanzen sprießen, Mücken und Schmetterlinge auftauchen oder Würmer und Frösche sich im Schlamm wohlfühlen. Wer in vorgeschichtlicher Zeit sich vorzustellen versucht, wie alles begann, benutzt Beobachtungen und Erfahrungen für seine Erklärung.
In den Weltentstehungsmythen oder Kosmogonien wird das präexistente Chaos oder der „Urschlamm“ durch eine „kosmogene Energie“ strukturiert und mit Wesen erfüllt. Analoge Ideen wirken bis heute fort. Die moderne Physik spricht von einem „Urknall“, dessen Alter wir heute festlegen können. Hinter ihn zu schauen aber bleibt Spekulation. Der Urknall hat jene „kosmogene Energie“ freigesetzt, die noch immer das Weltall verändert und strukturiert. Für den Chinesen Laozi ist diese „kosmogene Energie“ das „Dao“. In den indischen Veden wird kosmogene Energie zu einer „Schattenenergie“ und in Griechenland zur „Lebenskraft“. Sie werden das Chaos strukturieren und den Strukturen eine Seele geben. Eine „causa movens“ des Griechen Aristoteles (384-322 v. Chr.) bewirkt die fortwährende Veränderung seiner „scala naturae“. Weitere Ähnlichkeiten ergeben sich zwischen frühen Vorstellungen und heutigen Erklärungen. Im frühen chinesischen Denken wird die „kosmogene Energie“ des „Dao“ von den polaren Kräften yin und yang strukturiert. In der Darwinschen Evolution spricht man von einem dialektischen Spiel von Veränderung und Einpassung und in der Physik von Schwerkraft und Fliehkraft. Die Spekulation bleibt, die Namen ändern sich.
___________
Auch die Menschen der Frühzeit wissen, dass jede Aktion ausgelöst ist und eine Ursache hat. Ursachensuche ist eine frühe, schon eine präkognitive Eigenschaft des Menschen. Was mit Erfahrungen nicht zu klären ist wird für die Menschen der Frühzeit zu einem Werk der „Götter“. Diese Götter der menschlichen Frühgeschichte im Gilgamesch-Epos, im Atramchasis-Epos oder in den Epen Homers sind dem hebräischen Jahwe vergleichbar. Sie unterscheiden sich aber vom monotheistischen- und transzendenten Gott des christlichen Abendlandes. Die Götter früher Kosmo-logien tragen menschliche Züge. „Wie kam es nur soweit, dass du in der Götterversammlung standest?“ (XI 7) fragt Gilgamesch den göttlichen Uta-napischti. „Deine Glieder sind gar nicht anders..., genau wie ich bist auch du!“ (XI 3). Götter symbolisieren für die damalige Zeit die geheimnis-vollen-, nicht erklärbaren-, auch magischen Kräfte der Natur und entspringen menschlichem Fühlen und Denken. Nichts Menschliches ist den Göttern fremd: Sie sind tugendhaft aber auch schlau und gierig. Mit Mitteln der Betörung durch Schönheit suchen sie die Gesellschaft der Menschen, nicht selten auch mit List und Intrige. Götter sind auch nicht allmächtig. Sie haben Zuständigkeiten. Im ersten Gesang der Odyssee diskutieren sie miteinander in der Götterversammlung. Diese ist hierarchisch strukturiert: Die Götterväter Enlil im Gilgamesch-Epos und im Atramchasis-Epos oder Zeus bei den Griechen regeln den Weltenlauf. Sie haben Helfer, die spezielle Aufgaben erfüllen. Apollo und Helios sind bei den Griechen für Licht und Sonne zuständig. Poseidon ist Herrscher der Meere und Thanatos organisiert die Unterwelt. In Göttern werden menschliche Wünsche symbolisiert: Kinder offenbaren ihre Wünsche, indem sie sich mit dem Wagemut oder Heldentum von Rittern und Piraten identifizieren. Für die frühen Griechen sind Apollo oder Athene die Gestalten ihrer Wünsche und Sehnsüchte. Im Gilgamesch-Epos ist Ischtar die Göttin der Liebe und Ea ein Gott der Weisheit während bei Homer die Pallas Athene Weisheit, Vernunft und Verstand bedeutet. Ihr Geisthauch bestimmt in der Odyssee das Verhalten des Odysseus, seines Sohnes Telemach und seiner Gemahlin Penelope. Der Geist von Pallas Athene ist jene „Innerlichkeit“ im Kopf des Odysseus welche ihn gesund nach langer Irrfahrt in seine Heimat zurückbringt.
_________________
In den Weltentstehungs- oder Schöpfungsmythen ist der Mensch immer das letzte Glied einer Entwicklung: In 1. Mose 2, 7 bläst Gott dem aus einem Erdenkloß gemachten Menschen „den lebendigen Odem in seine Nase. Und also ward der Mensch eine lebendige Seele“. Er ist ein göttliches Geschöpf. Im Atramchasis-Epos beauftragt die Göttergemeinschaft die Muttergöttin Nintu zur Erschaffung des Menschen. Sie formt ihn aus Lehm und macht ihn zum Geistmenschen indem sie den unfertigen Lehmmenschen mit dem Blut des Anführers des Götter-streiks vermengt. Im chinesischen Hundun Mythos ist der Mensch Konsequenz einer bipolaren Energie und wird auch zu deren Träger: Im „Hundun-Mythos“ der Chinesen bohren zwei „Herrscher der Meere“ dem „Unge-schiedenen“ oder „selbstvergessenen Hundun“ Öffnungen für das Sehen, das Hören, Essen und Atmen in den Körper, wobei Essen und Atmen auch für Schmecken und Riechen stehen. Der „Ungeschiedene“ oder selbstvergessene Hundun stirbt. Aus ihm wird ein menschliches Wesen, das sich mit allen Sinnen seinem Umfeld gegenüber öffnet und dieses wahrnimmt. Von der Psychologie wissen wir, dass aus einem Zusammenspiel sensorischer Wahrnehmung beim Menschen eine Erfahrung wird die sich als Emotion zu erkennen gibt und schließlich zu bewussten Gefühlen führt.
Schließlich liefern die älteste Dichtung der Menschheit, das Gilgamesch-Epos und der chinesische Mythos um „Hundun“ auch erste Hinweise auf die Herkunft des Menschen aus biologischen Vorfahren: In Entstehungs-mythen wird zu beschreiben versucht, woher wir Menschen kommen. Der „Ur-Mensch“ Enkidu gewinnt in einem siebentägigen sexuellen Rausch mit der Dirne Schamchat Verstand und Einsicht. Er muss dann allerdings auch erfahren, wie sich Tiere und Natur von ihm abwenden und für ihn zu Objekten werden. Das neue Bewusstsein entfremdet Enkidu von seinem bisherigen Leben und er erschrickt. Im chinesischen Mythos um „Hundun“ wacht der „Ungeschiedene“ mit Bewusstsein auf nachdem ihm Löcher für sinnliche Erfahrungen in seinen „selbstvergessenen“ und durch „Außenablenkung durch Sinne ungeschiedenen“ Körper gebohrt werden. Aus dem „Ungeschiedenen“ ist ein Mensch mit sinnlichen Er-fahrungen und Bewusstsein geworden. In beiden Mythen wird der moderne Mensch mit früheren Entwicklungs-stufen des Menschen in Verbindung gebracht. Erste Ahnungen einer biologischen Evolution sind erkennbar.
Vergleicht man den Hundun-Mythos mit dem Wissen über die anthropologische Evolution, so wird in diesem Mythos die Entwicklung der Hominiden aus ihrer Ursprungs-gruppe nichtmenschlicher Primaten thematisiert. Jene „Metamorphose“ wird mythologisch gedeutet, die sich vor zwei bis drei Millionen Jahren abspielte, den Australo-pithecus sterben ließ und einen Hominiden hervor brachte. Er entwickelte Emotionen und Gefühle und schuf eine neue-, eine bewusste Art des in der Welt Seins. Im Gilgamesch-Epos aus Mesopotamien ist der „Urmensch“ Enkidu ein Hominide, welcher „das (neue) Leben noch nicht kennt“ und „mit den Künsten des Weibes“ von der Dirne Samchat verwandelt wird: „Wissend war nun sein Herz... und tief war seine Einsicht“. Dieser „Urmensch“ Enkidu wird zum Bruder des göttergleichen und nach Unsterblichkeit strebenden Gilgamesch. In diesem frühen Gilgamesch-Epos wird aus einem noch unwissenden-, von Gefühlen gelenkten Kind in Pubertät und Adoleszenz „mit den Künsten des Weibes“ ein wissender- oder erwachsener Mensch, denn „tief war seine Einsicht“. Im Gilgamesch-Mythos wird der Übergang von Enkidu zu Gilgamesch vollzogen. Dieser Mythos des Gilgamesch-Epos offenbart bereits ein frühes Erahnen der Menschen, dass sich in der Individualentwicklung des Menschen eine mentale Evolution zu erkennen gibt. In der Philosophie wird diese Ahnung Wirklichkeit: Der Grieche Aristoteles beschreibt diese Evolution im Denken seiner Zeit als eine „Scala naturae“, als eine Stufenfolge der Natur: Sie beginnt mit Erde und Wasser, führt über Insekten, Würmer, Fische, Vögel bis zu Säugetieren und endet beim Menschen und seinen Göttern. Auch diese sind Teil dieser Natur, sind Produkte einer „Lebenskraft“, oder im Duktus der frühen Chinesen eines „Dao“. Beide schaffen aus einfachsten Anfängen den Menschen und seine Götter.
Читать дальше