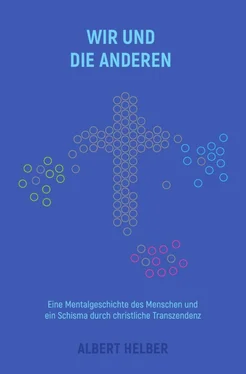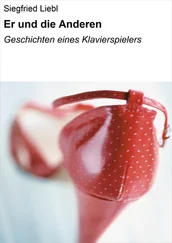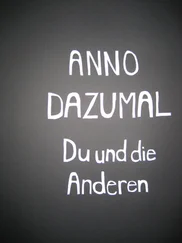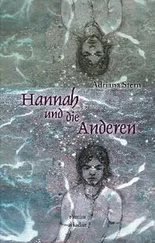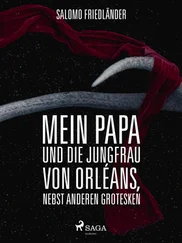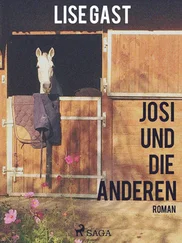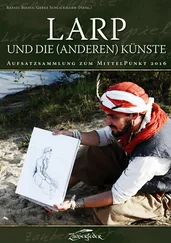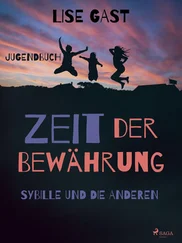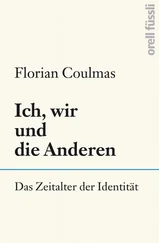1 ...8 9 10 12 13 14 ...20 „Zwei Seelen wohnen ach! In meiner Brust.
Die eine will sich von der anderen trennen:
Die eine hält, in derber Liebeslust,
Sich an die Welt mit klammernden Organen;
Die andre hebt gewaltsam sich vom Dust
Zu den Gefilden hoher Ahnen“.
Psychologen und Philosophen haben erst spät erkannt, was die schreibenden Künstler schon wussten: Sie brauchten lange, die „emotionale Intelligenz“25 neben „kognitiver Intelligenz“ als wichtiges- oder zweites mentales Erbe zu akzeptieren. Sigmund Freud erst hat das Bewusstsein dafür geschaffen53. Er beschreibt nicht nur, wie Unbewusstes unser Leben beeinflusst. Er erkennt auch die Wichtigkeit der Gefühle. Die Soziologin Eva Illouz sieht in der Entdeckung der Gefühle durch die europäische Moderne gar eine „Errettung der modernen Seele“54. Gefühle waren immer vorhanden und haben als „emotionale Intelligenz“ das Leben und das Überleben des Menschen und auch die Kulturentwicklung des modernen Menschen mitgestaltet. Im abendländischen Kulturkreis aber hat Kognition über viele Jahrhunderte die Emotion dominiert. Ihre Bedeutung für menschliches Verhalten musste erst wieder neu entdeckt werden.
In „Thinking fast and slow“ oder in deutscher Übersetzung „Schnelles Denken, Langsames Denken“55 stellt sich der Psychologe und Nobelpreisträger Daniel Kahneman die Frage: Wie trifft ein Mensch seine Entscheidungen und wer oder was entscheidet unser Handeln? Das Fazit des Autors lautet: Menschliche Entscheidungen werden häufiger intuitiv, auch irrational getroffen, entspringen häufiger einem emotional ausgerichteten Bauchgefühl und weniger häufig einem rationalen Kalkül. Kahneman unterscheidet ein schnelles und langsames Denken oder ein „System 1“ und ein „System 2“. Das „schnelle Denken oder System 1“ „Lässt uns die Welt geordneter, einfacher, vorhersagbarer und kohärenter sehen, als sie es tatsächlich ist“. Schnelles Denken „zieht aus dürftigen Informationen weit-reichende Schlussfolgerungen“, arbeitet automatisch, an Gefühlen sich orientierend, ohne wesentliche Steuerung. Es ist in uns angelegt und äußert sich ohne persönliches Zutun. Dieses „schnelle Denken“, so der Bezug zur mentalen Evolution des Menschen, benutzt Phänomene, die früh schon das Überleben der Hominiden sichern mussten. Sie kannten nur zwei Gruppen von Gefühlen, die Sympathie oder Antipathie, Vertrauen oder Misstrauen, Zugehörigkeit oder Ausgrenzung, Liebe oder Hass bedeuten und schnelle Entscheidungen erzwingen mussten. „Schnelles Denken“ wird von Gefühlen ausgelöst, die entweder positive Zuwendung oder Ablehnung bedeuten. Das „langsame Denken“ oder „System 2“ aber „lenkt die Aufmerksamkeit“, konzentriert sich darauf „etwas zu raten, was nicht spontan geschieht“, gibt uns Menschen „Entscheidungs-macht und Freiheit“. System 2 ist langsam, ruft Erinnerungen ab und bringt sie mit Erfahrung und Wissen in Verbindung. Es handelt überlegt und rational.
In eindrucksvoller Ausführlichkeit analysiert Kahneman wie beide Systeme sich beeinflussen, wie der Mensch auf Angst machende- oder freudvolle Überraschungen reagiert, wie „Verzerrungen“ des abwägenden Systems 2 durch spontane Aktionen von System 1 entstehen, wie „Ähnlichkeiten“ zu vorschnellen Schlüssen führen, wie „Glück“ zu „kognitiver Leichtigkeit“ verführt, wie der „priming effect“ aktueller Erlebnisse das abwägende Denken blockiert, obwohl der Zugriff auf weitere Informationen für rationale Entscheidungen wichtig wäre. Nach seiner umfangreichen psychologischen Analyse von menschlichen Entscheidungen lautet das Fazit des Autors: „Der größte Teil dessen was System 2 denkt und tut, geht aus System 1 hervor, aber System 2 übernimmt, sobald es schwierig wird und es hat normalerweise das letzte Wort“. Kahnemans Entscheidung ist eindeutig: Er fordert die rationale Kontrolle des schnellen Denksystems 1 durch das langsamere Denksystem 2. Er fordert die kognitive Überwachung für emotionales Agieren.
Eine ähnliche Analyse finde ich im Buch des amerikanischen Sozialphilosophen J.R. Searle mit dem Titel: „Wie wir die soziale Welt machen“56. Searle unterscheidet wiederum zwei Formen von „Intentionalität“, mit welchen wir „die soziale Welt machen“. Was immer wir fühlen, denken, erinnern, tun oder wünschen und hoffen ist auf Gegenstände, auf Sachverhalte, auf Ereignisse, aber auch auf Hoffnungen und Wünsche ausgerichtet. „Intentionalität ist unerlässlich, um das menschliche Verhalten, das gesellschaftliche Verhalten und die soziale Realität zu verstehen“. Die „Passrichtung“ von Intentionalität aber ist gegensinnig: Was wir wahrnehmen oder erinnern, wovon wir überzeugt sind, orientiert sich an Sachverhalten oder Gegenständen. Der entstehende „Geist oder der Gedanke richtet sich nach der Welt“, in welcher wir leben. Die „Passrichtung ist Geist nach Welt“. Ein sich an der realen Welt orientierender Gedanke oder eine Intention kann „wahr oder falsch“ sein, weil wir uns an Gegebenem orientieren. Wenn meine Intentionen aber zum Inhalt haben, wie ich die Welt gerne hätte, was ich beabsichtige oder plane, erhoffe und wünsche, wird die Situation eine andere sein: „ich“ allein beabsichtige oder „ich“ wünsche etwas. Wenn wir uns aus der realen Welt entfernen, in eine subjektive gedankliche Welt flüchten und versuchen diese nach unseren Wünschen oder Glaubensinhalten auszu-richten, so wird die „Passrichtung“ jetzt zu „Welt nach Geist“.. Wir wollen verändern und sind auch kreativ, doch „wahr und falsch“ sind jetzt keine allseits akzeptierten Kriterien der Unterscheidung mehr. Jetzt wird subjektiv entschieden: „Welt nach Geist Intentionen“ entspringen subjektiven Vorstellungen und sind nicht beweisbar.
Betont Kahneman die rationale Kontrolle des schnellen- und von Gefühlen gelenkten Denkens durch das langsame Denken, so lenkt Searle unseren Blick auf eine andere Möglichkeit der Täuschung. „Welt nach Geist-Intentionen“ sind für Searle immer subjektive Konstrukte. Sie sind nicht beweisbar. Um als „wahr oder falsch“ erkannt oder akzeptiert zu werden brauchen subjektive „Welt nach Geist“-Intentionen die Kontrolle durch die reale Welt. „Geist nach Welt-Intentionen“ müssen weltfremde „Welt nach Geist- Intentionen“ oder „verrückte“ Gedanken korrigieren, so diese Akzeptanz finden sollen. Auch rationale Gedanken des langsamen Denksystems nach Kahneman können sehr „abstrakt“ oder gar „verrückt“ sein. Sie benötigen die Korrektur durch reale Erfahrungen.
Kahnemans Erfahrungen mit seinen Denksystemen 1 und 2 und Searles Erfahrungen mit Intentionalität münden beide in einen Kompromiss ihrer Systeme. Unterschiedlich gewichtet empfehlen beide Autoren die gegenseitige Kontrolle ihrer mentalen Systeme: Bei Kahneman muss Rationalität das von Gefühlen gelenkte Denken oder Handeln kontrollieren. Bei Searle brauchen subjektive- oder weltferne Konstrukte die Kontrolle durch Erfahrung und Gefühle. Offenbar ist der Mensch gut beraten, wenn er auf emotionale und kognitive Intelligenz baut und beide sich gegenseitig korrigieren.
Introspektion oder Extrospektion?
Eine dritte Antwort für den Umgang des Menschen mit Denken und Intentionalität kann auch bedeuten, dass ein früher aufgekommenes mentales Erbe vom später hinzu gekommenen Erbe nicht nur korrigiert sondern beherrscht wird. Das später entwickelte kognitive Erbe wird dominant und macht aus Gefühlen Phänomene, die verdrängt, gemieden oder vernachlässigt werden.
Schließlich hat das divergent ausgerichtete mentale Erbe für den Menschen eine weitere Entscheidungsebene geschaffen. Für den Hominiden oder Steinzeitmenschen stand fest: Ich gehöre zu meiner Gruppe und mache, was der Gruppe dient. Mit der schöpferischen Intelligenz als Sapiens-Erbe sieht sich der Mensch mit einer neuen Frage konfrontiert: Soll ich meine kognitive- oder rationale Intelligenz „introspektiv“ einsetzen? Soll sie mich als Mensch in meinem Umfeld stärken, indem ich etwa das Gefühl von Fremdheit oder Bedrohung einer rationalen Kontrolle unterziehe und abbaue? Oder soll ich „extro-spektiv“ das Umfeld verändern, indem ich gegen Bedrohungen Mauern aufrichte, die mir hinter der Mauer ein akzeptables Leben ermöglichen? Der Mensch muss sich zwischen Introspektion und Extrospektion entscheiden. Mit „Introspektion“ verändert sich der Mensch und passt sich an. Mit „Extrospektion“ verändert der Mensch sein Umfeld und schafft sich eine ihm genehme Welt. Wer wie die Hominiden sein Umfeld als Heimat erfährt, mit der, in der und von der er lebt, wird seine Entscheidung auf Gefahrenerkennung und Gefahrenvermeidung ausrichten. Was immer er entscheidet ist an ihn selbst gerichtet und verändert die Person. Wer sich, wie der Sapiens-Mensch in eine gedankliche Innenwelt zurückzieht entfernt sich aus der realen Welt und macht sie zum gedanklichen Objekt seiner Spekulation. Er verändert, schafft um sich Kultur und ein auf ihn zugeschnittenes Umfeld. In der bio-logischen Evolution passt sich ein evolutionärer Akteur seinem Umfeld an, so er überleben will. Mit dem kognitiven Sapiens-Erbe aber hat sich diese Selbst-verständlichkeit verändert. Auch der moderne Mensch kann sich zwar noch für „Introspektion“ und Selbst-anpassung entscheiden, ein Gewissen formen und sein in der Welt Sein stärken. Er kann aber auch durch „Extro-spektion“ das Umfeld verändern, sich die Welt gefügig gestalten und das Umfeld menschlichen Wünschen und Vorstellungen anpassen.
Читать дальше