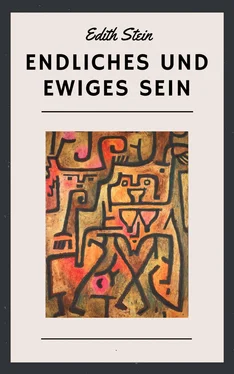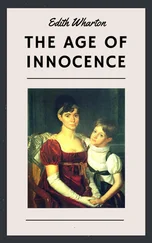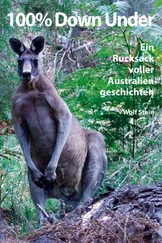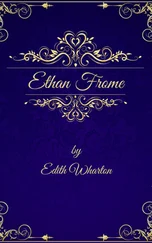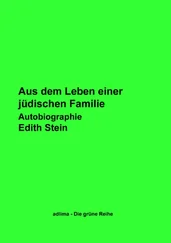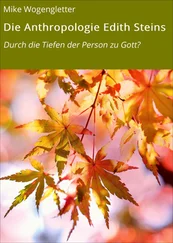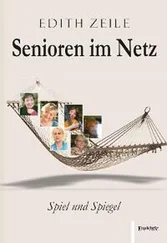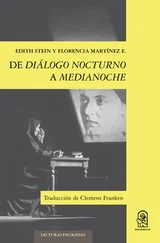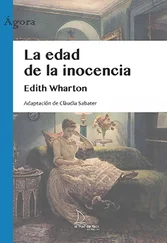Die Erlebnis-Wesenheiten sind keine Erlebnisse, sie sind für die Erlebniseinheiten vorausgesetzt. Welcher Art ist ihr Sein? Es ist kein Werden und Vergehen wie das der Erlebnisse, auch keine von Augenblick zu Augenblick neu empfangene Lebendigkeit wie das des Ich. Es ist ein wandelloses und zeitloses Sein. Also das ewige Sein des ersten Seienden? In der Tat beschreibt Plato das Sein seiner »Ideen« mit denselben Ausdrücken, die später von den christlichen Philosophen für die Schilderung des göttlichen Seins verwendet wurden, und auch Aristoteles ist zu keiner klaren Scheidung zwischen dem göttlichen Sein und dem der unveränderlichen Wesen (dabei dachte er allerdings nicht an die Ideen, sondern an Geistwesen) gelangt. Erst die christlichen Denker haben sich darum bemüht, beides zu trennen und das wechselseitige Verhältnis zu ergründen. Tatsächlich ist ein großer Unterschied zwischen dem ersten Sein, in dem wir den Urheber alles andern Seins sehen, und dem Sein der Wesenheiten. Das erste Sein ist das vollendete, und das heißt nicht nur: das wandellose, das nicht wird und vergeht, sondern das unendliche und alle Fülle und Lebendigkeit in sich schließende. In dieser Weise vollendet ist das Sein der Wesenheiten nicht. Sein Vorzug vor dem der wirklichen Erlebniseinheiten ist, daß es, der Zeit enthoben, auf gleicher Höhe wandellos beharrend und ruhend ist. Aber es ist kein »lebendiges«, sondern erscheint als ein totes und starres, wenn man die einzelne Sinneseinheit als begrenzte und für sich bestehende nimmt. Das ist der Einwand, der schon gegen die platonische Ideenlehre erhoben wurde. Wie kommt es zu ihrer »Verwirklichung« und zur »Teilnahme« an ihnen – was »bringt sie in Bewegung«? Daß in mir eine wirkliche Freude auflebt, das ist nicht der Wesenheit Freude zuzuschreiben, und daß ich lebe, nicht der Wesenheit Ich. Wir rühren hier an den Zusammenhang von Wirklichkeit und Wirksamkeit, der uns – sobald wir ihm nachgehen – einen neuen Sinn des Wortes »Akt« erschließen wird. Das Sein der begrenzten und gesonderten Wesenheiten ist unwirksames und darum auch unwirkliches Sein. Das erste Seiende aber ist daß ur-wirksame und ur-wirkliche. Das Sein der Wesenheit ist aber auch kein potenzielles, wenn wir darunter eine Vorstufe des wirklichen Seins verstehen. Wenn es auch nicht schlechthin vollendet, weil nicht alle Fülle des Seins in sich bergend, ist, so ist es doch auf seine Weise vollendet, weil es keine Steigerung über sich hinaus (ebensowenig eine Minderung) erfahren kann. Es ist Bedingung der Möglichkeit des wirklichen Seins und seiner Vorstufen, des aktuellen und des potenziellen. Die »Verwirklichung« der Wesenheit besagt nicht, daß sie wirklich wird, sondern daß etwas wirklich wird, was ihr entspricht. Die Möglichkeit des wirklichen Seins ist in ihrem Sein begründet. Darum ist es nicht etwa möglich, ihr unwirkliches Sein Nichtsein zu nennen. Was für ein anderes Bedingung des Seins ist, das muß selbst ein Sein haben. Ja, schon weil es etwas ist, muß es auch sein. Nur, was nichts ist, ist nicht. Aber welcher Art ist dieses Sein? Wir wollen es – im Gegensatz zum wirklichen – wesenhaftes nennen und uns vorläufig damit begnügen, es durch diesen Gegensatz zu kennzeichnen. Um es in seiner Eigenart zu fassen, wird es gut sein, zuvor die Wesenheiten noch gegen anderes abzugrenzen, was mit ihnen zusammenhängt, aber keineswegs mit ihnen gleichbedeutend ist.
§ 3. Wesenheit, Begriff und Wesen
Es wurde gesagt: Wesenheiten lassen sich nicht definieren. Was Freude ist, kann mir niemand begreiflich machen, wenn ich nicht selbst Freude erlebt habe. Habe ich aber Freude erlebt, dann verstehe ich auch, was »Freude überhaupt« ist. Indessen – finden wir nicht in den Lehrbüchern der Psychologie Definitionen der Freude? Und hat uns nicht der hl. Thomas eine sorgfältig ausgearbeitete »Affektenlehre« mit scharfen Begriffsbestimmungen und Einteilungen, Über- und Unterordnungen gegeben? Die Freude wird dort bestimmt als eine »Passion« des »Begehrungsvermögens«; durch ihren Gegenstand unterscheidet sich »die Freude, die einem Gut, von der Trauer, die einem Übel gilt«. Sie entspricht ferner einer bestimmten Stufe im Fortgang der Strebensbewegung: »der Genuß … geht zuerst eine gewisse Verbindung mit dem Strebenden ein, sofern er als ein ihm Gleiches oder Angemessenes aufgefaßt wird: und daraus ergibt sich die Passion der Liebe (amor), die nichts anderes ist als ein Geformtwerden des Strebens durch den Gegenstand des Strebens selbst; darum heißt die Liebe eine Vereinigung des Liebenden mit dem Geliebten. Das aber, was so in gewisser Weise verbunden ist, wird weiterhin begehrt …, damit die Verbindung realiter vollzogen werde, so daß der Liebende das Geliebte genießen könne; und so entsteht die Passion des Verlangens: hat man es aber wirklich erlangt, so erzeugt es die Freude. So ist also das erste in der Bewegung des Begehrens die Liebe, das Zweite das Verlangen, das Letzte die Freude …« Die Freude im engeren Sinne (laetitia) wird von einer Reihe ihr nahe verwandter Gemütszustände abgegrenzt: »… die einen besagen einen hohen Grad der Freude: diese Hochspannung aber ist entweder zu finden im Hinblick auf eine innere Verfassung (dispositio), und dann ist sie Freude, die eine innere Ausweitung des Herzens bedeutet; sie heißt nämlich »laetitia« gleichsam als »latitia«; oder im Hinblick darauf, daß die Hochspannung der inneren Fröhlichkeit (gaudium) sich in äußeren Zeichen Luft macht – dann ist es Frohlocken (exultatio); es heißt nämlich »exultatio«, sofern die innere Fröhlichkeit gewissermaßen nach außen hinausspringt (exterius exilit); dies Hinausspringen ist zu bemerken als eine Veränderung der Miene, worin – wegen ihres nahen Zusammenhanges mit der Einbildungskraft – zuerst die Anzeichen der Gemütsverfassung hervortreten, und dann ist es Heiterkeit (hilaritas); oder sofern man infolge der hochgespannten Fröhlichkeit auch zu Worten und Taten geneigt ist …, und dann ist es Aufgeräumtheit (iucunditas).«
Alles das sind sicherlich richtige, klärende und verdeutlichende Feststellungen; sie weisen der Freude ihre Stelle im Seelenleben zu, sie lehren sie von anderm unterscheiden, was mit ihr verwandt oder ihr entgegengesetzt ist, zeigen, unter welchen Bedingungen sie entsteht, welches ihre Begleiterscheinungen und Folgen sind, und schaffen damit eine wertvolle Grundlage für ihre richtige Einschätzung und praktische Behandlung. Aber gelten sie von der Wesenheit Freude? Zweifellos nicht. Die Wesenheit Freude ist kein seelischer Zustand, sie hat keine Grade, gibt sich nicht in leiblichen Ausdruckserscheinungen kund und treibt nicht zu Worten und Taten an. Man könnte sich fragen, ob es nicht zutreffe, daß sie auf das Gute bezogen und überhaupt auf einen Gegenstand gerichtet sei. Aber auch das wird man verneinen müssen. Es gilt von jeder Freude, aber nicht von der Wesenheit Freude. Es ist nicht das, was die Freude zur Freude macht. Also die Begriffsbestimmung, in die sich die Ausführungen des hl. Thomas zusammenfassen lassen, ist nicht die Bestimmung der Wesenheit. Sie kann es schon darum nicht sein, weil für das Verständnis all dieser Ausführungen bereits vorausgesetzt ist, daß man weiß, was Freude ist.
Was wird denn nun durch den Begriff bestimmt? Nicht die Wesenheit, aber auch nicht die einzelne erlebte Freude, jedenfalls nicht eine allein. Jede Freude ist auf etwas Gutes bezogen, jede hat eine bestimmte »Höhe«, jede drängt nach einem Ausdruck. Aber diese Freude ist auf dieses Gut bezogen und jene auf jenes. Die eine hat einen höheren, die andere einen minderen Grad. Der Begriff faßt zusammen, was aller Freude gemeinsam ist (sofern es bei der Bildung des Begriffes darauf abgesehen ist, alles zu erfassen, was Freude ist; an sich können Begriffe ja auch weniger allgemein, ja sogar auf ein Einzelding eingeschränkt sein). Für gewisse Zwecke kann es genügen, dabei nur einige Merkmale »herauszugreifen«, die es ermöglichen, alles, was Freude ist, gegenüber allem andern abzugrenzen. Will man aber auf die Frage antworten: Was ist die Freude? – und will man nicht nur irgendeine richtige Antwort geben (z. B.: »… ein Erlebnis«, oder: »… eine Gemütsbewegung«), sondern die sachlich erschöpfende Auskunft, die »Wesensdefinition«, so wird der Begriff alles enthalten müssen, was zum Wesen der Freude gehört. Dabei ist mit Wesen etwas bezeichnet, was weder mit der Wesenheit noch mit dem Begriff zusammenfällt.
Читать дальше