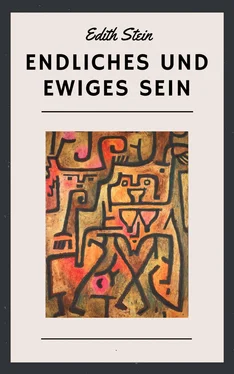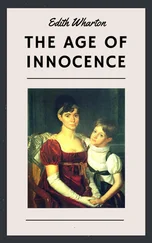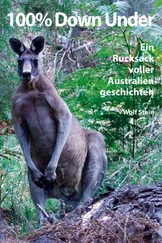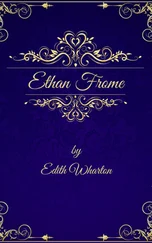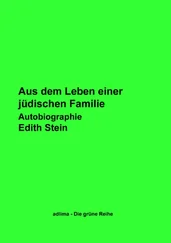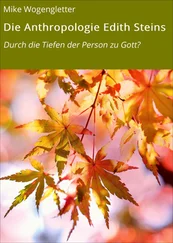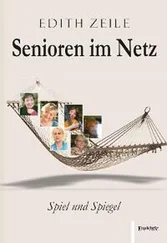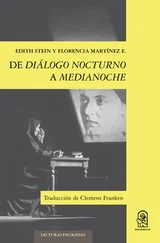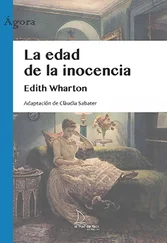Edith Stein - Edith Stein - Endliches und ewiges Sein
Здесь есть возможность читать онлайн «Edith Stein - Edith Stein - Endliches und ewiges Sein» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Edith Stein: Endliches und ewiges Sein
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Edith Stein: Endliches und ewiges Sein: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Edith Stein: Endliches und ewiges Sein»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Edith Stein (1891 – 1942) gilt als Brückenbauerin zwischen Glaubensrichtungen und Wertesystemen. Ihr Werk «Endliches und ewiges Sein» erschien erstmals 1937.
Edith Stein: Endliches und ewiges Sein — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Edith Stein: Endliches und ewiges Sein», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Hering hat folgenden »Hauptsatz vom Wesen« aufgestellt: »Jeder Gegenstand (welches seine Seinsart auch sein möge) hat ein und nur ein Wesen, welches als sein Wesen die Fülle der ihn konstituierenden Eigenart ausmacht. – Umgekehrt gilt – und dies besagt etwas Neues: Jedes Wesen ist seinem Wesen nach Wesen von etwas, und zwar Wesen von diesem und keinem andern Etwas.« Das Wesen ist also die »den Gegenstand ausmachende Eigenart«, »sein Bestand an wesentlichen Prädikabilien«. Hering bezeichnet es auch als Sosein (ποῖον εἶναι). Daß es Wesen von etwas ist, Eigenart eines Gegenstandes, kennzeichnet es als etwas Unselbständiges. Es ist das, wodurch das Was des Gegenstandes bestimmt ist (τὸ τί ἦν εἶναι). Darum ist ein »wesen-loser« Gegenstand undenkbar. Es wäre kein Gegenstand mehr, sondern nur noch die leere Form eines solchen.
In dem Rahmen, in dem wir unsere ersten Untersuchungen anstellten, dem Bereiche des Ichlebens, konnten wir es bisher vermeiden, von »Gegenständen« zu sprechen. Jetzt, da dieser Rahmen überschritten ist – wenn wir auch in diesem Bereich auf »Wesen« und »Wesenheiten« gestoßen sind, so ist doch schon jetzt deutlich, daß es so etwas nicht nur in diesem Bereich gibt, sondern im Bereich alles Seienden –, ist das nicht mehr möglich. »Gegenstand« kann einmal als das genommen werden, was dem erkennenden Geist entgegen- oder gegenübersteht. Dann ist es gleichbedeutend mit Etwas überhaupt: alles, was nicht nichts ist, was darum erkannt und wovon etwas ausgesagt werden kann. In diesem Sinn gibt es »selbständige« und »unselbständige« Gegenstände. So verstanden sind also auch »Erlebnis«, »Freude«, »Wesen« und »Wesenheiten« Gegenstände. Es kann aber auch bei Gegenstand vornehmlich an das Stehen und zwar an das gegen andere abgesonderte Stehen gedacht werden, an Selbständigkeit und Eigen-ständigkeit. Dann ist nicht jedes Etwas Gegenstand, sondern nur das, was in sich selbst Bestand hat, ein Sein in sich. In diesem Sinn sind »Dinge« und »Personen« Gegenstände, in gewisser Weise auch Zahlen und Begriffe; Eigenschaften und Erlebnisse aber sind keine, und auch Wesen nicht.
Wenn es im »Hauptsatz vom Wesen« hieß, daß jeder Gegenstand ein Wesen habe, so waren nicht nur Gegenstände im engeren Sinne des Wortes gemeint. Auch Eigenschaften und Erlebnisse haben ein Wesen, ja es muß auch vom Wesen des Wesens gesprochen werden. Jedes Ding hat sein Wesen. Ist es ein Einzelding (Individuum) – dieser Mensch oder diese meine Freude –, so ist auch sein Wesen ein Individuum. »Zwei völlig gleiche (individuelle) Objekte haben zwei völlig gleiche Wesen aber nicht identisch dasselbe; von zwei gleichen Blumen, zwei kongruenten Dreiecken hat eben jedes sein Wesen«. Zum Wesen dieses Menschen gehört es, daß er leicht aufbraust und leicht wieder versöhnt ist, daß er die Musik liebt und gern Menschen um sich sieht. Es gehört nicht zu seinem Wesen, daß er eben jetzt über die Straße geht und daß er vom Regen überrascht wird. Auch vom Wesen des Menschen kann und muß gesprochen werden. Zum Wesen des Menschen gehört es, daß er Leib und Seele hat, vernunftbegabt und frei ist. Es gehört nicht zu seinem Wesen, daß er weiße Haut oder blaue Augen hat, daß er in einer Großstadt geboren wird, an einem Kriege teilnimmt oder an einer ansteckenden Krankheit stirbt. Das Wesen umfaßt also nicht alles, was von einem Gegenstand ausgesagt werden kann. Es gibt »wesentliche« und »unwesentliche Eigenschaften«; und zu dem, was und wie er ist, kommt das, was mit ihm geschieht: sein Schicksal, d. i. sein Tun und Leiden (ποιεῖν καὶ πάσχειν), seine Beziehung zu anderen, seine Raum- und Zeitbestimmtheit. Nur was auf die Fragen: was ist der Gegenstand? und wie ist er? antwortet (und nicht all das, sondern nur ein Teil davon), gehört zum Wesen. Andererseits ist nicht alles, was nicht zum Wesen gehört, »zufällig«, sondern manches ist im Wesen begründet. (Der Sinn des »Zufälligen« bestimmt sich als »nicht im Wesen begründet«.) Daß Napoleon den Feldzug nach Rußland unternahm, gehört nicht zu seinem Wesen, aber es ist in seinem Wesen begründet. Unter dem, was im Wesen gründet, ist manches – aber wiederum nicht alles –, was notwendig daraus folgt. So ist jenes Unternehmen Napoleons in seinem Wesen als möglich vorgezeichnet, es ist daraus verständlich, aber wir können es nicht als notwendig daraus folgend bezeichnen: es ist nicht undenkbar, daß er sich anders entschlossen hätte. Dagegen folgt aus dem Wesen des Quadrats notwendig, daß sein Flächeninhalt größer ist als das eines gleichseitigen Dreiecks von gleicher Seitenlänge. Es ist unmöglich, daß es anders wäre. Es folgt aus seinem Wesen und gehört nicht dazu, weil zu seinem Wesen überhaupt keine Beziehung zu einem andern Gegenstand gehört. Dagegen gehört es zu seinem Wesen, daß es vier gleiche Seiten hat.
Das sind nur einige andeutende und unzureichende Aussagen über das Wesen, aber sie genügen, um seine Verschiedenheit vom Begriff und von der Wesenheit zu erkennen. Der Begriff wird gebildet, um den Gegenstand zu bestimmen. Das Wesen wird am Gegenstand aufgefunden. Es ist unserer Willkür gänzlich entzogen. Das Wesen gehört zum Gegenstand, der Begriff ist ein von ihm getrenntes Gebilde, das auf ihn »bezogen« ist, ihn »meint«. Die Begriffsbildung hat die Wesenserfassung zur Voraussetzung. Sie schöpft daraus.
Auch von der Wesenheit ist das Wesen dadurch unterschieden, daß es zum Gegenstand gehört, während die Wesenheit im Verhältnis zum Gegenstand etwas Selbständiges ist. Wir sprechen von der »Wesenheit Freude«, aber vom »Wesen der Freude«. Das Wesen zeigt einen Aufbau aus Wesenszügen, die sich am Wesen zur Abhebung bringen und begrifflich fassen lassen. Das Wesen ist das, was begrifflich faßbar und wodurch der Gegenstand faßbar und bestimmbar wird.
§ 4. Das Wesen und sein Gegenstand; Wesen, »volles Was und Wesenswas« Wesensveränderung und Wesenswandel
Um über die Seinsweise des Wesens etwas sagen zu können, müssen wir das Verhältnis des Wesens zum Gegenstand, dessen Wesen es ist, noch näher betrachten. Wir können vom Wesen dieser meiner Freude sprechen und vom Wesen der Freude. Das sind verschiedene Gegenstände und verschiedene Wesen. »Diese meine Freude« ist mein gegenwärtiges Erlebnis, etwas Einmaliges, zeitlich Festgelegtes und Begrenztes, mir und keinem anderen Zugehöriges. Wenn sie vorüber ist und wenn ich sie mir wieder »vergegenwärtige«, so ist diese Vergegenwärtigung nicht dasselbe wie das, was ich jetzt erlebe, sondern ein neues Erlebnis, wenn auch mit einem beiden gemeinsamen Gehalt. Eben dieser gemeinsame Gehalt – vorausgesetzt, daß nichts von dem gegenwärtig Erlebten verloren gegangen ist, daß ich Zug um Zug in der Erinnerung das Vergangene wiederaufleben lassen kann, was natürlich ein idealer Grenzfall ist – ist das volle Was dieser meiner Freude, während das »Gegenwärtigsein« oder »Vergangensein« ihre Seinsweisen sind. Zu diesem vollen Was gehört, daß sie Freude an der eben erhaltenen Nachricht ist, daß sie lebhaft ist, daß sie lange anhält. Es gehört nicht dazu, daß ich gleichzeitig ein Geräusch von der Straße höre. Es gehört auch nicht dazu, aber es folgt daraus, daß ich nun »vor Freude« nicht mehr so gut arbeiten kann wie vorher. Vor allem gehört natürlich dazu, daß es Freude ist, eine Verwirklichung der Wesenheit Freude. Fällt das »volle Was« mit dem Wesen dieser meiner Freude zusammen? Das können wir nicht sagen. Vielmehr ist hier noch eine doppelte Unterscheidung zu treffen: 1. Wenn wir Wesen als ποῖον εἶναι oder τί εἶναι fassen, so ist es nicht das Was, sondern das Wassein (bzw. Sosein) oder die Wasbestimmtheit. 2. Zum vollen Wassein (in das wir alles ποῖον εἶναι eingeschlossen denken) gehört auch, wie groß die Freude ist. Aber die Freude kann wachsen, sie kann stärker, reicher und tiefer werden und ist doch noch »diese meine Freude«, dieselbe wie vorher – anders, aber keine andere geworden. Das volle Wassein ist ein anderes, aber das Wesen nicht. Zum Wesen des Gegenstandes gehört alles das und nur das, was erhalten bleiben muß, damit es noch »dieser Gegenstand« bleibt. Natürlich ist diese meine Freude nicht mehr vorhanden, wenn ich keine Freude mehr spüre. Wenn ich die Nachricht einem andern Menschen mitteile und wenn er dann von einer gleichen Freude erfüllt wird, so ist das eine andere als meine. Es gehört also auch zum Wesen dieser Freude, wessen Freude es ist. Und – wie schon früher gesagt wurde – es bleibt nicht dieselbe, wenn es nicht mehr Freude am selben Gegenstand ist. Der Unterschied zwischen dem vollen Wassein und dem Wesen besteht nur dort, wo ein Gegenstand, dessen Sein sich »über eine Dauer erstreckt« – d. h. der Zeit braucht, um fortlaufend zum Sein zu gelangen –, während dieser Dauer Veränderungen unterliegt. Das gilt für alle Gegenstände, deren Sein ein »Werden und Vergehen ist«. Dahin gehören – wie wir schon festgestellt haben – alle Erlebniseinheiten, es gehört dazu aber auch die gesamte Welt der sinnenfälligen Dinge, die Natur. Er besteht nicht bei Zahlen, bei reinen geometrischen Gebilden, bei reinen Farben und Tönen, bei all dem, was man – im Gegensatz zu den »realen« – als »ideale« Gegenstände bezeichnet. Bei ihnen fallen Wassein und Wesen zusammen. In der Welt des Werdens und Vergehens aber ist in dem, was ein Gegenstand jeweils ist, ein fester und ein wechselnder Bestand zu unterscheiden. Der feste Bestand ist das, was wir als das Wesenswas bezeichnen können. Damit ist nicht gesagt, daß das Wesen selbst jeglichem Wandel entzogen sei. Bei einem Menschen sehen wir den »Charakter« als das Bleibende und Feste an, woran wir uns zu halten haben und was uns den Schlüssel zum Verständnis seines wechselnden Erscheinens und Gehabens gibt. Es kommt aber vor, daß so ein Schlüssel plötzlich versagt, nachdem er sich lange Zeit bewährt hat. Der Mensch erscheint uns »wie ausgewechselt«. Es ist keineswegs gesagt, daß wir uns bisher in ihm getäuscht haben. Er kann wirklich »umgewandelt« sein, und sobald wir den neuen Schlüssel entdeckt haben, finden wir uns wieder zurecht. Der Mensch ist noch derselbe, das Wesen aber ist – »verändert« oder »ein anderes«? Das ist nun die Frage. In der Tat scheint mir beides möglich. Von »Veränderung« des Wesens wird man sprechen, wenn nacheinander einzelne Züge des Wesensbildes sich wandeln und so allmählich ein verändertes Gesamtbild entsteht, wie es bei der Entwicklung des Kindes zum Jüngling und des Jünglings zum Mann der Fall ist. Es bleibt dann doch in dem veränderten Gesamtbild ein Grundbestand des früheren. Und das kann auch bei plötzlichen »Bekehrungen«, bei der »Umwandlung des Saulus in einen Paulus«, der Fall sein. Der Eiferer für das mosaische Gesetz ist ja in dem »Gefesselten Jesu Christi« (Eph 3, 1), der im Dienst des Evangeliums sich völlig aufzehrt, noch deutlich wiederzuerkennen, wenn auch die unerbittliche Härte des Kämpfers einer sich selbst verschwendenden Güte gewichen ist und die Starrheit der Gesetzestreue der leichtbeweglichen Lenkbarkeit gegenüber dem leisen Hauch des Heiligen Geistes. Dagegen sind aber auch Fälle möglich, wo kein Bleibendes im Wechsel mehr festzustellen ist. Dann ist es angemessen zu sagen, daß das Wesen »ein anderes«, nicht »verändert« sei. Wenn trotzdem der Mensch noch als »derselbe« anzusprechen ist, so liegt das daran, daß vom Wesen noch sein »Träger« zu unterscheiden ist, dem erst das eine und dann das andere Wesenswas zukommen kann. Wo das Wesen nicht »verändert«, sondern »ein anderes« geworden ist, wollen wir nicht von »Veränderung«, sondern von »Wandel« und »Verwandlung« (Wandel des Wesens – Verwandlung des Gegenstandes) sprechen.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Edith Stein: Endliches und ewiges Sein»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Edith Stein: Endliches und ewiges Sein» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Edith Stein: Endliches und ewiges Sein» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.