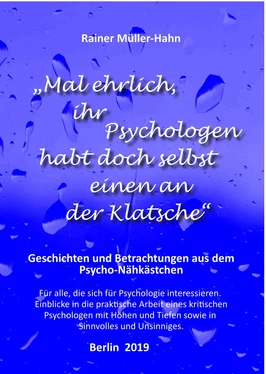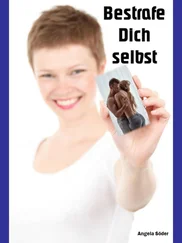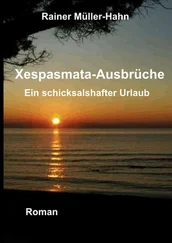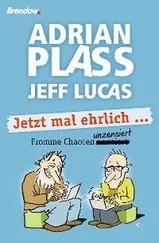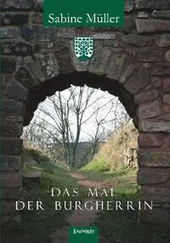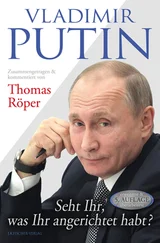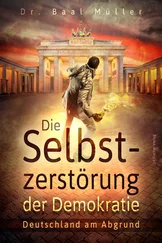Ein Chinese trägt auf der Straße Gedichte und Tänze vor. Ich bin davon sehr ergriffen. Er ist alt, hat eine Glatze und einen Fadenbart.
Ganz schön verrückt, nicht wahr? Was diese Träume zu bedeuten hatten, weiß ich nicht mehr. Einige betrafen das Studium und die Prüfungen, sicher auch die Therapie, wenn ich für die beschädigte Vorderachse meines Autos ein Ersatzteil aus dem Schrott suchte. Meine Minderwertigkeitsgefühle werden wohl im Schrumpfungsprozess bei Tisch sichtbar, und die Mäuse weisen wahrscheinlich auf geldliche Dinge hin. Ebenso ist das Thema Partnerschaft und Sexualität stark vertreten. Aber mit welchen anderen Problemen oder Lebensfragen sollte ich mich sonst befassen? In der Therapie habe ich gelernt, die einzelnen Traumbilder zu entschlüsseln. Das geschieht nicht mittels einfacher formelhafter Zuordnung, wie ich sie gerade vorgenommen habe, also Mäuse gleich Geld, Löwe gleich Prüfer, Peitsche, die nicht knallt, gleich Unfähigkeit und so weiter. Die Traumbilder und -symbole sind Ausgangspunkt zu gedanklichen Assoziationen, also spontanen Einfällen, Erinnerungen an reale Erlebnisse und Gefühle aus früherer oder der letzten Zeit - sogenannte Tagesreste. Man deutet sie im Wesentlichen selbst und entdeckt dabei unterschiedliche Erlebnis-, Problem- und Zeitebenen, die in einem Traumbild verdichtet sind.
Was wir nachts in unserem Kopf veranstalten, ist offenbar eine komplizierte, kreative und hochintelligente Verschlüsselungsleistung. Ich habe übrigens sehr schnell gelernt, meine Träume im Gedächtnis zu behalten, die im nächtlichen Heimkino zur Aufführung kamen.
Irgendwann kam mir der Gedanke, ob ich diese wirren Filme als Autor, Regisseur und Schauspieler speziell für die Therapie produzierte? Vielleicht wollte ich meiner Therapeutin etwas Spannendes und Kniffliges anbieten? Diese Frage wird wohl unbeantwortet bleiben müssen.
Ende der Therapie
Irgendwann war es genug. Meine Therapie entwickelte sich zu einem übergeordneten Zweitleben. Mehr und mehr durchdrang sie meinen Alltag, den sie allmählich zu zersetzen und zu ersetzen drohte. Sie nahm große Bereiche meines Bewusstseins in Beschlag, sog Aufmerksamkeit auf und lähmte Spontaneität. Es war, als würde das Verhalten und Erleben von einer höheren Warte genau überwacht werden. Ich fühlte mich dabei wie ein Gefangener beim Hofgang, der weiß, dass er beobachtet wird, bei allem was er tut, der aber auch gleichzeitig der beobachtende Posten auf dem Wachturm ist. Ich fühlte mich mehr und mehr von mir selbst eingeschränkt und kontrolliert. Außerdem begann ich, anstehende Handlungen und Entscheidungen in die Therapie zu tragen und dort zu besprechen. Das war zwar bequem, aber es brachte eine zunehmende Abhängigkeit mit sich. Auch heute treffe ich gelegentlich Menschen an, die meinen, vor jeder Entscheidung zuerst mit ihrem Therapeuten reden zu müssen. Ich wollte damals zurück in ein normales Leben. Dabei war eines sicher: Ich allein musste entscheiden, ob ich noch therapiebedürftig war oder nicht. Dies wollte ich nicht der Krankenkasse überlassen.
Den äußeren Auslöser für die Beendigung der Therapie bildete ein ganz banales Ereignis während der Therapiestunde. Es veränderte entscheidend die Rolle der Therapeutin und meine eigene. Danach gab es keine Therapeutin und auch keinen Patienten mehr. Was war geschehen? An der Wand, auf die ich im Liegen immer blickte, kroch eine ziemlich große Spinne langsam empor. Hinter mir spürte ich Unruhe und fragte die Therapeutin, ob sie die Spinne sehen würde. Ich bekam ein beunruhigtes „Ja“ als Antwort und die Bitte, die Spinne wegzumachen. Ich erlebte nun so etwas wie Genugtuung, dass sich bei dieser schweigsamen, unnahbaren Dame so etwas wie menschliche Züge zeigten. Ihrem Wunsch folgend stand ich auf, nahm die Spinne mit einem Taschentuch von der Wand, öffnete das Fenster und warf sie hinaus. Nach getaner Arbeit grinste ich meine Therapeutin ein wenig spöttisch an und schlug ihr vor, dass sie sich mal um ihre Spinnenphobie kümmern solle. Sie sagte nichts, sondern lächelte dankbar und verlegen zurück. In diesem Moment schien ein Bann gebrochen. Unsere Beziehung hatte sich plötzlich verändert. Unterwartet hielt ich das Heft des Handelns in der Hand, begegnete ihr nicht nur auf Augenhöhe, sondern fühlte mich in diesem Moment ihr überlegen. Spontan wurde mir klar, dass das der Zeitpunkt war, die Therapie zu beenden. Deshalb legte ich mich nicht mehr auf die Couch zurück, sondern sagte, dass ich bei dieser Gelegenheit die Therapie beenden wolle. Sie reagierte darauf gelassen, sehr freundlich und auch verständnisvoll. Offensichtlich hatte sie den Beweggrund meines Entschlusses verstanden. Ich bedankte und verabschiedete mich von ihr. Drei oder vier Stunden, die mir noch von der Krankenkasse zugestanden hätten, nahm ich nicht mehr in Anspruch. Ich fühlte mich befreit.
Kommentar
Schon während der Behandlung begann ich, mein Verhalten zu verändern. Ich wollte es mir, den anderen und wahrscheinlich auch der Therapeutin beweisen, dass ich dazu in der Lage war. Ich hatte einen Verhaltensgrundsatz gebildet, der auch heute noch gilt: Tue das, wovor du Angst hast, nur so kannst du dieser Angst Herr werden. Im privaten Bereich gelang es mir, mich von meiner langjährigen Freundin zu trennen. Es bestand nur noch ein liebloses, klebriges Verhältnis, dessen Fortbestehen weniger aus Zuneigung, sondern aus der Angst vor Einsamkeit gespeist wurde. Aus Mitleid und schlechtem Gewissen hatte ich es vorher nicht zu beenden gewagt. Außerdem zog ich von zu Hause aus in eine eigene Wohnung. Auch im Studium wandte ich dieses Prinzip erfolgreich an: Zunächst diskutierte ich mit meinen Studienkollegen offensiver, begann Referate öffentlich zu halten, führte mit einem jungen Mann im Rahmen einer realen Erziehungsberatung ein Untersuchungsgespräch, das direkt in den Hörsaal zu den übrigen Studenten und Lehrkräften übertragen wurde. Schließlich bestand ich Klausuren, erwarb die notwendigen Leistungsnachweise und fand Anerkennung bei Dozenten und Kommilitonen. In der unruhigen Zeit der Studentenproteste kandidierte ich als studentischer Institutssprecher und wurde gewählt. Ich hatte Versammlungen zu moderieren und setzte mich auf institutspolitischer Ebene öffentlich mit dem Institutsdirektor, den Dozenten und Kommilitonen auseinander. Das funktionierte erstaunlich gut, nachdem ich das Knieschlottern auf dem Weg zum Podium überwunden und den Frosch im Hals verschluckt hatte. Je öfter sich diese Situation wiederholte, desto leichter fiel es mir, meine Unsicherheit einzudämmen. Mein früheres, hinderliches Lampenfieber wandelte sich nach und nach zu einer angenehmen Empfindung, zu einem spannungsvollen Kribbeln, das mir bis heute treu geblieben ist.
Plötzlich hatte ich es eilig, mich vom Studienbetrieb zu verabschieden. Ich hatte die Nase voll, zumal eine interessante Arbeitsmöglichkeit in Aussicht stand. Das Mehr an Semestern, das ich wegen meiner Unsicherheit bis dahin benötigt hatte, konnte ich im zweiten Studienabschnitt nahezu ausgleichen und stellte mich nach etwas mehr als der vorgeschriebenen Mindestanzahl an Semestern der Diplomprüfung, die ich mit gutem Ergebnis bestand.
Bis dahin war mein Werdegang eine Erfolgsgeschichte. War die Therapie dafür verantwortlich? Und wenn sie es war, was genau hatte sie bewirkt?
Die Psychotherapie in Anspruch zu nehmen, erforderte zunächst mein nachdrückliches Bekenntnis zur eigenen Unzulänglichkeit. Zusätzlich fühlte ich mich durch das Arrangement der Behandlung entmündigt und gedemütigt. Ich musste eine zwischenmenschlich groteske, einseitige Kommunikationssituation akzeptieren und mich starren Regeln unterwerfen. Es war, als hätte man mir ein zusätzliches schweres Gewicht auf den Rücken gelegt und es mich mit der Begründung schleppen lassen, dass es für mein Wohlbefinden gut und hilfreich sei.
Читать дальше