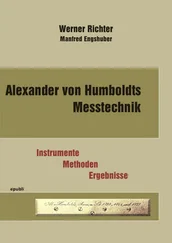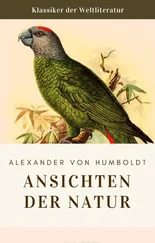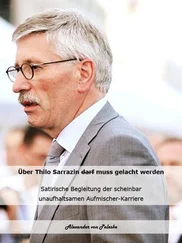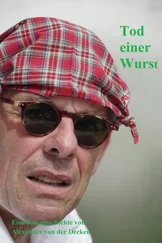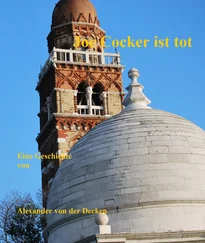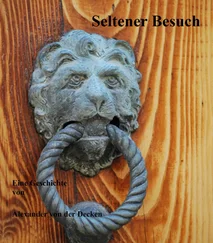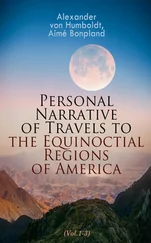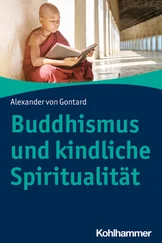Marie L. (etwas boshaft nach dieser grundsätzlichen Selbsterklärung) : Und dann kam Paul Z.
Walter F.: Ja, dann kam Paul. Und der ließ sich nicht gängeln, war witzig, frech – und hatte Macht. Und konnte meistens die Zensur überzeugen, wenn es Gabi betraf.
Marie L.: Vielleicht hast du dir das alles von Paul gefallen lassen oder es zumindest hingenommen, weil du ihn gerade wegen der Eigenschaften schätztest, die auch Gabi an ihm bewunderte und bei Dir vermisste.
Walter F. (schaute mich an) : Ja, das stimmt wohl, leider. Du gehst ja heute ganz schön ran.
Ich stand auf, stellte mich hinter ihn und massierte seinen Nacken .): Du hast recht. Entschuldige. (Ich küsste sein linkes Ohr)
Günther Y.’s Bericht über Walter Friedrichsens und Marie Lentes „feindliche Aktivitäten“ von Ende Januar 1989
Die Wanzen im Schlafzimmer erwiesen sich wieder einmal als hilfreich. Langsam gewann ich den Eindruck, dass sich Walter F. zu einem feindlichen Element entwickelte. Ich dachte, dass ich seinen Führungsoffizier informieren müsste, damit er ihm mal ein bisschen Druck macht. Das tat ich auch.
Es stellte sich nämlich heraus, dass er nicht nur vom MfS als Geheimpolizei bzw. vom Genossen Mielke als obersten Geheimpolizisten sprach, sondern dass er meinte, die DDR sei gescheitert. Und das hat er laut und deutlich gegenüber einer westdeutschen Wissenschaftlerin gesagt. Die DDR sei gescheitert und er mit ihr, erklärte er ihr, nachdem sie ziemlich lange und zärtlich miteinander gekuschelt hatten. Warum? Weil, wie er wahrhaftig behauptete, die DDR verschuldet sei, die Wirtschaftspläne nur Makulatur und die Kombinate ohnehin ihren eigenen Markt entwickeln. Das empfinde ich als ziemlich weitgehend. Immerhin liegt die DDR an zehnter Stelle der Wirtschaftsmächte, manche sagen sogar an siebter Stelle.
Ich fertigte einen Bericht an, der genau dies wiedergibt. Diesen Bericht heftete ich nicht nur ab, sondern verschickte einen Durchschlag auch an den Genossen Oberst U., damit er sieht, was seine kleine westdeutsche Wissenschaftlerin so treibt, und auch an den Führungsoffizier von Walter F.
Jochen Eckebrecht (Antwortbrief von 2008 auf die Anfrage der Journalistin Barbara Köhler über die Geschichte von Marie Lente und Paul Z. von 1988/89)
Ich antworte Ihnen gerne, aber nicht auf Ihre Fragen. Sie hatten mir geschrieben, weil Sie von mir als einem früheren Freund von Marie eine besondere Sicht auf die Beziehung zwischen Marie und Paul Z. erwarten. Ich habe allerdings selbst schon vor einem Jahr meine eigene, eher literarische Fassung dieser Geschichte aufgeschrieben, die ich ja vor allem als eine ungewöhnliche Liebesgeschichte verstehe, die erst im Nachhinein politisch bedeutsam und öffentlich gemacht wurde.
Hier ist zumindest der Beginn meines Textes, der beschreibt, wie wir uns 1984 (!) kennenlernten, also Marie und ich. Bedenken Sie die Zeit und entschuldigen Sie meinen frech-offenen Ton.
Eigentlich ging ich nur noch selten ins Theater. Schon gar nicht in „Die Räuber“, die mich mit 17 Jahren das letzte Mal vom Hocker gerissen hatten. Aber, Schiller sei Dank, in der Pause drängelte ich mich an die Sektbar und traf dabei zum ersten Mal auf Marie, mit ihrem marzipanrosanen Teint, bedeckt mit einem schwarzen Jackenkleid für den feierlichen Schiller-Gang. Obere-Zehntausend-Tochter mit drahtig rotem Krusselhaar, dachte ich vollkommen daneben.
Ihre Marzipantöne verdunkelten sich, als sie meine Begeisterung über den rotzig-schwulen Ton der Inszenierung vernahm, den die Räuber durch die Kadetten in Frauenkleidung erhielten. Und ich war blödsinnig genug, auch noch eine Bemerkung über ihre Namenscousine als Transvestit zu machen. „Stellen Sie sich einmal ein Publikum vor hundert Jahren vor, im Abendkleid und Frack vor einer Bühne, auf der eine erhaben-reine Marie mit Männerstimme ‚Scheiße‘ schreit und anderen Kadetten in die Eier tritt.“
Sie schwieg erbittert. Ich kann das auch nicht leiden, sagte ihr Blick.
Ihre Laune änderte sich auch nicht, als wir uns nach der Pause auf zwei freie Plätze in der fünften Reihe setzten, aber immerhin, sie diskutierte mit mir über andere Peymann-Inszenierungen. Nach dem Stück stritt sie weiter, so intensiv, dass sie mich ins Hotel begleitete und einen Rotwein auf das Zimmer haben wollte. Ich weiß nicht, ob ihr Ärger ihren Wagemut beflügelte. Nein, das trifft es nicht. Ihr Genuss war mir ein Rätsel, er schien aus großer Tiefe, mühselig schmerzhaft emporzutauchen, als ob sie Liebe empfände. Das war rätselhaft, beeindruckend, kaum verstehbar, meiner Lust eine geradezu unangemessene Würde verleihend. Vielleicht können dies nur ihre späteren Liebhaber begreifen, wenn sie Ähnliches erlebt haben sollten. Und ich glaube, dass es Paul Z. so erging. Ihn vielleicht noch mehr erschütternd, weil er dem Tod näher war und um so vieles älter als sie.
So leicht begann es. Aber die Würmer krochen schon. Ich hatte mich wieder einmal vertan. Marie kam nicht aus besserem Hause, sondern war die Tochter eines rumäniendeutschen Einwanderer-Paares – er Bauarbeiter, sie Verkäuferin, er Säufer, sie um Wohlanständigkeit bemüht, er haute ab, sie schloss ihn aus. Marie litt bis heute, wenn sie nach Hause kam. Sie hatte jeglichen Kontakt mit dem prügelnden Papa abgebrochen.
Was meinst du, was ich für Klimmzüge machen musste, um dieses Milieu verlassen zu können, sagte sie. Mit ziemlichem Erfolg, antwortete ich. Immerhin bist du schon Professorin.
So weit so gut. Wer wusste damals schon, wie Deutschland sich entwickeln würde.
Irgendwann war es vorbei. Marie zog nach Berlin, um ihre Forschungen in der DDR zu beginnen. Ich sah sie erst nach anderthalb Jahren wieder. Und da war alles ganz anders.
Aber so begann es. Oder besser: So war sie damals noch.
Ein Brief von Jochen Eckebrecht an Marie Lente vom 21. Januar 1989 (von ihr 2009 an die Journalistin Barbara Köhler weiter geleitet).
Den beigefügten Brief von Jochen Eckebrecht habe ich in meiner Korrespondenz gefunden. Vielleicht interessiert er Sie:
Liebe Marie,
wir haben lange nichts voneinander gehört – von Deiner Seite aus ist es vermutlich ein gutes Zeichen. Ich finde es schade. Vielleicht ist mein folgender Bericht nur Ausdruck dessen, aber ich schicke ihn Dir trotzdem, weil er Dir hilfreich sein könnte.
Vor Weihnachten war ich in Berlin und traf auf einem Kongress die DDR-Kollegin S. Nach den Gesprächen mit ihr wurde ich das Gefühl nicht los, dass sich in der DDR etwas tut. Sie arbeitete selbst oder eine ihrer Studentinnen über Rechtsradikalismus in der DDR-Jugend. Ich glaubte meinen Ohren nicht zu trauen, als ich ihren Bericht hörte. Was mich erstaunte, war nicht nur der Rechtsradikalismus bei einem Teil der Jugendlichen der DDR, den sie beschrieb, sondern dass sie im Westen darüber sprach. Ich versuchte danach, mit ihr ins Gespräch zu kommen. Wir aßen zusammen, und dabei erzählte sie mir eine merkwürdige Geschichte. Johannes R. Becher, der Dir als der erste Vorsitzende des Kulturbundes natürlich kein Unbekannter ist, soll sich mit Ulbricht und anderen SED-Führern nicht nur über seine wenig kommunistische Definition des Revolutionärs angelegt haben, sondern auch über die Oder/Neiße-Grenze. Die sei auch in der DDR nicht unumstritten gewesen, sagte die Kollegin S., bei Becher ebenso wenig wie bei Grotewohl, wie dessen Redenschreiber 1946, der Nationalbolschewist Ernst Niekisch, bei der Vereinigung von SPD und KPD zur SED geschrieben habe. Becher habe sich auch darüber geärgert, dass jetzt die „gute alte deutsche Stadt Breslau“ polnisch geworden sei und er sie Wroclav nennen müsse.
Von Becher gibt es noch eine andere Geschichte. Er soll vermutlich Anfang der 1950er Jahre vor einem einschlägigen Homosexuellenlokal in West berlin erwischt worden sein, kaum zu glauben. Das sei vertuscht worden, aber er sei damit natürlich bei seinen Genossen unten durch gewesen und konnte unter Druck gesetzt werden.
Читать дальше