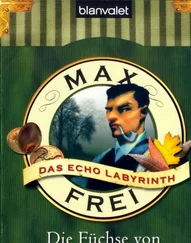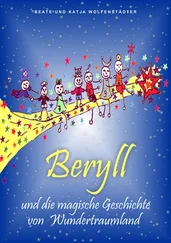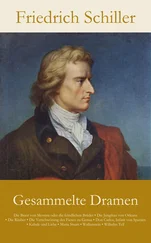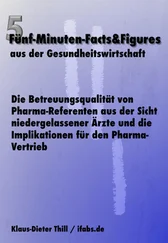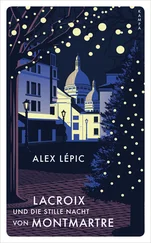Friedli richtete seine Aufmerksamkeit auf die vielen Personen, die auf verschiedenen Etagen in der Halle verteilt waren und allesamt jenen leeren Blick besassen, der ihm bereits zuvor beim Schichtwechsel aufgefallen war. Er vermutete, dass es nur noch eine Frage der Zeit war, bis hier auch der Arbeiter selbst zur Ware würde; zur Ware mit einem Wert und begrenzter Haltbarkeit. Vor seinem inneren Auge begannen diese Menschen allmählich zu verschwinden. Sie waren die Webstühle des 20. Jahrhunderts. Gerade als er diesen Gedanken dachte, sah er einen Mann, der ganz anders wirkte als der Rest. Es handelte sich um einen älteren Herrn mit flammendweissem Bart, der auf einer Treppe stand, die zum Plateau hochführte, von dem man Zugang zur grösseren der beiden Wannen hatte. Im Gegensatz zu den anderen Arbeitern, die verschwitzt und verschmutzt die sich fortwährend wiederholenden Bewegungen vollführten, stand der Alte einfach nur da. Er regte keines seiner Glieder, einzig die Lippen sprachen immer wieder dieselben Worte. Ihre Bedeutung konnte Friedli aus der Ferne nicht bestimmen. Auch wenn dieser Arbeiter keinen Wank ausführte, war er paradoxerweise der lebendigste unter ihnen. Friedli betrachtete ihn irritiert. In diesem Moment wandte der Alte seinen Kopf in seine Richtung und sie schauten einander direkt in die Augen. Friedli lief sogleich ein kalter Schauer den Rücken hinunter.
Aller Faszination für Maschinen, Schmieröl, Rauch, Dampf und Feuer zum Trotz war Friedli froh, als sie die Glasi wieder verliessen. Sidler gönnte ihm aber keine Erholung. Kaum an der frischen Luft setzte er den Weg tifig fort, kreuz und quer durch das Dorf, durch Strassen, Gassen und Quartiere, die nichts gemein hatten mit dem Quartier, in dem die Glashütte stand. Hier fühlte sich Friedli wieder wie in einem echten Dorf. Einem Dorf mit Tradition, einem Dorf, in dem jede Ecke und jedes Strassenschild, jeder lose Ziegelstein und jedes Mäuseloch eine Geschichte zu erzählen wusste. Nur der grosse Kamin der Glashütte, der die Dächer aller Gebäude überragte und deshalb, wie der Kirchturm, von jeder Stelle im Dorf aus gut zu sehen war, störte diese Idylle und mahnte daran, dass die Industrialisierung auch in Küssnacht Einzug gehalten hatte.
Die allermeisten Menschen, denen sie begegneten, grüssten freundlich. Eine gewisse Zurückhaltung war aber nichtsdestotrotz auszumachen. Friedli war sich sicher, dass die Zurückhaltung nichts mit dem Sidler oder dem blutigen Schnuderlumpen zu tun hatte, der ihm aus den Nasenlöchern hing. Er war es, der fremde Begleiter an seiner Seite, dem man kein bedingungsloses Vertrauen entgegenbrachte. Als er Sidler dazu befragte, erklärte dieser, dass man halt hier über lange Zeit abgekapselt von den grossen Zentren gelebt habe, und was man nicht kenne, dem begegne man mit Vorsicht. Dies sei an und für sich ja keine unvernünftige Haltung. Sidler gestand aber von sich aus ein, dass der Grat zwischen Schwarmintelligenz und Schwarmdummheit durchaus ein schmaler sei. Die Zurückhaltung der Schwyzer bedeute aber nicht, dass man hier nicht auch heimisch werden könne. In der Glasi beispielsweise, so berichtete er, würden rund ein Dutzend Auswärtige arbeiten, Italiener, Spanier, Deutsche. Sie wären auch mit Mistgabeln und Gewehrfeuer nicht mehr aus Küssnacht zu verscheuchen. Selbst, wenn man es gewollt hätte. Friedli nickte. Er konnte nicht abschätzen, ob der Sidler zu jenen zählte, die das gewollt hätten, oder nicht.
«Apropos Auswärtige …», sagte Friedli auf einmal. «Vorhin in der Glashütte habe ich einen eigenartigen alten Mann mit einem langen, weissen Bart gesehen, der mich anstarrte, als sei ich ein fünffüssiger Pelikan. Wissen Sie, wer das war? Und was er gegen mich hat?»
Sidler antwortete nicht. Er betrat eine Bäckerei, orderte am Tresen einen Teller bunte Patisserie und verzog sich dann auf die Toilette. Friedli blieb alleine zurück. Er war irritiert über den Umstand, dass der ansonsten doch sehr gesprächige Küssnachter Verleger nicht auf seine Frage eingegangen war. Als sie sich später an einem kleinen Tischchen in der Bäckerei gegenübersassen, versuchte es Friedli erneut.
«Wer ist dieser alte Mann mit dem langen, weissen Bart, der in der Glasi arbeitet? Kennen Sie ihn?»
Sidler kniff seine Lippen aufeinander und lächelte. Es war ein eigenartiges, ein erzwungenes Lächeln.
«Sie meinen unseren Chlaus … oder besser gesagt, unseren ehemaligen Chlaus», begann er endlich zu erzählen. «Er hat nichts gegen Auswärtige oder gegen Sie im Speziellen, aber Sie müssen wissen, dass er ein bewegtes Leben hinter sich hat. Er hat das Amt des Chlauses über mehrere Jahrzehnte ausgeübt, bis er vor ein paar Jahren – während dem Chlausjagen, ironischerweise – ein Schlegli erlitt, woraufhin seine Chlauskarriere zu Ende war. Kurze Zeit später musste er auch seine Reparaturwerkstatt unten beim Erlibach schliessen. Sein Vater, ein Pionier, hatte sie um die Jahrhundertwende eröffnet. Der Grund für die Schliessung war, dass der Chlaus als Folge des Schleglis seine Stimme verlor. Und ohne Stimme …» Hier unterbrach sich der Sidler und seufzte, ehe er fortfuhr. «Ohne Stimme bist du nur noch ein halbwertiger Mensch. Heute führt der Chlaus, wie wir ihn immer noch nennen, Hilfsarbeiten in einigen Betrieben in der Region aus. Ausserdem sammelt er Schrott, vorzugsweise Stahl und Kupfer, weshalb man ihn häufig mit seinem Leiterwägeli durch die Strassen ziehen sieht. Armer Kerl! Etwas unheimlich, zugegeben, aber harmlos.»
Friedli hatte einiges nicht verstanden.
«Was ist das, ein Chlaus ?»
Sidler setzte eine ungläubige Miene auf.
«Sagen Sie nur nicht, Sie hätten noch nie vom Chlausjagen gehört?»
«Ich habe keine Ahnung, was das sein soll, es klingt aber gefährlich.»
Der Küssnachter lachte laut auf.
«Das Chlausjagen ist der spektakulärste Sankt-Nikolaus-Brauch, den Sie weit und breit finden werden. Sie müssen es sich unbedingt anschauen kommen nächsten Dezember. Und gefährlich ist es mitnichten. Höchstens für Ihre Leber.»
Er lachte wieder.
«Was tut man denn da?»
«Das lässt sich nur schwer beschreiben. Es gibt jede Menge Umzüge, viel Lärm, viel Licht, faszinierende Yffelen und der Schnaps kommt auch nicht zu kurz.»
Er zwinkerte ihm zu.
«Yffelen?», hakte Friedli nach.
«Farbige, aufwändig verzierte Kopflaternen, die die Männer wie riesige Hüte auf dem Kopf tragen, sodass der Umzug den Eindruck erweckt, als tanzten Kirchenfenster durch die Nacht.»
Friedli weitete seine Augen. Er wusste nicht, wie genau er sich einen solchen Umzug vorstellen sollte. Es gab aber noch viele weitere Fragen, die sich in diesem Moment in ihm stauten: «Und der Mann in der Glashütte war der Anführer dieser … ähh … Umzüge?»
«Ja, so kann man es sagen. Während vieler Jahre ist er mit seinem Bischofsstab vor die Kinder des Bezirks getreten. Bis eben … nun, bis zu diesem tragischen Vorfall.»
«Und seither sagt er kein Wort mehr?»
«Na ja …» Sidler zögerte wieder. «Sprechen kann man das nicht nennen. Er sagt nur noch die gleichen paar Worte», berichtigte er dann.
«Welche?»
«Mänz Mänz Mänz Bodefridimänz.»
«Wie bitte?»
«Wie soll ich das erklären …» Er atmete schwer aus. «In den 1920er-Jahren gab es in Küssnacht einen Bezirksammann mit Namen Klemenz Ulrich, der in seiner Amtszeit vergeblich versucht hat, das Chlausjagen in einen … ähh … gesitteteren Brauch zu transformieren. Doch bei den Chlausjägern kam diese Idee nicht gut an. Die Herrschaften befanden, dass der Klemenz ein Schafseckel sei und mit seinen Plänen gefälligst zum Teufel fahren solle. In einem populären Schmähgesang besingen die Chlausjäger den Klemenz seither spöttisch als den Bodefridimänz. Dieser Gesang ist alles, was noch aus dem Mund unseres ehemaligen Chlauses rauskommt. Es waren die letzten Worte, die er vor dem Schlegli sprach.»
Читать дальше