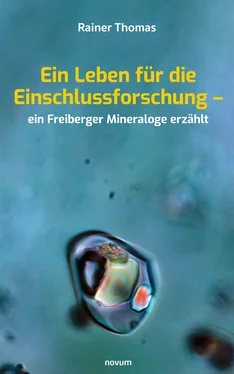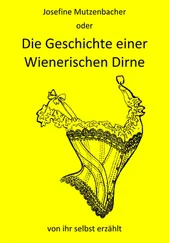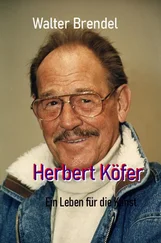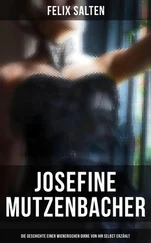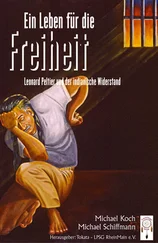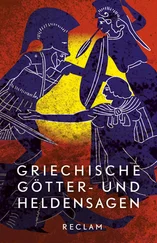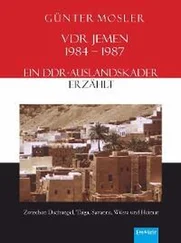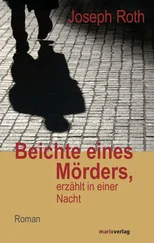Geburtsort und frühe Kindheit
Oppach, 1336 erstmals urkundlich erwähnt, als Waldhufendorf angelegt, konnte man in meiner Kindheit als Industriedorf bezeichnen. Das ehemalige Siemens-Schuckert-Werk II (1928–1947), zur DDR-Zeit VEB IKA Elektroschaltgeräte Oppach und später VEB Elektroschaltgeräte Werk Oppach (ESGO), dominierte den Ort. Hinzu kamen noch größere Webereien, Spinnereien und Steinschleifereien. In den letzteren wurde Material (Granodiorit, Lamprophyr) aus den umliegenden Steinbrüchen verarbeitet.
In strengen Wintern wurde der Schulunterricht auch mal in die Weberei Lange verlegt. Dabei lernten wir so nebenbei die damalige Industrietechnik kennen. Eingeprägt hat sich das Bild der großen Transmissionsriemen in der Maschinenhalle.
Seit der Wende liegt die gesamte Industrie brach. Geblieben ist nur die 1991 gegründete Oppacher Mineralquellen GmbH & Co. KG, die ihre Wurzeln in der 1886 gegründeten Destillation und Obstkelterei sieht.
Das Oppacher Schloss, 1790 errichtet, wurde 1844 für den sächsischen Innenminister Eduard Gottlob von Nostitz und Jänckendorf umgebaut. Nach 1945 diente es vorübergehend als Unterkunft für Flüchtlinge und Vertriebene und ab 1950 als Kindergarten, den ich auch kurzzeitig besuchte. In lebhafter Erinnerung ist die große Linde mit einem Umfang von 6,5 m im Park, unmittelbar hinter dem Schloss, geblieben – für uns Kinder ein außergewöhnlicher Kletterbaum, der durch kräftige Eisenringe zusammengehalten wurde. Arthur von Nordstern besang 1835 diese Linde noch als stark und kerngesund. Nordstern, eigentlich Gottlob Adolf Ernst von Nostitz und Jänkendorf, geboren 1765 in See bei Niesky, ist am 15. Oktober 1836 in Oppach gestorben. Viele der Angehörigen der Familie von Nostitz und Jänkendorf sind auf dem Oppacher Friedhof beigesetzt, so auch sein Sohn Eduard Gottlob von Nostitz und Jänkendorf (31. März 1791 in Bautzen geboren, gestorben am 8. Februar 1858 in Dresden und am 18. Februar in Oppach beigesetzt). Er trat 1813 in preußische Dienste und diente als Offizier im Lützowschen Korps. Als Kämpfer der Körnerschen Freischar half er, den schwer verwundeten Theodor Körner (1791–1813) aus dem Gefecht zu tragen und im Forst von Rosenow bei Gadebusch zu begraben. Im Übrigen war Theodor Körner 1808 auch Student an der Bergakademie Freiberg.
Gegenwärtig ist das Oppacher „Schloss“ leerstehend und sanierungsbedürftig.
Persönlichkeiten, die im Ort geboren wurden, sind der Dirigent Hermann Zumpe (1850–1903) und Carl Adalbert Förster (1853–1925), Textilfabrikant und Mitglied des Deutschen Reichstags, sowie Rolf Herzog (1919–2006), ein deutscher Ethnologe, bis zu seiner Emeritierung Professor für Völkerkunde an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg.
Emil Hans Willi Hennig (1913–1976) besuchte von 1921 bis 1927 die Volksschule in Oppach, etwas früher als mein Vater. Er war ein deutscher Biologe und gilt als Begründer der phylogenetischen Systematik, die heute auch unter dem Namen Kladistik bekannt ist. Mit seinen Arbeiten zur Evolution und Systematik revolutionierte er die Sichtweise auf die natürliche Ordnung der Lebewesen. Daneben war er vor allem Spezialist für Zweiflügler. Im Jahr 2013 wurde die Grundschule Oppach anlässlich seines 100. Geburtstages in „Willi-Hennig-Grundschule“ umbenannt
Geboren wurde ich im Dritten Reich, am Donnerstag, den 13. August 1942 um 215 Uhr früh in der Siemens-Siedlung, Fichtestraße 18 in Oppach als zweites Kind von Gerhard (1915–1994) und Anna Thomas (1920–1993), geb. Schäfer, aus Cunewalde.
Am 13. August sind eine ganze Reihe sehr unterschiedlicher Personen geboren worden. Zu nennen sind hier beispielsweise: August Bebel 1871, Richard Willstätter 1872 (Nobelpreis für Chemie 1915), Alfred Hitchcock 1899, Fidel Castro 1926, Frederik Sanger 1918 (Nobelpreise in Chemie 1958 und 1980) und eine Reihe weiterer Personen. Zu eben den letztgenannten gehört auch Wolfgang Kramer (13. August 1939), ein Freiberger Mineraloge, der meinen Weg seit dem Studium in Freiberg und meiner Zeit in Potsdam immer wieder tangierte.
Für den 13. August 1942 findet man Meldungen im Internet, die nicht kontrastreicher sein könnten. In den U.S.A. wurde Walt Disneys „Bambi“ uraufgeführt, am gleichen Tage kam Bernard Montgomery, der spätere Bezwinger von Feldmarschall Rommel, in Afrika bei der 8. Armee in Ägypten an, die Altstadt von Mainz wurde bei Luftangriffen der Royal Air Force fast vollständig zerstört und Hitlers 4. Panzerarmee rückte auf Elista, die Hauptstadt der Teilrepublik Kalmückien im Süden Russlands vor und besetzte diese Stadt am nämlichen Tag.
Später ist dieses Datum, der 13. August 1961, durch den Mauerbau unrühmlich in die Geschichte eingegangen und hatte für viele Menschen aus Ost und West einschneidende Konsequenzen.
Persönlich sind wenige Erinnerungen aus den letzten Kriegsjahren geblieben. Das schreckliche Ansetzen der Gasmaske bei Fliegeralarm und der Aufenthalt im Luftschutzkeller haben sich tief in mein Gedächtnis eingeprägt. Am Rand der Siemens-Siedlung befand sich das Barackenlager für die Zwangsarbeiter des Siemens-Werkes. Das rhythmische Klappern ihrer Holzpantinen, wenn sie bewacht als Kolonne ins Siemenswerk marschierten, ist in meiner Erinnerung geblieben. Sicherlich war es ein kleines Lager inmitten des Ortes, aber es war alltagsbegleitend und gehörte zu den über 30 000 Arbeitslagern, die die Enzyklopädie des Schreckens unter Leitung von Geoffrey Megargee zu erfassen versucht.
Oder die Flugzeuggeschwader, die in großer Höhe den Ort ostwärts überflogen und denen wir Kinder hinterher sahen. Nachhaltig hat sich auch der Bombenangriff auf Dresden am 13. und 14. Februar 1945 eingeprägt. In Richtung Westen, wo Dresden lag, war den ganzen Tag über der Horizont blutrot und am 14. Februar regnete es teilweise verkohlte Papierfetzen vom Himmel.
Uns Kindern wurde eingeschärft, auf keinen Fall von Flugzeugen abgeworfene Spielsachen aufzuheben, es könnte sich um getarnte Explosivkörper handeln.
Oppach hat nur einen Bombenangriff erlebt – er galt dem Siemens-Werk. Die Bomben schlugen aber weit entfernt im Wald ein – dem Stellplatz für die Arbeiter des Siemens-Werkes. Aber an diesem Tag sind die Arbeiter im Werk geblieben. Zufall?
Auch der Tag der Kapitulation hat sich verschwommen in die Erinnerung eingegraben. Dem Hören nach wurde der Ort ohne Gegenwehr von einem sowjetischen Reiter eingenommen, obwohl Vorkehrungen getroffen wurden, den Ort bis zum Letzten zu verteidigen. Später hat mir unser Chemielehrer Hans Beck den detaillierten Verteidigungsplan von Oppach gezeigt – das war einfach Wahnsinn. Alle kleinen Brücken im Dorf sollten gesprengt werden. Beherzte Oppacher haben die Sprengladungen entfernt. Überall waren auch Geschütze positioniert – aber es fehlte glücklicherweise an der Munition.
Hans Beck diente unter Generalfeldmarschall Erwin Rommel (1891–1944) im Afrikakorps und kam in Ägypten in englische Gefangenschaft. In der Schulzeit, im Erdkundeunterricht, hat er uns viele spannende Geschichten aus Afrika und seiner Gefangenschaft erzählt. In der sechsten oder siebten Klasse erhielt unsere Klasse Zuwachs: Monika Liebscher. Ihr Vater hatte mit Hans Beck in der gleichen Einheit gedient. Von nun an hörten wir keine Geschichten mehr. Es stellte sich nämlich heraus, dass er maßlos übertrieben hatte, aber eigentlich ein Feigling war. Das hatte er einmal auch selbst vorgeführt. In einer Chemiestunde im Klassenraum 9 unter dem Dach der Oppacher Schule verbrannte er im Rahmen eines Demonstrationsversuches ein relativ großes Stück weißen Phosphor unter Beachtung und Erläuterung aller Gefahren und den nötigen Sicherheitsvorkehrungen. Mit einer langen Lunte zündete er dann den Phosphor an, rief „ich zünde“ und rannte aus dem Zimmer, uns Schüler dem „Schicksal“ selbst überlassend.
Читать дальше