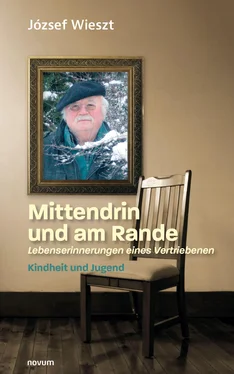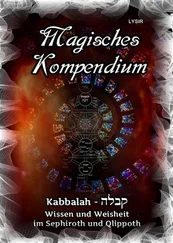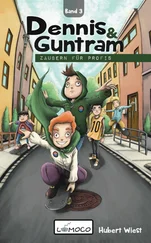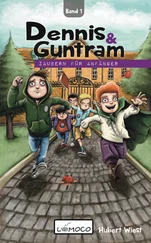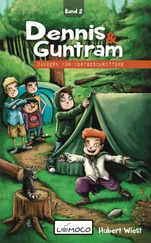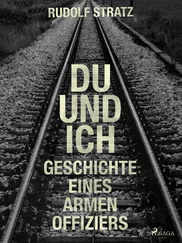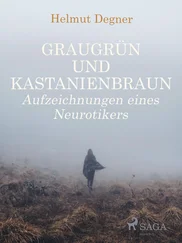Manchmal wurde das Maisstroh nur nach hinten gestreift und Kolben für Kolben zusammengeflochten, bis ein etwa ein Meter langer Zopf entstanden war. An seinem Ende wurde ein kräftiges Seil befestigt und der Zopf wurde unter dem überstehenden Dach vor der Hauswand zum Weitertrocknen aufgehängt. Die meisten Kolben wurden jedoch gänzlich vom Stroh befreit und auf der trockenen Tenne zum weiteren Trocknen ausgebreitet. Wenn der Mais nach ein paar Wochen völlig trocken war, wurden Körner von den Kolben getrennt. Diese Arbeit ging so vor sich, dass sich wieder ein Kreis von Arbeitenden bildete und jeder in der Runde einen Haufen Maiskolben vor sich hatte. Von jedem Kolben mussten die Körner heruntergerebelt werden. Dazu wurde er über eine Schneide gezogen, deren scharfe Seite nach oben zeigte. Sie war auf einem Holzklotz befestigt, den die Erwachsenen zwischen Schenkeln oder Füßen festhielten. Jedes Mal, wenn ein Kolben darüber gezogen wurde, sprangen Körner herunter und fielen auf den Boden. War der Kolben leer, wurde er in die Mitte geworfen. So entstand dort ein Haufen, der ständig größer und größer wurde, während der Haufen vor den im Kreis sitzenden Leuten immer kleiner wurde. Ständig sorgte jemand für Nachschub. Am Ende lag vor jeder/m Arbeitenden ein Berg Maiskörner. Sie wurden zu einem großen Haufen zusammengefegt und später in Säcke gefüllt. War die Arbeit getan, bedankte sich der Großvater bei der versammelten Runde und schickte sie ins Bett. Das war so gegen ein Uhr nachts, und für manch einen war es höchste Zeit, nicht nur, weil er am anderen Morgen um vier wieder aus den Federn musste, sondern weil ihn seine Beine nicht mehr so trugen wie gewöhnlich. Vor allem die Burschen schwankten ihren Stallbetten zu und hatten oft Mühe, die Leiter, die zu ihren Pritschen führte, noch hinaufzuklettern.
Stallbetten
Die Burschen in den ärmeren Familien hatten ihre Betten im Stall bei den Kühen oder Pferden. In Kopfhöhe eines Mannes, oder noch etwas höher, waren dünnere Balken in die Wand eingelassen, auf die Bretter genagelt waren. Sie bildeten das Bett, ein mit Stroh gefüllter Leinenbezug, der Strohsack, war die Matratze. Eine Kolder oder „a Koutzn“, wie man bei uns sagte, diente als Zudecke. Auf dieses Stallbett, „Stoibeittl“, gelangte man durch eine hölzerne Leiter, wie in die Etagenbetten heutiger Kinderzimmer. Diese Art zu übernachten, hatte für die jungen Burschen und Stallknechte durchaus ihre Vorteile. Sie mussten sich die Woche über nicht waschen, hatten es sehr nah zur Arbeit und, das war vielleicht das wichtigste, sie konnten nachts ins Bett klettern, wann sie wollten, ohne dass sie von Eltern oder Dienstherren kontrolliert wurden. Auf den deutschen Dörfern in Ungarn gingen nämlich diejenigen Heranwachsenden, die mangels reicher Eltern sich verdingen mussten, um sich ihren Lebensunterhalt zu verdienen, „in den Dienst“ bei anderen Leuten. Die Mädchen fanden häufig eine Anstellung in der Stadt (Budapest) als Dienstmädchen, die jungen Burschen arbeiteten bei reicheren Bauern als Knechte oder bei Händlern als Fuhrknechte. Die Handwerker auf den Dörfern beschäftigten auch einige Hilfskräfte, meistens waren das aber ihre heranwachsenden Söhne, die den Betrieb der Eltern einmal übernehmen sollten. Richtige Lohnarbeit war auf den deutschen Dörfern unentwickelt. Sehr verbreitet war sie aber auf den riesigen ungarischen Gütern, zu denen jeweils mehrere Dörfer gehörten, in denen die dort beschäftigten Landarbeiter lebten, um auf den Feldern der Gutsherren zu arbeiten. Geld wurde an diese Landarbeiter aber nur selten ausgezahlt. Sie erhielten regelmäßig Deputate, also Holz, Nahrungsmittel, Kleidung, und andere Waren aus den Kaufläden der Gutsbesitzer und eben einen Platz zum Schlafen. Weil sie stets mehr verbrauchten, als ihnen die Verwalter an Lohn gutschrieben, waren sie ständig in der Schuldknechtschaft ihrer Herren. Sie konnten von einen Gut nur wegziehen, wenn sie in der Lage waren, die geschuldete Ablösesumme auf den Tisch des Verwalters zu legen. Dazu war aber kaum einer in der Lage. So lebten sie dann auch noch zur Zeit meiner Kindheit in Ungarn in einer Art Leibeigenschaft, die formell schon fast ein Jahrhundert lang abgeschafft war. Der Schriftsteller Gyula Ilyés hat in seinem Buch „Die Puszta“18 ausführlich über diese Form der Knechtschaft geschrieben. Es ist eines der besten zur sozialen Lage auf dem Lande in Ungarn überhaupt. Puszta hieß nicht nur die Landschaft in der ungarischen Tiefebene, sondern auch ein Gutshaus mit dem dazu gehörenden Gesinde.
Baden in Perbál
Eine Badeanstalt gab es in Perbál nicht, auch keinen Teich, in dem man baden konnte. An Sonntagen, denn an Wochentagen waren auch die Kinder mit auf den Feldern, die jungen Burschen ab zwölf Jahren ohnehin – an Sonntagen im Sommer gingen wir Kinder und die größeren Jungen zum Baden in den „Schlauch“. Es war ein Stauwehr in einem größeren Bach, der unter dicken Maulbeerbäumen zur Mühle floss. Dort badeten wir. Es lag in dichtem Schatten, und an den heißen Sommertagen war es hier angenehm kühl. Dass „wir Kinder“ dorthin zum Baden gingen, ist eine leichte Übertreibung. Zumindest solange die Größeren dort waren, hatten die Kleinen keine Gelegenheit, ins Wasser zu kommen. Dafür war es viel zu klein, und das Getümmel war so groß, dass wir uns nicht hinein trauten.
Badehosen oder -anzüge hatten wir nicht. Wie erwähnt hatten die kleineren Kinder im Sommer ohnehin nur ein Röckchen an, Jungen wie Mädchen oder „Buem“ und „Maaln“, wie es in unserem Dialekt heißt. Unterhosen, Strümpfe und Schuhe trugen wir nur, wenn wir in die Kirche mitgenommen wurden oder bei Besuchen. Wenn wir Kleinen ins Wasser gingen, waren wir nackt. Die jungen Burschen banden sich ihre Schürze vor den nackten Körper. Dieses „Fiedde“ wurde zwischen den Beinen hindurchgezogen und hinten am Rücken am Band der Schürze festgebunden.
Damit war alles zugedeckt, was versteckt werden sollte. Allerdings war auch der Latz der Schürze vor der Brust heruntergelassen und irgendwie auch in der Mitte befestigt, sodass eine Art Badehose entstand. Für die Mädchen ab neun, zehn gab es solche Probleme nicht. Sie waren aus der Sicht der Eltern damals schon „groß“ und mussten im Haushalt helfen, es war kaum vorstellbar, dass sie am Sonntagnachmittag im Wasser herumtollten. Die kleineren Mädchen liefen wie die Jungen splitternackt in unserem Bad herum.
Das gestaute Wasser ging den größeren Jungen bis an die Brust. Schwimmen hätte man können, aber das Gedränge war so groß, das kaum einer dazu kam. Richtig gelernt hat kaum einer das Schwimmen, zumindest nicht im „Schlauch“. Die Hauptsache bei dem Baden war, dass die größeren Kinder und die jungen Burschen vom Ufer oder von den Aufbauten der Staustufe – das waren dicke Balken, die wie ein Tor über dem Graben standen und von denen Bretter an Ketten heruntergelassen wurden, die das Wasser aufhielten – von dort herunter ins Wasser sprangen. Das geschah unter lautem Geschrei, Gebrüll und Gelächter.
Wir Minigaffer am Rand wurden durch das Geplansche oder absichtlich von denen, die im Wasser waren, nass gespritzt. Das war unser Baden. Aber es war nicht langweilig für uns. Im Gegenteil: Wir nahmen großen Anteil an dem Treiben der Größeren. Auch hatten wir unsere Favoriten unter ihnen, und wenn sie bei dem Gerangel und den sonstigen Revierkämpfen, die junge Burschen dort austrugen, obsiegten, freuten wir ins mit ihnen.
Informativ waren diese Badetage für uns Kleine auch dadurch, dass ab und zu ein kleines Malheur passierte und im Eifer des Getümmels die improvisierte Badehose eines jungen Burschen herunterrutschte. Wenngleich dieser eifrig bemüht war, das Missgeschick schnell zu beheben, so konnten wir doch zur Genüge sehen, was uns da unten später wachsen würde. Wenn es die Großen auf einen besonders abgesehen hatten, lösten sie ihm öfter das Schürzenband und machten ihn nackt, was immer zu einem schlagartigen Anstieg des Geschreis und Gelächters führte.
Читать дальше