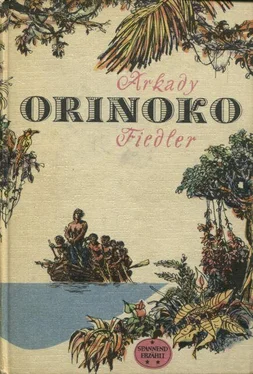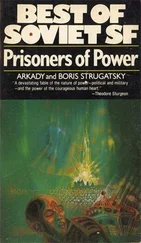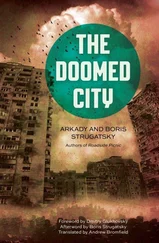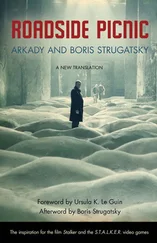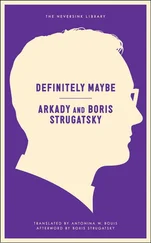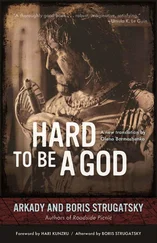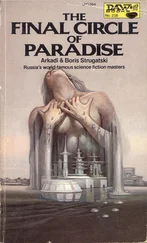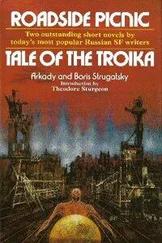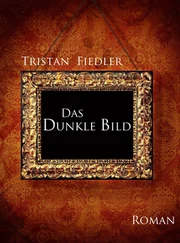Arkady Fiedler - Orinoko
Здесь есть возможность читать онлайн «Arkady Fiedler - Orinoko» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Год выпуска: 1964, Жанр: Приключения про индейцев, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Orinoko
- Автор:
- Жанр:
- Год:1964
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Orinoko: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Orinoko»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Ins Deutsche übertragen von Erwin Thiemann
Illustriert von Eberhard Binder-Staßfurt
Alle Rechte für die deutsche Ausgabe beim Verlag Neues Leben, Berlin 1960 3. Auflage, 1964
Orinoko — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Orinoko», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Er dachte nach, zog an seiner Zigarre und blies öfter Rauchwolken vor sich hin, um die Mücken zu verscheuchen. Schließlich sagte er: „Die Situation der Indianer am Orinoko kann man nicht mit dem vergleichen, was im Norden geschehen ist, wie Sie selbst ganz richtig erwähnt haben. Auch den Handelscharakter unserer Kolonie in Guayana haben Sie gut umrissen, und es wird Ihnen daher auch bekannt sein, daß wir Engländer in den Indianern niemals Arbeitsmaterial für die Plantagen erblickt haben. Sollten wir hier einmal Plantagen anlegen, so werden wir Neger herbeischaffen, die Indianer aber lassen wir in Ruhe, im schlimmsten Fall werden wir sie etwas tiefer in den Urwald verdrängen. Was die Spanier betrifft, so irren Sie sich und unterschätzen die Gefahr, die von dieser Seite droht. Heute sind sie schwach, was aber nicht bedeutet, daß es immer so bleiben muß. Schon in wenigen Jahren kann sich das von Grund auf geändert haben. Und wie grausam und despotisch sie mit den Indianern verfahren, das wissen Sie selbst am besten. In unserer Geschichte ist es vorgekommen, daß wir aus höheren Gründen der Staatsräson gezwungen waren, indianische Stämme zu bekämpfen; doch wiederhole ich, daß dies hier im Süden nicht geschehen wird! Und wenn wir Krieg geführt haben, so haben wir uns nie Grausamkeiten zuschulden kommen lassen.”
Dies erklärte er mit erhobener Stimme und fast prahlerisch, wenn auch durchaus im Rahmen des guten Benehmens. Sichtlich war er von der Richtigkeit seiner Ansicht überzeugt und ließ die Möglichkeit, daß jemand anders darüber denken könnte, überhaupt nicht zu. Mir schoß das Blut in den Kopf, doch beherrschte ich mich und biß mir auf die Lippe. Erst nach einiger Zeit antwortete ich: „Wenn ich mich nicht irre, geschah es im Jahr 1644, also vor rund hundert Jahren. Durch die bloße Tatsache ihrer Existenz wurden damals die Indianer in Virginia für unsere immer zahlreicheren Kolonisten zu einem unerträglichen Hindernis. Man entschied daher, den Eingeborenen den letzten Schlag zu versetzen. Um diese Aufgabe gründlich zu erledigen, nahmen alle Kolonisten zu einem niederträchtigen Betrug Zuflucht. Sie änderten mit einem Schlag ihre Haltung gegenüber den Indianern und täuschten herzliche Freundschaft vor, um sie aus ihren Verstecken zu locken. Die aus Gründen der Staatsräson geübte List hatte vollen Erfolg, und es begann das letzte Morden am Volke Pohattans. Die Kolonisten, wie schon vordem des öfteren, brachten alle um, deren sie habhaft werden konnten, auch die Frauen und die Kinder, selbstverständlich nur aus Gründen der Staatsräson. Vergeblich setzten sich die Indianer zur Wehr und kämpften verzweifelt, sie wurden aufgerieben, und einer der letzten, die bezwungen wurden, war der greise Häuptling Opentschakanuk, ein Bruder des schon lange nicht mehr lebenden Pohattan. Durch einen merkwürdigen Zufall wurde der Alte nicht auf der Stelle getötet, sondern gefangengenommen und nach Jamestown verschleppt. Hier ersann unser Gouverneur eine ungewöhnliche Todesart für ihn. Auf dem großen Platz ließ er einen Käfig bauen und setzte den Gefangenen hinein, zum Gaudium des Pöbels.
Die Vorübergehenden sparten nicht mit Schmähungen und Beschimpfungen, viele spien dem Greis ins Gesicht und stießen ihn mit Stöcken. Der Gouverneur verurteilte ihn zum Hungertod, und tatsächlich starb Opentschakanuk nach einiger Zeit an Entkräftung. Seine einzige Schuld, das mußten auch unsere Geschichtsschreiber zugeben, bestand darin, daß der greise Häuptling bis zum letzten Augenblick für sein Land und für sein Volk gekämpft hat. Nein, Sir, wir Engländer haben uns nie Grausamkeiten gegenüber den Indianern zuschulden kommen lassen, niemals, nicht wahr?”
Der Kapitän nahm die Erzählung gelassen auf, sogar mit einem Anflug von Humor. Er betrachtete mich eine Zeitlang durch die aus seiner Zigarre aufsteigenden Rauchkringel, streckte sich dann, gähnte vernehmlich und erklärte mit einem feinen Lächeln: „Well, Mr. Bober, Sie haben einen eigensinnigen Schädel, außerdem sind Sie wahrscheinlich heute etwas nervös durch die ungeklärte Situation mit den Akawois. Wir werden uns morgen weiter unter-halten. Gute Nacht, junger Mann.”
„Gute Nacht, Mr. Powell. Vergessen Sie nicht, auf der Brigg Wachen auszustellen. Und lassen Sie die Büchsen und Pistolen mit frischem Pulver versehen!”
Es war bereits tiefe Nacht, als eines der beiden Boote zurückkehrte, die die acht Akawois beobachten sollten. Dabaro und seine Leute hatten sich nach dem Verlassen des Sees flußabwärts gewandt, waren aber nicht bis Serima gefahren, sondern waren gelandet und hatten sich im Ufergebüsch verborgen, um die Dunkelheit abzuwarten.
Unsere Späher gingen auch an Land, um sich zu überzeugen, ob nicht noch mehr Akawois in der Nähe waren, jedoch fanden sie nichts. Nach Einbruch der Dunkelheit bestiegen die acht wieder ihr Boot, sie setzten aber ihren Weg nicht fort, sondern machten kehrt und fuhren den Fluß hinauf. Die Unsern waren ihnen gefolgt, hatten sie aber oberhalb der Einfahrt zum See aus den Augen verloren. Daher kehrte ein Boot zurück, während das andere in der Durchfahrt verblieb.
Diese Nachricht bestätigte unsere Vermutung, daß sich der Lagerplatz der Akawois weiter flußaufwärts befinden müsse.
Ich suchte meine Hütte auf. Als Lasana die Schritte vernahm, erhob sie sich sofort und fachte das erlöschende Feuer an. In der einen Ecke schlummerte Arnak, in der anderen lagen Wagura und Pedro, die beiden unzertrennlichen Gefährten. Sie schliefen den gesunden Schlaf junger Menschen, die schwere Arbeit geleistet haben, ihre Hände ruhten auf ihren Büchsen und Messern. Sie waren bereit zum Kampf wie die meisten Einwohner Kumakas in dieser Nacht. Nicht nur von den Waffen ging eine mildernde Ruhe aus, auch auf ihren Gesichtern lag ein Ausdruck völliger Entspannung. Die jungen Indianer schenkten mir blindes Vertrauen, und ich empfand plötzlich das unbezähmbare Verlangen, im Geiste den Schwur abzulegen, daß ich ihren Glauben niemals enttäuschen werde. Ich warf mich auf das Lager und schlief ein.
Als ich geweckt wurde, dauerte es geraume Zeit, bis ich zu mir kam. Noch im Halbschlaf fühlte ich, daß die Menschen ungewöhnlich erregt waren. Es waren mehrere, sie umstanden mein Lager. Neben Lasana bemerkte ich Manauri, Mabukuli, Fujudi und eine ganze Anzahl Krieger. Die Hütte war fast voll, immer mehr Indianer eilten herbei.
„Jan!” vernahm ich die eindringliche Stimme Manauris. „Steh auf, die Akawois sind aufgebrochen!”
Im Augenblick war ich bei Sinnen, der Schlaf war verflogen. Während ich auf die Beine sprang, rief ich aus: „Wo sind sie?” „Auf dem Fluß.”
„Auf dem Fluß?”
„Ja. Sie fuhren an unserem Dorf vorbei, in Richtung Serima.” „Wurde festgestellt, wie viele es sind?”
„Über achtzig, soviel unsere Späher im Dunkel erkennen konnten. Sie fuhren in neun Booten.”
„Wann haben sie das Dorf passiert?”
„Eben jetzt. Sie können noch nicht weit sein. Ich habe die ganze Siedlung wecken lassen.”
„Gut. Verfolgt sie jemand?”
„Zwei von den drei Jabotas, die am Fluß Wache hielten, fahren hinter ihnen her.”
Wagura und Pedro waren bereits erwacht, Arnak schlief noch wie erschlagen; der arme Kerl hatte die letzte Nacht überhaupt kein Auge zugetan, und der außergewöhnlich heiße Tag hatte ihm den Rest gegeben. Ich schüttelte ihn leicht am Arm und sprach freundschaftlich, aber laut in sein Ohr, „Arnak, lieber Bruder, steh auf, es geht los!”
Er riß die Augen auf und starrte uns an.
Der Kampf auf dem Fluß
In Kumaka summte es wie in einem Bienenstock. Serima ist in Gefahr! Alle beherrschte der gleiche Gedanke: Die Akawois hatten erkannt, daß wir in Kumaka auf der Hut waren und entschlossen, Widerstand zu leisten, weshalb sie den Beschluß faßten, nicht uns, sondern Serima zu überfallen. Sicher hatten sie erfahren, daß die Seuche bereits erloschen war. Wir mußten den Brüdern in Serima schnellstens zu Hilfe eilen. Trotz der Eile und der Dunkelheit entstand keine Unordnung, denn jeder Krieger wußte genau, in welches Boot er gehörte.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Orinoko»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Orinoko» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Orinoko» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.