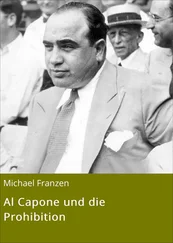Das Erste, was Caius spürte, war das furchtbare Dröhnen in seinem Kopf. Es war, als würde ein Schmied seinen Hammer immer wieder und in schneller Folge gegen seine Schädeldecke krachen lassen. Seine Sinne kehrten nur langsam zurück. Er lag auf dem Rücken. Feuchte Kälte hatte sich durch die Kleidung bis auf die Haut vorgearbeitet. Arme und Beine fühlten sich taub an. Sein Kopf lag zur Seite gekippt im Schlamm.
Nach und nach kam die Erinnerung. Bilder tauchten aus der nebligen Dunkelheit seines Bewusstseins auf und hüpften vor seinem inneren Auge im Rhythmus des Hämmerns in seinem Kopf, das nicht aufhören wollte. Gestalten, die plötzlich wie Geisterwesen zwischen den Bäumen aufgetaucht waren. Ohrenbetäubendes Geschrei. Durchgehende Maultiergespanne, umstürzende Wagen. Varus, wie er von seiner Leibwache abgeschirmt wurde. Das Sirren und Klacken von Pfeilen, die aus dem Nichts zu kommen schienen. Und dann hatte ihn irgendetwas am Kopf getroffen.
Caius begann zu zittern. Mach die Augen auf, befahl er sich selbst. Das Dröhnen in seinem Kopf hielt unverdrossen an, und als das erste Licht durch die Lider drang, nahmen die Schläge an Heftigkeit noch einmal zu.
Sehr langsam tauchten die Konturen eines umgekippten Trosswagens aus dem milchigen Schleier auf. Die Plane war aufgerissen und allerlei Gerätschaften waren herausgefallen. Neben einem der Wagenräder lag ein toter Legionär, aus seinem Hals ragte der Schaft eines Pfeils.
Du musst aufstehen, dachte Caius. Immerhin wich die Taubheit allmählich aus seinen Gliedmaßen, obwohl sie sich noch bleischwer anfühlten. Er wälzte sich auf die Seite und drückte sich mit den Armen hoch, dabei wurde ihm so übel, dass er sich beinahe übergeben hätte. Sein ganzer Körper war mit Schlamm bedeckt, der eine harte, verkrustete Schicht bildete.
Bis auf das Hämmern in seinem Kopf war es totenstill im Wald. Mit Mühe drehte Caius den Kopf nach rechts. An einer merkwürdig verwachsenen Buche erkannte er, dass er sich immer noch an der Stelle befand, wo er zuvor inmitten der ganzen Kolonne marschiert war. Vorhin – vor einer Stunde? Vor vier Stunden? Jetzt lagen überall Tote und verstreutes Gepäck herum, dazu einige Packwagen, ein paar davon ohne die Gespanne, bei anderen hingen die Zugtiere tot im Geschirr.
Der Reisewagen des Statthalters war weg. Sie haben Varus, dachte Caius, und das Dröhnen in seinem Kopf schwoll an. Sie haben seinen Wagen und sie haben den Kasten. Unwillkürlich stellte er sich vor, wie eine Gruppe dieser Barbaren den Kasten aufbrach und beim Anblick ihres Inhalts ungläubig erstarrte. Der Gedanke war unerträglich. Das größte Geheimnis des Imperiums, verschollen in einem namenlosen Wald in Germanien. Was in diesem Kasten war, durfte es eigentlich gar nicht geben. Wenn Augustus davon erfährt, dachte Caius, wird in Rom die Erde beben.
In dem Säulengang, der den offenen Platz des Forums von drei Seiten einrahmte, schob sich eine bunt zusammengewürfelte Menschenmasse vorwärts wie ein zähflüssiger Lavastrom. Von der stuckverzierten Decke hallte das tausendstimmige Schwatzen und Lachen als dumpfes und gleichförmiges Gemurmel zurück. Die Müßiggänger waren hier an diesem Nachmittag in der Mehrheit und machten den wenigen, die es eilig hatten, das Durchkommen schwer. Immer wieder staute sich der Strom, wenn kleine Grüppchen plaudernd vor den vergoldeten Statuen stehen blieben, die zwischen den Säulen aufgestellt waren.
Es war der erste Tag im Mai, und nach einem eiskalten März und einem verregneten April brannte nun die Sonne vom wolkenlosen Himmel, als habe es nie einen Winter gegeben. Ganz Rom stürzte sich in den Frühling.
Caius drängte sich zwischen zwei ägyptischen Trägern durch, die ihre Pakete abgelegt hatten und sich in ihrer fremden Sprache unterhielten. Der eine lehnte am Sockel der Statue eines Diskuswerfers, der andere an einer der korinthischen Säulen, die den überdachten Gang vom Forumsplatz trennten. Die beiden Sklaven verstummten und musterten ohne Scheu seine Toga mit dem breiten Purpurstreifen, die Caius als Angehörigen des senatorischen Adels auswies. Etwas an ihrem Blick war unverschämt. Er trug diese Toga erst seit knapp zwei Monaten und die beiden schienen seinen frischen Stolz genau zu bemerken. Als der eine mit dem Fuß eins der verschnürten Pakete lässig an die Seite schob, um Caius Platz zu machen, hatte auch diese Geste etwas Respektloses.
Liefert lieber eure Ware ab, anstatt hier den Tag zu vertrödeln, dachte Caius noch, dann trat er aus dem Schatten des Säulenganges und stand nach ein paar Schritten und drei Stufen auf dem riesigen Platz des Forums.
Licht und Wärme kamen hier von allen Seiten, er spürte die Sonne im Nacken und musste die Augen zukneifen, so grell warf der mit Marmorplatten ausgelegte Boden das Licht zurück. In seinem Rücken machte der Säulengang einen ersten Knick und nach etwa sechzig Schritten einen zweiten, dann lief er wieder auf den Tempel zu, der an der gegenüberliegenden Schmalseite den Abschluss des Forums bildete. Mitten auf dem Platz stand auf einem mannshohen Sockel eine vergoldete Skulptur, die die ganze Fläche beherrschte: ein vierspänniger Triumphwagen. Caius hatte schon oft hier gestanden, doch immer wieder weckte die Figurengruppe in ihm grenzenlose Bewunderung, weniger wegen ihrer Größe als vielmehr wegen der fast unglaublichen Detailgenauigkeit und Lebendigkeit der Darstellung. Vier Pferde zogen den Wagen, und der Künstler – ein Grieche, wie fast alle großen Bildhauer – hatte es verstanden, ihre unbändige Bewegung so einzufrieren, dass es schien, sie würden jeden Augenblick zum Leben erwachen und weiter voranstürmen: Nervös warfen sie die Köpfe mit den geblähten Nüstern, an Flanken und Beinen zeichneten sich die Muskeln ab und an den Hälsen waren selbst die kleinsten Adern herausgearbeitet. Sechzehn Hufe stemmten sich in den Boden oder wirbelten durch die Luft, eins der Pferde schien gerade steigen zu wollen, und man hörte beinahe das Ächzen der Deichsel. Die ungestüme Dramatik des Gespanns wurde durch den Kontrast zur lässigen Pose des Wagenlenkers noch gesteigert: Sicher und ruhig stand er da und hatte es nicht nötig, sich anzulehnen oder festzuhalten. Seine Arme hatte er leicht abgewinkelt und nach vorn gestreckt. In seinen Händen ruhten die Zügel, als habe sie jemand behutsam hineingelegt. Er trug eine Feldherrenuniform und einen Brustpanzer, der über und über mit Reliefs geschmückt war. In seinen Gesichtszügen wiederholte sich die gelassene Überlegenheit der ganzen Pose: ein schmaler, kaum merklich geschwungener Mund, eine gerade Nase, Augen, die über die Pferderücken hinweg in die Ferne zu blicken schienen. Die Haare waren in Strähnen nach vorn gekämmt und wurden von einem Lorbeerkranz eingerahmt. Das Gesicht war Caius bestens vertraut; man konnte in Rom um keine Ecke biegen, ohne diesem Mann zu begegnen. Als Statue, Büste oder Relief hatte ein Heer von Steinmetzen ihn tausendfach aus dem Marmor geschält und sein Namenszug sprang einem von fast allen Inschriften an öffentlichen Gebäuden entgegen: Caius Julius Caesar Augustus, Princeps und Imperator, Großneffe und Adoptivsohn des göttlichen Caesar. Unwillkürlich schossen Caius die zahlreichen Titel durch den Kopf, mit denen der Senat Augustus im Laufe seiner mehr als vierzigjährigen Herrschaft geehrt hatte. Augustus war mächtiger, als je ein Mann in Rom gewesen war, und Rom war unter seiner Führung mächtiger geworden als jedes andere Reich auf der Erde. Die höchsten Ämter des Staates liefen in seinen Händen zusammen wie die Zügel des goldenen Gespanns, das in der Nachmittagssonne glänzte.
Читать дальше