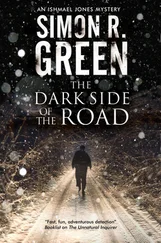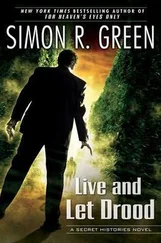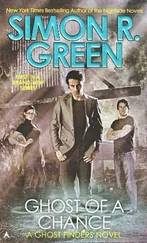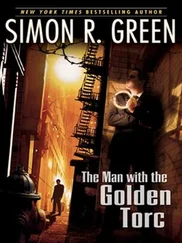»Gute Schau, die du für die Landgrafen abgezogen hast, Thomas!«
»Danke, Johann. Der Trick kam gut rüber, was?«
»Musstest du Bedivere unbedingt auf dem Bauch kriechen lassen?«
Thomas Grey runzelte die Stirn. »He, Johann, der Mann ist ein Killer! Die Barone wussten das, als sie ihn zu ihrem Sprecher wählten. Er hätte dich umgebracht.«
»Ich weiß«, sagte der König kurz. »Aber kein Mensch sollte derart gedemütigt werden. Es war so… unwürdig.«
»Hör mal, Johann, darüber haben wir uns gestern Abend ausführlich unterhalten. Es gibt nur eine Möglichkeit, die Barone in Schach zu halten: Ihre Angst vor uns muss stärker sein als ihre Angst vor dem Dunkel. Aber wie bitte soll ich sie einschüchtern, wenn ich meine Zauberkräfte nicht einsetzen darf? Außerdem habe ich den Mann nicht ernstlich verletzt, Johann. Ich habe ihn nur gezwungen, das zu tun, was ohnehin seine Pflicht gewesen wäre.«
»Und der Blitz?«
»Optische Täuschung, mehr oder weniger. Die Energie reichte gerade aus, um ihn von den Beinen zu holen.«
»Du begreifst nicht, worum es geht, Thomas. Wir wollten das Curtana-Schwert nur deshalb aus der Versenkung holen, um den Baronen und dem Hofstaat zu beweisen, dass wir nicht völlig hilflos gegen das Dunkel sind. Aber nach dieser Abreibung für Sir Bedivere denkt keiner mehr an die Dämonen! Stattdessen fragen sich die Leute, ob wir dieses Schwert in erster Linie gegen sie einsetzen werden.«
»Verdammt«, sagte Grey. »Tut mir Leid, Johann. Daran hatte ich nicht gedacht…«
»So wie es im Moment aussieht, ist es ungeheuer riskant, das Curtana einzusetzen, ganz zu schweigen von den Schwertern der Hölle. Wenn die Barone auch nur den leisesten Verdacht hegen, dass wir diese Klingen ebenfalls verwenden wollen…«
»… dann kommt es zu einer offenen Rebellion. Ich verstehe deine Argumente, Johann, aber wir sind auf diese Schwerter angewiesen. Die Finsternis rückt immer näher, und es hat wenig Sinn, sich allein auf den Großen Zauberer zu verlassen.
Wir wissen nicht einmal mit letzter Sicherheit, ob er überhaupt kommt.«
»Er kommt«, sagte der König. »Du weißt, dass er kommt.«
Ein unbehagliches Schweigen breitete sich aus. Grey hüstelte verlegen. »Ich kenne deine Gefühle ihm gegenüber, Johann. Aber wir brauchen ihn.«
»Ich weiß.«
»Vielleicht hat er sich geändert. Das ist alles so lange her.«
»Ich möchte nicht darüber sprechen.«
»Johann…«
»Ich möchte nicht darüber sprechen.«
Thomas Grey schaute den König an und senkte dann den Blick, weil er den Hass, die Bitterkeit und das Leid in den Augen des alten Freundes nicht ertragen konnte.
»Erzähl mir mehr von den Schwertern der Hölle«, bat der König. »Es ist Jahre her, seit ich mich mit diesem blutrünstigen Zeug befassen musste.«
»Offenbar gab es ursprünglich sechs dieser Schwerter«, erklärte der Astrologe ruhig. »Aber wir besitzen nur noch drei davon – Blitzstrahl, Hundsgift und Felsenbrecher. Seit Jahrhunderten hat es niemand mehr gewagt, sie anzufassen.«
»Sind sie wirklich so mächtig, wie die Legenden behaupten?«
Grey zuckte die Achseln. »Wahrscheinlich noch mächtiger. Die Geschichtsschreiber wagen es kaum, die Namen zu erwähnen.«
»Wie dem auch sei«, knurrte der König, »sie befinden sich ebenso wie das Curtana im Alten Arsenal. Und das Alte Arsenal befindet sich im Südflügel. Und den Südflügel können wir nicht finden, seit er uns vor zweiunddreißig Jahren verloren ging.«
»Der Seneschall behauptet, er könne ihn aufspüren«, warf Grey ruhig ein. »Und ich glaube ihm. Er findet sich auf der Burg besser als jeder andere zurecht.«
»Mag sein.« Der König fuhr sich geistesabwesend durch das widerspenstige Haar und seufzte müde. »Ach, Thomas, manchmal wünsche ich mir, du wärst ein echter Sterndeuter und könntest in die Zukunft schauen.«
Grey lachte. »Leider ist mein Titel nicht mehr als ein Erbe unserer abergläubischen Vorfahren, Johann. Genau genommen bin ich nicht mal Astrologe, sondern Astronom. Zeig mir die Eingeweide eines Schafes, und ich könnte dir höchstens verraten, welche Suppe sich daraus kochen lässt.«
Der König lächelte und nickte bedächtig. »Es war nur so ein Gedanke, Thomas. Ein albernes Hirngespinst, mehr nicht.« Er erhob sich steif und ließ die Blicke durch den leeren Thronsaal wandern. »Wird Zeit, dass ich schlafen gehe. Ich bin in letzter Zeit dauernd müde.«
»Du arbeitest zu viel. Wir arbeiten beide zu viel. Es wird höchste Zeit, dass Harald einen Teil deiner Pflichten übernimmt. Er ist alt genug, um uns ein wenig zu entlasten.«
»Nein«, entgegnete der König kurz angebunden. »Er muss noch viel lernen.«
»Du kannst das nicht ewig hinausschieben, Johann. Irgendwann musst du die Zügel loslassen. Wir werden langsam älter.«
»Langsam nennst du das?« Der König lachte trocken und betrat die Stufen des Podests. Als der Astrologe ihm helfen wollte, stieß er seinen Arm unwirsch beiseite. »Ich bin müde, Thomas. Sprechen wir morgen darüber.«
»Johann…«
»Morgen, Thomas.«
Der Astrologe sah dem König nach, wie er langsam den leeren Saal durchquerte. »Morgen ist es vielleicht zu spät, Johann«, murmelte er, aber wenn der König seine Worte gehört hatte, dann beachtete er sie nicht.
»Sie könnten König sein, Harald«, sagte Lord Darius.
»Ich werde König sein«, entgegnete Harald. »Als ältester Sohn bin ich der rechtmäßige Thronerbe. Eines Tages wird das Waldkönigreich mir gehören.«
»Wenn Sie so lange warten wollen, werden Sie ein König ohne Land sein.«
»Das ist Hochverrat.«
»Ja«, bestätigte Lord Darius liebenswürdig.
Die beiden Männer lächelten, hoben die Kelche und kosteten den Wein. Als Harald den guten Jahrgang lobte, beugte sich Lady Cecelia anmutig vor und füllte sein Glas bis zum Rand. Der Prinz dankte höflich, lehnte sich bequem zurück und ließ die Blicke umherschweifen. Nach all den Geschichten, die ihm über den Lebensstil von Darius zu Ohren gekommen waren, hatte er in den Gemächern des Kriegsministers mehr Pomp und Luxus erwartet – dicke Teppiche und verschwenderische Tapeten. Stattdessen befand er sich in einem nüchternen, fast streng möblierten Raum mit einem schlichten Dielenboden und Vertäfelungen aus poliertem Holz, der von einem einzigen Kamin erwärmt wurde. Eine Wand verschwand völlig hinter einem massiven Bücherregal, das eine Fülle von Werken über Politik, Geschichte und Zauberei enthielt. Harald ließ sich sein Erstaunen nicht anmerken. Offenbar steckte in dem Kriegsminister mehr, als man auf den ersten Blick wahrnahm. Der Prinz nahm einen Schluck Wein und studierte sein Gegenüber über den Kelchrand hinweg. Das Gesicht des Mannes war von einer plumpen Hässlichkeit, die weder durch die Puderschichten noch durch die sorgfältig gezupften Augenbrauen oder das geölte Haar zu verbergen war, und wenn er die Maske fallen ließ, die er in der Öffentlichkeit trug, wirkten seine Züge eiskalt und zum Äußersten entschlossen.
Dieser Mann kann gef ährlich werden, dachte Harald ruhig.
Er ist ehrgeizig und skrupellos – eine nützliche Kombination auf jedem Sektor, insbesondere aber in der Politik. Sieht sich vermutlich als Königmacher.
Harald wandte seine Aufmerksamkeit Lady Cecelia zu, der Gemahlin von Lord Darius. Sie erwiderte seinen Blick mit einem trägen Lächeln, das eine deutliche Aufforderung enthielt. Ihr nachtschwarzes Haar, das in Kaskaden auf die entblößten Alabasterschultern fiel, umrahmte und betonte das hübsch geschnittene Gesicht. Sinnlichkeit glomm in den dunklen Augen und umspielte den vollen Mund. Sie hatte das reich bestickte Gewand, das sie zu offiziellen Anlässen trug, mit einem schmalen, geschlitzten Seidenkaftan vertauscht, der bei jeder Bewegung aufreizende Ansichten freigab. Verlockend, dachte Harald. Und nicht gerade zurückhaltend, obwohl ihr Mann anwesend ist. Nicht zum ersten Mal fragte sich Harald, was Darius und Cecelia aneinander fanden. Sie waren ohne Zweifel ein ernst zu nehmendes politisches Gespann, aber Cecelias Affären mit den jungen Gardeoffizieren sorgten bei Hofe ständig für neuen Klatsch. Darius musste davon wissen, aber er äußerte sich nie dazu. Jeder nach seinem Geschmack, dachte Harald spöttisch.
Читать дальше