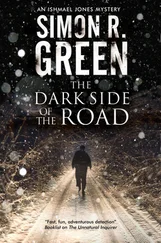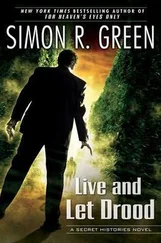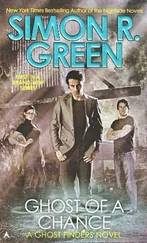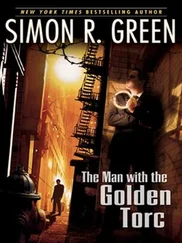Nach einer Weile hatte Rupert sich wieder in der Gewalt und löste sich von Julia. Die Prinzessin gab ihn sofort frei.
Sie strich sein Hemd glatt und rückte den Brustpanzer gerade, um ihn nicht ansehen zu müssen, während er gegen die Tränen ankämpfte. Rupert war in diesen Dingen komisch.
»Wann wird das Burgtor geöffnet?«, fragte sie mit betont ruhiger Stimme.
»Das kann nicht mehr lange dauern.« Rupert lächelte Julia an, während sie an ihm herumzupfte, und runzelte plötzlich die Stirn, als er den lederumwickelten Schwertgriff hinter ihrer linken Schulter aufragen sah. »Julia, woher hast du diese Waffe?«
»Der König wollte, dass ich sie trage. Er sagte, du hättest sie abgelehnt.«
»Das stimmt. Ich wünschte, du hättest das auch getan.«
»Es ist doch nur ein Schwert, Rupert.«
»Nein, eben nicht! Das Ding auf deinem Rücken ist eines der drei Höllenschwerter. Die Waffen richteten einst solches Unheil an, dass meine Vorfahren sie fünfhundert Jahre lang sicher im Arsenal verwahrten, anstatt sie zu benutzen.«
»Wie kann ein Schwert solche Furcht auslösen?«
Rupert sah sie mit festem Blick an. »Der Legende nach besitzen die Schwerter ihr eigenes Leben und verderben die Seelen jener, die sie tragen.«
Julia schüttelte ungeduldig den Kopf. »Ein Schwert ist ein Schwert. Nun ja, es fühlt sich irgendwie… sonderbar an.
Aber solange es Dämonen tötet, kann ich es gut gebrauchen.
Außerdem trägst du selbst ein Zauberschwert.« Julia stockte plötzlich und sah Rupert nachdenklich an. »Das Regenbogenschwert… das hatte ich völlig vergessen. Weshalb können wir es nicht gegen die Finsternis einsetzen? Es hat sie schon einmal vertrieben, oder?«
Rupert schüttelte den Kopf. »Das habe ich bereits versucht, Julia. Vergeblich. Der Zauber wirkt nicht mehr.«
Julia machte ein enttäuschtes Gesicht, und einen Moment lang schwiegen sie beide. Dann glitten die Blicke der Prinzessin zur Stalltür. »Rupert, ich kann nicht mehr lange bleiben. Die Frauen warten auf mich.«
»Ja. Ich habe euch beim Exerzieren beobachtet. Die Truppe machte einen guten Eindruck.« Rupert grinste plötzlich.
»Ich weiß nicht, Mädchen! Es ist fast unfair, dich mit einem Höllenschwert und einer Schar wild entschlossener Kämpferinnen auf die Dämonen loszulassen.
Wir wollen sie schließlich nur töten und nicht zusätzlich in Angst und Schrecken versetzen.«
Julia lachte. »Das zahle ich dir heim – nach der Schlacht!«
»Versprochen?«
»Versprochen.«
Sie sahen einander in die Augen. Rupert streckte die Arme aus und nahm Julias Hände in seine.
»Was immer geschieht… ich liebe dich. Daran darfst du niemals zweifeln.«
»Ich liebe dich auch, Rupert. Pass auf dich auf, wenn wir erst mal da draußen sind!«
»Verlass dich drauf! Und nach dem Sieg…«
»Genau«, unterbrach ihn Julia. »Nach dem Sieg nehmen wir uns die Zeit für andere Dinge.«
Sie küssten sich lange, ehe Julia den Stall verließ und zu ihrer Truppe zurückkehrte. Rupert schaute ihr nach und war zum ersten Mal seit langem mit sich und der Welt in Frieden.
Er schob eine Hand in das Kettenhemd und zog aus seinem Lederwams ein verknittertes, zerfranstes Taschentuch mit bräunlichen Blutflecken hervor. »Das Unterpfand meiner Herzensdame«, sagte er leise. Er berührte das Tuch mit den Lippen und schob es dann vorsichtig wieder in sein Wams, genau über dem Herzen.
»Lanciers, aufsitzen! Torwachen, haltet euch bereit!«
Die Stimme des Champions dröhnte über den Burghof. Einen Moment lang verstummte das Stimmengewirr, um gleich darauf verstärkt wieder einzusetzen, vermischt mit lauten Befehlen und Pferdegewieher. Rupert atmete tief durch, straffte die Schultern und führte das Einhorn aus dem Stall.
Der Champion saß auf einem mächtigen Streitross mit tückischem Blick. Auf seiner frisch polierten Rüstung spiegelte sich das rötliche Licht der Fackeln. Imposant und unbezwingbar ragte er aus der Menge heraus, ein Held, wie ihn die alten Balladen besangen. Er hob ungeduldig seine Streitaxt, und hundert berittene Lanciers nahmen hinter ihm Aufstellung. Die angelegten Lanzen ragten stolz in den sternenlosen Nachthimmel, die glänzenden Schäfte mit bunten Bändern und den Tüchern der Liebsten geschmückt. Die Fußsoldaten reihten sich hinter den Lanciers ein; lachend und scherzend ließen sie ein letztes Mal die Weinflaschen kreisen. Sie stampften mit den Füßen, um sich warm zu halten, und spähten erwartungsvoll zu den geschlossenen Burgtoren hinüber, erleichtert, dass das Warten endlich ein Ende hatte. Nach ihnen kam die Schar der Höflinge, Bauern und Händler. Man sah ihnen an, wie unbehaglich sie sich in ihren schlecht sitzenden Rüstungen fühlten, aber sie waren fest entschlossen, ihr Bestes zu geben. Männer und Frauen standen Seite an Seite, mit Schwertern, Piken und Handäxten, und kein Mensch fand das sonderbar. Die Frauen kämpften aus dem gleichen Grund wie die Männer – weil sie gebraucht wurden und weil sonst niemand da war, der das Land verteidigen konnte.
Rupert bestieg das Einhorn und bahnte sich mühsam einen Weg durch die Menge, um seinen Platz an der Spitze des Heeres einzunehmen. Eine Hand voll Gardisten erschien aus dem Nichts und bildete eine Eskorte für ihn. Rupert nickte ihnen zu, und die zehn Männer, die er aus dem Dunkelwald in die Residenz zurückgeführt hatte, salutierten mit ihren Schwertern.
»Was zum Henker sucht ihr hier?«, fragte Rupert. »Solltet ihr nicht im Lazarett eure Verwundungen auskurieren?«
»Wer laufen kann, ist nicht verwundet«, erklärte Rob Hawke. »So lautete der Marschbefehl. Außerdem ist geteiltes Vergnügen das doppelte Vergnügen. Wir hatten gerade den Bogen raus, wie man mit Dämonen umspringt, als Sie uns zurück in die Kasernen scheuchten.«
»Ihr wisst, dass die Feinde weit in der Überzahl sind«, begann Rupert und wurde vom spöttischen Gelächter seiner Männer unterbrochen.
»Das waren sie in jüngster Zeit meistens«, grinste Hawke.
»Wir gewöhnen uns allmählich daran.«
»Verloren!«, stöhnte einer der Gardisten mit Grabesstimme. »Wir sind alle verloren!«
Seine Kameraden stimmten einen getragenen Trauerchoral an, fanden ihn aber nach wenigen Takten zu langweilig und wechselten zu einem schnelleren Tempo. Die Leute ringsum starrten die Gardisten an und schauten dann betreten zur Seite. Der Prinz musste so lachen, dass ihm die Luft wegblieb. Als die kleine Gruppe mit Rupert an der Spitze das Burgtor erreichte, marschierte sie zu den Klängen eines derben Soldatenlieds, in dem in regelmäßigen Abständen das Wort verloren vorkam.
König Johann kniete im Schatten des inneren Nordwalls neben seinem Pferd und mühte sich mit dem störrischen Sattelgurt ab. Sein wirres graues Haar wurde von einem schlichten ledernen Stirnband zusammengehalten, und sein Kettenpanzer trug die Spuren zahlreicher Feldzüge. Obwohl sich Felsenbrecher an seinen Rücken schmiegte, als wäre es ein Teil von ihm, hatte er zusätzlich sein vertrautes altes Schwert umgeschnallt. Der Astrologe stand neben ihm und sah ihm geduldig zu. Schließlich bückte er sich und zog den Riemen mit ein paar geschickten Handgriffen straff.
»Danke«, brummte der König und richtete sich mühsam auf. »Mit Pferden konnte ich noch nie besonders gut umgehen.«
»Keine Ursache, Johann.«
»Ich bin froh, dass du bei mir bist, Thomas. Allen anderen scheint es verdammt egal zu sein, ob ich am Leben bleibe oder vor die Hunde gehe.«
»Du vergisst deine Familie.«
»Familie!« König Johann lachte verächtlich. »Ich habe seit dem Tod von Eleanor keine Familie mehr. Meine Söhne und ich stehen einander nicht gerade nahe. Harald schätze ich als guten Kämpfer und noch besseren Staatsmann, aber sein Herz ist so leer wie der Beutel eines armen Schluckers. Ich glaube nicht, dass er ein echtes Gefühl kennt… selbst wenn es ihn bisse.«
Читать дальше