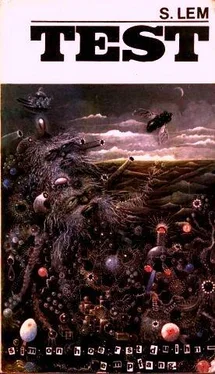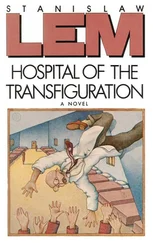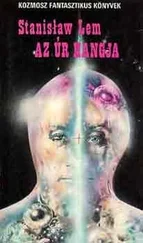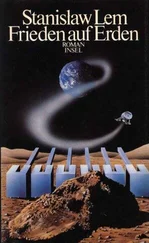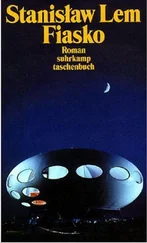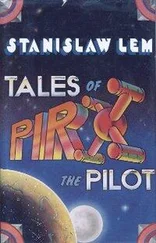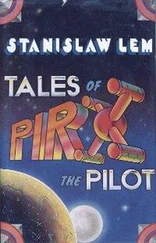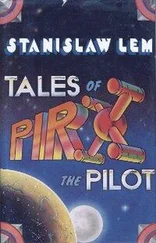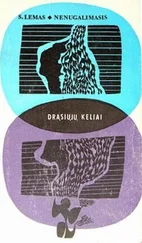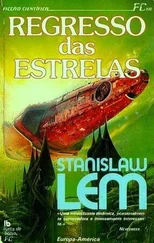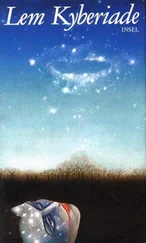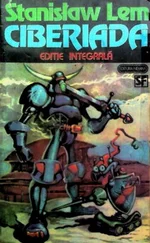Sie rauschte, summte und fuhr fort: „Man muß eine allgemeine Theorie der Bekämpfung von Elektrodrachen schaffen, für die der Monddrache ein Einzelfall sein wird, der kinderleicht zu lösen ist.“
„Dann stelle bitte eine solche Äeorie auf!“ sagte der König.
„Zu diesem Zweck muß ich zunächst verschiedene experimentelle Elektrodrachen bauen.“
„O nein! Vielen Dank!“ rief der König aus. „Der Drache will mich meines Grones berauben, und was soll erst werden, wenn du eine Unmenge von diesem Gezücht hergestellt hast!“
„So? Na, dann müssen wir eben zu einer anderen Methode Zuflucht nehmen. Laß uns die strategische Variante der fortlaufenden Annäherung anwenden. Geh und telegrafiere dem Drachen, daß du ihm den ron abtreten wirst, wenn er drei ganz einfache mathematische Operationen ausführt. Der König ging hin und telegrafierte, und der Drache war einverstanden. Flugs lief der König zu der Maschine zurück.
„Jetzt“, sagte sie, „nenne ihm die erste Handlung, die er auszuführen hat: Er soll sich durch sich selbst teilen!“
Der König tat es. Der Elektrodrache teilte sich durch sich selbst, und da in einem Elektrodrachen nur ein Elektrodrache steckt, blieb er weiter auf dem Mond, und nichts hatte sich geändert.
„Ach, was hast du nur getan!“ klagte der König, während er so schnell in die Kasematten hinunterlief, daß ihm die Pantoffeln von den Füßen flogen. „Der Drache hat sich durch sich selbst geteilt, und da einer in einem nur einmal steckt, ist er nach wie vor auf dem Mond, und gar nichts hat sich geändert.“
„Macht nichts, ich habe es absichtlich getan, das war ein Täuschungsmanöver“, entgegnete die Maschine. „Nun teile ihm mit, er soll die Wurzel aus sich ziehen.“ Der König telegrafierte zum Mond, und der Drache begann die Wurzel zu ziehen. Er zog, zog, bis er in allen Fugen krachte, er schnaubte und bebte, doch plötzlich ließ die Spannung nach — die Wurzel war gezogen!
Der König kehrte zu der Maschine zurück. „Der Drache hat gekracht, gezittert, geknirscht, aber er hat die Wurzel gezogen und bedroht mich weiter!“ rief er schon auf der Schwelle aus. „Was soll ich jetzt tun, alte Ma das heißt Euer Ferromagnetizität?“
„Sei guter Dinge“, beruhigte sie ihn. „Sage ihm nun, er soll sich von sich selbst subtrahieren.“
Der König eilte ins Schlafgemach, telegrafierte, und der Drache fing an, sich von sich selbst zu subtrahieren. Zuerst nahm er sich den Schwanz ab, dann die Beine, dann den Rumpf, und schließlich, als er merkte, daß etwas nicht in Ordnung war, zögerte er, aber das Subtrahieren war schon so in Schwung, daß es von selbst weiterlief. Er nahm sich noch den Kopf, und übrig blieb Null, das heißt nichts — es gab keinen Elektrodrachen mehr!
„Es gibt keinen Elektrodrachen mehr!“ frohlockte der König, als er in die Kasematten eilte. „Vielen Dank, alte Rechenmaschine, vielen Dank. Du hast genug gearbeitet, gönne dir jetzt eine Ruhepause, ich schalte dich aus, ja?“
„O nein, mein Lieber“, erwiderte die Maschine. „Der Mohr hat seine Arbeit getan, der Mohr kann gehen? Du willst mich ausschalten und nennst mich nicht mehr Euer Ferromagnetizität! Oh, ist das häßlich! Jetzt verwandle ich mich in einen Elektrodrachen, mein Lieber, vertreibe dich aus deinem Königreich und werde selbst regieren, sicherlich besser, als du es vermagst, denn du hast mich ja ohnehin immer in allen wichtigen Dingen befragt, so daß eigentlich ich regiert habe und nicht du. Und schon begann sie sich summend und dröhnend in einen Elektrodrachen zu verwandeln; schon ragten ihr flammende Elektrokrallen aus den Flanken, da zog der König, atemlos vor Entsetzen, die Pantoffeln aus, sprang an sie heran und begann, blindlings auf ihre Röhren einzuschlagen. Die Maschine summte, ächzte, in ihrem Programm geriet etwas durcheinander — aus dem Wort Elektrodrache wurde Elektroteer, und vor den Augen des Königs verwandelte sich die Maschine, immer leiser wimmernd, in eine gewaltige Lache kohlschwarzen Elektroteers, der knisterte und prasselte, bis die gesamte Elektrizität in blauen Funken entwichen war und vor dem verblüfften König Poleander nur ein großer, teeriger Tümpel dampfte
Der König atmete erleichtert auf, zog die Pantoffeln an und kehrte in das königliche Schlafgemach zurück. Von nun an änderte er sich jedoch sehr; die Abenteuer, die er erlebt hatte, hatten seinen kriegerischen Neigungen den Stachel genommen, und er befaßte sich bis ans Ende seiner Tage nur noch mit der zivilen Kybernetik, die militärische aber ließ er sein.
Stanislaw Lem, Romancier, Erzähler und Essayist, ist heute einer der prominentesten Vertreter des utopischen Genres in den sozialistischen Ländern. Seine Romane und Erzählungen erfreuen sich allgemeiner Beliebtheit, viele sind zu Bestsellern geworden. Das ist wohl nicht allein auf das Interesse für die Weltraumfahrt zurückzuführen, das seit dem Start des ersten Sputniks auch für die Science-fiction wach wurde. Lem verdankt seine Erfolge nicht zuletzt der realistischen Substanz seiner Bücher. Seine Romane und Erzählungen über die ferne Zukunft wurzeln in unserer Gegenwart, haben in ihr ihre Bezüge. Wenn seine Helden Sympathie oder Abneigung in uns wecken, dann deshalb, weil wir sie, obwohl sie in einer uns fremden Welt agieren, mit unseren Maßstäben messen, weil wir an ihnen vertraute Züge entdecken, weil ihre Konflikte uns nicht fremd sind. Dieser humanistischen Konstellation verdanken es Lems Bücher, daß sie mehr sind als bloße Unterhaltungsliteratur. Lem ist im Grunde ein Moralist, der mit der Utopie seiner Zeit einen Spiegel vorhalten will, ein Zweifler, der Fragen stellt, wo alles klar zu sein scheint, er ist, wenn auch uneingestanden, ein Weltverbesserer.
Der Autor, der über ein enormes technisches Wissen verfügt, hält sich über alle neuen Ergebnisse der Weltraumforschung auf dem laufenden. Vor allem interessiert ihn jedoch, wie sich der Mensch in einer vom technischen Fortschritt bestimmten Zukunft zurechtfindet. Dem in der Science-fiction-Literatur westlicher Prägung beschworenen makabren Bild vom zukünftigen Menschen, der zum bloßen Anhängsel einer übertechnisierten Welt degradiert ist, stellt Lem in seinen Romanen und Erzählungen seine humanistische Auffassung entgegen. Lem ist der festen Überzeugung, daß die Menschen selbst ihre Geschicke in der Hand haben, daß sie über ihre und ihrer Nachkommen Zukunft entscheiden, daß die schöpferische Kraft des Menschen die Technik nicht nur schaffi, sondern sie zum Nutzen der Allgemeinheit beherrscht. Pirx, Held von vier Geschichten dieses Bandes, ist kein Superman, sondern ein normaler Mensch unserer Tage. Wenn er aus gefährlichen Situationen, die eine persönliche Entscheidung abverlangen, als Sieger hervorgeht, dann deshalb, weil er es nicht verlernt hat, seinen gesunden Menschenverstand zu gebrauchen. Lems Weltraumhelden sind unheroisch, und es sind letzten Endes ihre „menschlichen“ Eigenschaften, ihre Opferbereitschaft, ihr Mut, ja sogar ihre Fähigkeit, Angst zu haben, mit denen sie alle Probleme meistern. Das mag einer der Gründe für die lobenden Worte sein, die Kosmonaut Boris Jegorow für Lems positiven Helden fand.
Stanislaw Lem, geboren am 12.9.1921, der während des Krieges Autoschlosser und Mechaniker, danach Medizinstudent und schließlich Arzt war, ist den Lesern in der DDR längst kein Unbekannter mehr. Seinem ersten großen Roman „Die Irrungen des Dr. Stefan T.“, den Lem 1948 schrieb, folgten die utopischen Romane „Planet des Todes“ und „Gast im Weltraum“. Als Erzähler wurde Lem bei uns bislang nur mit seinen „Sterntagebüchern Ijon Tichys“ vorgestellt. Gerade hier aber, in der kleinen Form, offenbart sich der Autor als ein Meister seines Faches. Seine utopischen Erzählungen zeigen ihn in seiner ganzen Vielseitigkeit: Lem beherrscht die spannende Detektivgeschichte, er bedient sich aber mit gleicher Brillanz der geistreichen Groteske und eines ironisch gefärbten Märchenstils. Zu diesen Mitteln greift der Autor in der Regel, wenn er negative Erscheinungen der Wirklichkeit angreifen will; dann stellt er seine Science-fiction in den Dienst der Satire, dann ist das utopische Genre seinen kritischen Intentionen untergeordnet.
Читать дальше