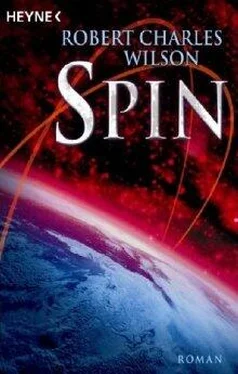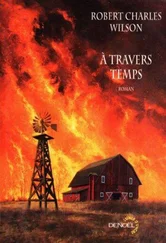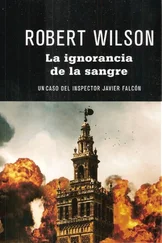»Ich werde dir etwas gegen die Schmerzen geben. Und das hier müssen wir zunähen.«
»Näh es zu, wenn du musst, aber ich will keine Medikamente. Wir müssen hier weg.«
»Du willst doch nicht, dass ich dich ohne Betäubung zusammenflicke.«
»Dann eben was Örtliches.«
»Wir sind hier nicht im Krankenhaus. Für eine örtliche Betäubung habe ich nichts dabei.«
»Dann näh einfach los, Tyler. Ich halte das schon aus.«
Ja, aber konnte ich es auch? Ich sah meine Hände an. Sie waren sauber — es gab fließendes Wasser im Waschraum der Lagerhalle —, und Ina half mir, die Latexhandschuhe überzustülpen, bevor ich Diane verarztete. Sauber waren sie also. Aber nicht gerade ruhig.
Ich war nie zimperlich gewesen, was meine Arbeit betraf. Schon als Medizinstudent und selbst beim Sezieren war ich imstande gewesen, das Gefühl auszuschalten, das uns den Schmerz eines anderen mitempfinden lässt, als sei es unser eigener. So zu tun, als sei die gerissene Arterie, die meiner Behandlung bedurfte, nicht mit einem lebendigen Menschen verbunden. So zu tun — und es während der erforderlichen Minuten auch wirklich zu glauben.
Doch jetzt zitterte meine Hand, und die Vorstellung, eine Nadel durch diese blutigen Fleischränder zu stoßen, erschien mir brutal, von nicht zu rechtfertigender Grausamkeit.
Diane umfasste mein Handgelenk. »Es ist eine Vierten sache«, sagte sie.
»Was?«
»Du hast das Gefühl, die Kugel hätte dich getroffen statt mich. Stimmt’s?«
Ich nickte erstaunt.
»Das ist typisch für Vierte. Ich glaube, es soll uns zu besseren Menschen machen. Aber du bist immer noch Arzt. Du musst da durch.«
»Falls ich es nicht kann, übergebe ich an Ina.«
Aber irgendwie ging es. Ich konnte es und ich tat es.
Nach einiger Zeit kehrte Ina von ihrer Besprechung mit Jala zurück. »Heute sollten Arbeitskampfmaßnahmen stattfinden. Die Polizei und die Reformasi stehen vor den Toren und beabsichtigen, den Hafen unter ihre Kontrolle zu bringen. Man rechnet mit Zusammenstößen.« Sie sah Diane an. »Wie sieht’s aus bei Ihnen, meine Liebe?«
»Ich bin in guten Händen«, flüsterte Diane mit brüchiger Stimme.
Ina begutachtete meine Arbeit. »Kompetent«, erklärte sie.
»Danke«, erwiderte ich.
»Wenn man die Umstände bedenkt. Aber hört zu, ihr beiden. Wir müssen dringend weg. Das Einzige, was im Moment zwischen uns und dem Gefängnis steht, ist der Arbeiteraufstand. Wir müssen umgehend auf die Capetown Maru.«
»Die Polizei sucht nach uns?«
»Ich glaube, nicht nach Ihnen speziell. Jakarta hat irgendeine Art von Vereinbarung mit den Amerikanern getroffen, das Emigrationsgewerbe zu bekämpfen. Also wurden die Docks immer mal wieder durchsucht, hier und anderswo, unter viel öffentlichem Getöse, damit die Leute vom US-Konsulat auch ordentlich beeindruckt sind. Natürlich ist das nicht von Dauer. Es geht zu viel Geld durch zu viele Hände, als dass das Geschäft ernsthaft unterdrückt werden würde. Aber für den äußeren Schein gibt es nichts Besseres, als wenn uniformierte Polizei ein paar Menschen aus den Laderäumen von Frachtschiffen zerrt.«
»Sie sind zu Jalas Unterschlupf gekommen«, sagte Diane.
»Ja, sie wissen über Sie und Dr. Dupree Bescheid, sie würden Sie auch gern in Gewahrsam nehmen, aber das ist nicht der Grund, warum dort draußen Polizei steht. Es laufen nach wie vor Schiffe aus dem Hafen aus, doch nicht mehr lange. Die Gewerkschaft ist ziemlich stark hier in Teluk Bayur. Sie werden kämpfen.«
Jala rief etwas von der Tür her, Worte, die ich nicht verstand.
»Jetzt müssen wir wirklich los«, sagte Ina.
»Helfen Sie mir, eine Trage für Diane zu machen.«
Diane versuchte sich aufzusetzen. »Ich kann gehen.«
»Nein«, sagte Ina. »In diesem Punkt muss ich Tyler Recht geben. Bewegen Sie sich möglichst nicht.«
Wir legten weitere vernähte Jutestücke übereinander und bildeten daraus eine Art Hängematte. Ich nahm das eine Ende, und Ina wies einen der stämmigeren Minang-Männer an, am anderen Ende anzupacken.
»Beeilung jetzt!«, rief Jala und winkte uns in den Regen hinaus.
Monsunzeit. War dies ein Monsun? Der Morgen sah aus wie die Abenddämmerung. Wolken zogen wie nasse Wollknäuel über das graue Wasser von Teluk Bayur, schnitten die Türme und Radarschirme der großen Doppelrumpftanker ab. Die Luft war heiß und roch übel. Der Regen durchnässte uns schon in der kurzen Zeit, die wir brauchten, Diane in den wartenden Wagen zu laden. Jala hatte für seine Emigrantentruppe einen kleinen Konvoi organisiert: drei Autos und ein paar kleine Transporter mit offenem Verdeck und harten Gummireifen.
Die Capetown Maru hatte am Ende eines hohen Betonpiers festgemacht, etwa einen halben Kilometer entfernt. In entgegengesetzter Richtung — reihenweise Lagerhallen, aufgetürmte Industriewaren und fette rotweiße Avigas-Behälter lagen dazwischen — hatte sich eine dichte Menge von Dockarbeitern am Tor versammelt. Über das Trommeln des Regens hinweg konnte ich jemanden durch ein Megaphon sprechen hören. Dann Geräusche, die wie Schüsse klangen.
»Steigen Sie ein.« Jala drängte mich auf den Rücksitz des Autos, wo sich Diane über ihre Wunde beugte, als würde sie beten. »Schnell, schnell.« Er klemmte sich hinters Steuer.
Ich warf einen letzten Blick auf die vom Regen verwischte Menschenmenge. Ein Gegenstand von der Größe eines Footballs stieg über ihr auf, zog Spiralen von weißem Rauch hinter sich her. Tränengas.
Der Wagen schoss vorwärts.
»Das da ist nicht nur Polizei«, sagte Jala, als wir auf den schmalen Streifen des Kais bogen. »Die Polizei würde sich nicht so töricht anstellen. Das sind New Reformasi. Schlägertypen, die sie in den Slums von Jakarta von der Straße weg engagiert und in Regierungsuniformen gesteckt haben.«
Uniformen und Gewehre. Und noch mehr Tränengas, aufgerührte Wolken, die im regnerischen Dunst verschwammen. Die Menge begann sich an den Rändern aufzulösen.
Ein fernes Krachen ertönte, und ein Feuerball stieg ein paar Meter hoch in den Himmel.
Jala sah es im Rückspiegel. »Mein Gott, wie idiotisch! Da muss jemand auf ein Ölfass gefeuert haben. Die Docks…«
Sirenen heulten über das Wasser, während wir den Kai entlang fuhren. Die Menschenmenge war inzwischen in Panik geraten. Jetzt konnte ich die Polizisten sehen, die in einer Linie durch das Tor drängten. Einige von ihnen trugen schwere Waffen und Masken mit schwarzen Schnauzen. Ein Feuerwehrwagen rollte aus einem Schuppen und fuhr kreischend auf das Tor zu.
Wir fuhren über eine Reihe von Rampen und hielten dort, wo der Pier sich auf einer Höhe mit dem Hauptdeck der Capetown Maru befand, ein alter, unter Billigflagge fahrender Frachter, weiß und rostorange gestrichen. Eine stählerne Gangway war zwischen Hauptdeck und Pier ausgelegt worden, und die ersten Minang hatten sie bereits bestiegen.
Jala sprang aus dem Auto, und als ich Diane auf den Kai bugsiert hatte — auf ihren eigenen Füßen, an mich gelehnt, die Jutebahre hatten wir zurückgelassen —, war er bereits in eine hitzige, auf Englisch geführte Diskussion mit einem Mann am Ende der Gangway verwickelt: der Kapitän oder Steuermann des Schiffes vielleicht, jedenfalls jemand, der mit entsprechender Autorität ausgestattet war, ein untersetzter Mann mit einem Sikh-Turban und zusammengebissenen Zähnen.
»Es war schon vor Monaten vereinbart«, sagte Jala.
»… aber dieses Wetter…«
»… bei jedem Wetter…«
»… ohne Genehmigung der Hafenbehörde…«
»… ja, aber es ist keine Hafenbehörde da… Sehen Sie!«
Es sollte eine rhetorische Geste sein. Doch Jalas ausladende Handbewegung richtete sich gerade in dem Moment auf die Benzin- und Gasbunker nahe des Haupttors, als einer der großen Behälter explodierte.
Читать дальше