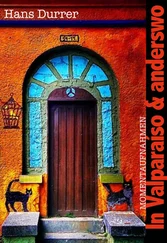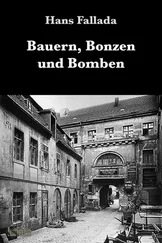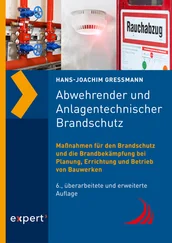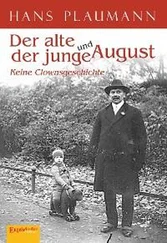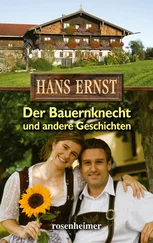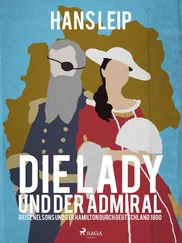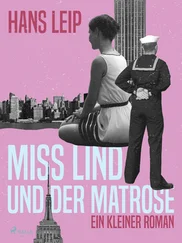Gleichzeitig haben die westlichen Sammlungen und Museen eine enorme Arbeit geleistet, die alten Manuskripte zu untersuchen, zu beschreiben und zu bewahren und sie sowohl Forschern als auch anderen Interessierten zugänglich zu machen. So kann man sagen, Westen und Osten haben beide auf ihre Weise dazu beigetragen, dass wir heute Nutzen aus den alten Büchern ziehen können: Die Mönche im Osten verfügten über die Treue und den Fleiß, den griechischen Text über Jahrhunderte mit Kriegen und Katastrophen hinweg zu bewahren, während die Sammler im Westen über die Ressourcen verfügten, die Manuskripte in der Gegenwart zugänglich zu machen. Dieser gemeinsame Einsatz ermöglicht es, dass wir uns heute über diese Manuskripte freuen und sie Menschen zeigen können, die sich für Geschichte und die alten griechischen Bibeltexte interessieren.
»Die Menschen zogen ihre Hüte …«
»Die Menschen zogen ihre Hüte, als sie zu dem Manuskript traten. Der bloße Anblick erfüllte sie mit Ehrfurcht.« 8
So reagierten die Menschen, als sie den Codex Sinaiticus in London zum ersten Mal sahen. Denn die Geschichte des Manuskripts endet nicht in Russland. Nach der russischen Revolution 1917 ist der sowjetische Staat nicht sonderlich an der Bibel interessiert, außerdem braucht man Geld. Kurz vor Weihnachten 1933 kauft das British Museum das Manuskript für 100.000 Pfund und stellt es unter strenge Bewachung. Zur Finanzierung des Kaufs trägt auch eine große Sammelaktion unter Privatpersonen bei. Die bekannten Textforscher des Museums, H.J.M. Milne und T.C. Skeat, analysieren die Handschrift gründlich und veröffentlichen 1938 ihre Ergebnisse. Der Codex Sinaiticus wird auf Mitte des 4.Jahrhunderts n.Chr. datiert. Noch heute gilt er als das älteste komplette Manuskript des Neuen Testaments. Er hat sogar eine eigene Internetseite bekommen ( www.codexsinaiticus.org), wodurch sich jeder diesen unglaublichen Fund ansehen kann. Er ist beinahe 1700 Jahre alt, aber die Seiten sind noch immer gut erhalten. Auf der Internetseite sieht man auch, wie das verwendete Pergament hergestellt wurde und wie gegenwärtig an dem Manuskript geforscht wird.
Was hat Konstantin von Tischendorf in dieser Nacht gesehen, als er das Manuskript allein studierte? Die alten Bögen vor ihm stammten aus einer großen Prachtbibel und waren aus feinstem Pergament, d.h. aus bearbeiteter Tierhaut. Pergament war das beständigste Schreibmaterial der Zeit. Im 4.Jahrhundert hatte es Papyrus als gängigstes Schreibmaterial abgelöst. Neuen Untersuchungen der British Library zufolge wurde der Großteil der Seiten des Codex Sinaiticus aus Kalbshaut hergestellt, was als feinstes Leder galt, während einige Seiten aus Schafsleder sind.
Am auffälligsten jedoch ist die hohe Qualität des Pergaments. Die Bögen sind extrem dünn; alle sind zwischen 0,1 und 0,2 Millimeter dick, das Leder ist hell, gleichmäßig und fein. Es ist deutlich zu erkennen, dass bei der Herstellung des Buches die besten Pergamentbögen ausgewählt wurden, die aufzutreiben waren. Berechnungen zufolge war für die Fertigung der großen Lederbibel die Haut von etwa 360 Tieren vonnöten. Mit heutigem Geldwert gerechnet, muss allein das Pergament des Buches einen fünfstelligen Euro-Betrag gekostet haben.
Die Bögen sind groß; ganze 43 × 38 cm. Sie sind beidseitig beschrieben und waren in Stößen von je acht Bögen zusammengefaltet, in Buchform zusammengelegt und am Rücken zusammengenäht worden. Die Schrift verläuft über vier Spalten, mit ausreichend Platz zwischen den Spalten sowie entlang der Ränder. Aufgeschlagen macht das Buch einen imposanten Eindruck, mit acht schnurgeraden Spalten und einer Breite von 76 cm von Seitenrand zu Seitenrand. Die großzügigen Ränder belegen, dass bei der Fertigung des Manuskripts an nichts gespart wurde; das feine Pergament war äußerst kostbar, dennoch legten die Schreiber Wert auf ein schönes und luftiges Layout. Die Handschrift ist schön und gleichmäßig. Laut Untersuchungen haben vermutlich vier verschiedene Personen dieses Manuskript per Hand verfasst.
Aber waren die Schreiber vielleicht mehr daran interessiert, schön anstatt richtig zu schreiben? Der Codex Sinaiticus ist nämlich ein Manuskript mit ungewöhnlich vielen kleinen Schreibfehlern. Auf jeder Seite finden sich Korrekturen, bei denen der Schreiber selbst oder jemand aus seinem Umfeld vergessene Buchstaben und Wörter ergänzt hat. Zudem wurden in späteren Jahrhunderten viele Korrekturen und Änderungen an dem Manuskript vorgenommen. Jemand mit Zugang zu anderen Manuskripten, in denen Wörter und Sätze anders geschrieben waren, hat sie in den Text eingefügt. Viele dieser Stellen wurden ein weiteres Mal bearbeitet und die Korrekturen dabei zurückgenommen. Das verweist auf einen langen und spannenden Werdegang des Manuskripts. In modernen Ausgaben des griechischen Neuen Testaments werden alle diese verschiedenen Korrekturen und Änderungen mit den Zahlen 1,2,3 usw. in den Fußnoten markiert, während der ursprüngliche Text, vor all den Änderungen, mit einem Stern (*) markiert wird.
Tischendorf betrachtete den Codex Sinaiticus als das wichtigste und beste Manuskript des Neuen Testaments. Um dies zu unterstreichen, gab er ihm ein ganz besonderes Symbol, als er 1869 eine gedruckte Ausgabe des griechischen Textes anfertigte: Den ersten Buchstaben des hebräischen Alphabets, Aleph (  ). Alle lateinischen Buchstaben waren belegt, und der Buchstabe A war bereits als Symbol für den Codex Alexandrinus verwendet worden. Nach Ansicht Tischendorfs war das neue, von ihm im Kloster gefundene Manuskript viel wichtiger und musste daher ein Symbol bekommen, das vor dem Buchstaben A stehen konnte. Somit fiel die Wahl auf Aleph, den damit einzigen hebräischen Buchstaben, der als Symbol für ein neutestamentliches Manuskript verwendet wurde.
). Alle lateinischen Buchstaben waren belegt, und der Buchstabe A war bereits als Symbol für den Codex Alexandrinus verwendet worden. Nach Ansicht Tischendorfs war das neue, von ihm im Kloster gefundene Manuskript viel wichtiger und musste daher ein Symbol bekommen, das vor dem Buchstaben A stehen konnte. Somit fiel die Wahl auf Aleph, den damit einzigen hebräischen Buchstaben, der als Symbol für ein neutestamentliches Manuskript verwendet wurde.
Auch heute noch hat der Codex Sinaiticus einen Ehrenplatz unter den alten Manuskripten des Neuen Testaments. Er ist das älteste, von der ersten bis zur letzten Seite komplett unbeschädigte Exemplar des Neuen Testaments. Einen Beitrag zur Stellung des Manuskripts leistete wohl auch die besondere Geschichte rund um dessen Auffinden durch Tischendorf sowie die Berühmtheit, die es danach erlangte. Später wurden viele Papyrusmanuskripte gefunden, die noch älter sind als der Codex Sinaiticus. Aber keines dieser Manuskripte ist so schön und unversehrt wie die große Bibel aus dem Kloster am Sinai.
Im Großen und Ganzen haben die neuen Papyrusfunde des 20.Jahrhunderts nur bestätigt, wie wichtig der Codex Sinaiticus ist. Sie belegen, dass es sich bei dem Manuskript vom Sinai um eine frühe Textform handelt und der Codex Sinaiticus somit noch immer ein wichtiges Zeugnis der Bibeltexte der ersten Jahrhunderte ist. Auch in Zukunft wird der Codex Sinaiticus für Forscher wichtig sein, wenn es darum geht, welche Textform den Ausgangspunkt für neue Bibelübersetzungen bilden soll.
Fakten Codex Sinaiticus:
Symbol in der Textforschung:
Schreibmaterial: Pergament.
Gefunden 1859, publiziert 1862.
346 Bögen (694 Seiten).
Seitengröße: 43 × 38 cm.
Text vierspaltig.
Erstellt von drei oder vier verschiedenen Schreibern.
Beinhaltet das gesamte Neue Testament (sowie den Barnabasbrief und Teile des Hirten des Hermas) und das Alte Testament ab dem 1.Buch der Chronik 9,27 (sowie einige Fragmente der Bücher des Mose).
Datierung: ca. 350 n.Chr.
Aufbewahrung in der British Library in London (347 Bögen), in der Universitätsbibliothek Leipzig (43 Bögen), in der Russischen Nationalbibliothek in St. Petersburg (Teile von 6 Bögen) und im Katharinenkloster (mindestens 18 Bögen).
Online zu sehen unter: www.codexsinaiticus.org
Eine Entdeckung der Gegenwart rückt den Fund des Codex Sinaiticus in ein neues Licht. In einer Mauernische des Katharinenklosters wurden mehrere alte Manuskriptbögen entdeckt.
Читать дальше
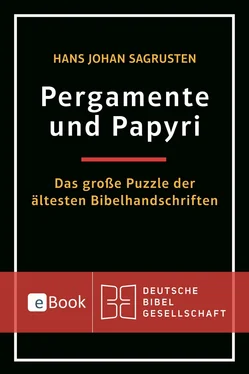
 ). Alle lateinischen Buchstaben waren belegt, und der Buchstabe A war bereits als Symbol für den Codex Alexandrinus verwendet worden. Nach Ansicht Tischendorfs war das neue, von ihm im Kloster gefundene Manuskript viel wichtiger und musste daher ein Symbol bekommen, das vor dem Buchstaben A stehen konnte. Somit fiel die Wahl auf Aleph, den damit einzigen hebräischen Buchstaben, der als Symbol für ein neutestamentliches Manuskript verwendet wurde.
). Alle lateinischen Buchstaben waren belegt, und der Buchstabe A war bereits als Symbol für den Codex Alexandrinus verwendet worden. Nach Ansicht Tischendorfs war das neue, von ihm im Kloster gefundene Manuskript viel wichtiger und musste daher ein Symbol bekommen, das vor dem Buchstaben A stehen konnte. Somit fiel die Wahl auf Aleph, den damit einzigen hebräischen Buchstaben, der als Symbol für ein neutestamentliches Manuskript verwendet wurde.