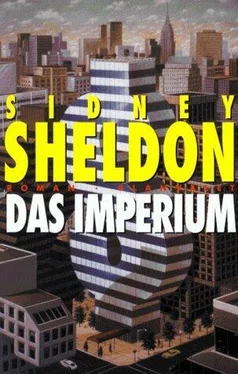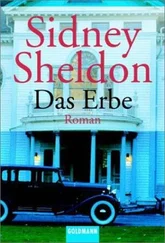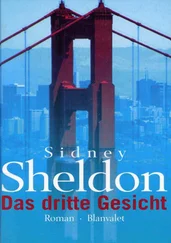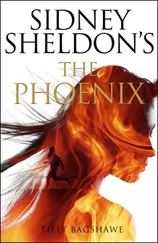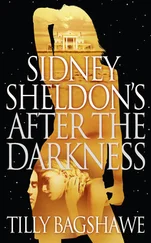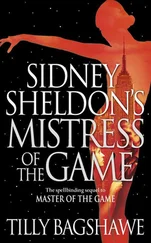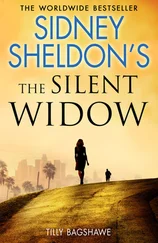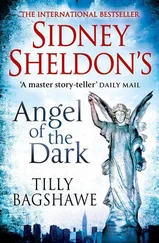Im Vorraum drängten sich Bewunderer, um ihn zu beglückwünschen. Oft machte es Spaß, ihre Komplimente zu hören und ihre Bewunderung fast körperlich zu fühlen, aber diesmal war Philip nicht dazu aufgelegt. Er blieb in seiner Garderobe, bis die Menge sich verlaufen hatte. So war es fast Mitternacht, bevor er die Carnegie Hall durch den Bühnenausgang verließ. Wider Erwarten stand die Limousine nicht dort. Ich nehme ein Taxi, entschied Philip.
Er trat in den strömenden Regen hinaus. Durch die menschenleere siebenundfünfzigste Straße wehte ein kalter Wind. Als Philip in Richtung Sixth Avenue ging, tauchte aus einer Einfahrt ein bulliger Mann in einem Trenchcoat auf.
»Entschuldigung«, sagte der Mann, »wie komme ich zur
Carnegie Hall?«
Philip dachte an den alten Witz, den er Lara erzählt hatte, und war versucht »üben!« zu sagen. Aber dann deutete er doch nur auf das Gebäude hinter sich. »Sie stehen davor.«
Als Philip weitergehen wollte, stieß der Mann ihn mit einer Hand rückwärts gegen die Mauer. In der anderen Hand hatte er plötzlich ein gefährlich aussehendes Klappmesser. »Her mit dem Geld!«
Philip schlug das Herz bis zum Hals. Er sah sich verzweifelt nach Hilfe um, aber die regennasse Straße war menschenleer. »Schon gut«, sagte er mit zitternder Stimme. »Nur keine Aufregung! Mein Geld können Sie haben.«
Dann spürte er das Messer an seiner Kehle.
»Hören Sie, das ist wirklich nicht ...«
»Maul halten! Her mit dem Geld!«
Philip steckte eine Hand unter den Mantel und zog langsam seine Geldbörse heraus. Der Mann griff hastig danach und steckte sie ein. Dabei fiel sein Blick auf Philips teure Armbanduhr. Er griff danach und riß ihm die Piaget vom Handgelenk. Im nächsten Augenblick hielt er Philips linke Hand fest, zog ihm die rasiermesserscharfe Klinge übers Handgelenk und zerschnitt es bis auf den Knochen. Philip stieß einen gellenden Schrei aus. Aus der Wunde quoll ein Blutstrom. Der Täter rannte davon.
Philip stand vor Schock wie gelähmt und beobachtete, wie sein Blut mit Regenwasser vermischt auf den nassen Asphalt tropfte.
Dann brach er ohnmächtig zusammen.
Lara erhielt die Schreckensnachricht über Philip in Reno; Marian Bell rief sie hysterisch schluchzend an.
»Ist er schwer verletzt?« fragte Lara besorgt.
»Wir wissen noch nichts genaues. Er ist im Roosevelt Hospital in der Notaufnahme.«
»Ich komme sofort zurück.«
Als Lara im Krankenhaus eintraf, wartete dort Howard Keller auf sie. Er sah blaß und mitgenommen aus. »Was ist passiert?« fragte sie.
»Philip scheint überfallen worden zu sein, als er aus der Carnegie Hall kam. Er ist bewußtlos auf der Straße aufgefunden worden.«
»Wie schlimm ist er verletzt?«
»Er hat einen tiefen Schnitt im linken Handgelenk. Er bekommt schmerzstillende Mittel, aber er ist bei Bewußtsein.«
Sie betraten das Krankenzimmer. Philip lag mit geschlossenen Augen im Bett und erhielt durch zwei Schläuche Tropfinfusionen.
»Philip . Philip . « Das war Laras Stimme, die ihn aus weiter Ferne rief. Er öffnete langsam die Augen. Vor seinem Bett standen Howard Keller und Lara, die sich über ihn beugte. Beide schienen doppelt vorhanden zu sein. Seine Kehle war wie ausgedörrt, und er fühlte sich benommen.
»Was'n passiert?« murmelte Philip.
»Du bist verletzt«, sagte Lara. »Aber du wirst bald wieder gesund.«
Er blickte an sich herab und stellte fest, daß sein linkes
Handgelenk dick bandagiert war. Das erinnerte ihn wieder an den Raubüberfall. »Ich bin ... Wie schwer ist meine Verletzung?«
»Das weiß ich nicht, Liebster«, sagte Lara. »Aber es kommt bestimmt wieder in Ordnung. Der Arzt will später selbst mit dir darüber sprechen.«
»Die Ärzte können heutzutage fast alles«, warf Keller beruhigend ein.
Philip konnte sich nicht länger wachhalten. »Ich hab' ihm gesagt, daß er alles haben kann«, murmelte er noch. »Er hätte mir die Hand nicht zerschneiden dürfen. Er hätte mir die Hand nicht .«
Zwei Stunden später kam Dr. Dennis Stanton in Philips Krankenzimmer. Schon der Gesichtsausdruck des Arztes verriet, was er sagen würde.
Philip holte tief Luft. »Wie steht es, Doktor?«
Dr. Stanton seufzte. »Ich habe leider schlechte Nachrichten für Sie, Mr. Adler.«
»Wie schwer ist meine Verletzung?«
»Die Sehnen Ihres linken Handgelenks sind durchtrennt, so daß Sie die Hand nicht mehr bewegen können und ein ständiges Gefühl der Taubheit zurückbehalten werden. Außerdem sind der Mittelarmnerv und der Ellbogennerv schwer geschädigt.« Stanton zeigte an seiner Hand, was er meinte. »Der Mittelarmnerv steuert die Bewegungen des Daumens und der drei ersten Finger. Der Ellbogennerv verzweigt sich zu allen Fingern hin.«
Philip schloß die Augen vor einer Woge jäher Verzweiflung, die ihn zu verschlingen drohte. »Soll das heißen, daß ich ... daß ich meine linke Hand nie wieder gebrauchen kann?«
»Ja, das stimmt leider. Tatsächlich können Sie von Glück sagen, daß Sie noch leben. Der Schnitt hat auch die Schlagader durchtrennt. Daß Sie nicht verblutet sind, grenzt an ein Wun-der. Wir haben sechzig Stiche gebraucht, um Ihr Handgelenk wieder zusammenzunähen.«
»Mein Gott, können Sie denn nicht nochirgendwas für mich tun?« fragte Philip verzweifelt.
»Ja. Wir können die Sehnen durch Implantate ersetzen, um Ihnen etwas Bewegungsfreiheit zurückzugeben. Aber davon dürfen Sie sich nicht allzuviel versprechen.«
Der Kerl hätte mich ebensogut ermorden können! dachte Philip deprimiert.
»Während Ihre Verletzung heilt, werden Sie starke Schmerzen haben. Wir geben Ihnen natürlich schmerzstillende Mittel, aber ich kann Ihnen versichern, daß die Schmerzen nachlassen werden.«
Nicht der wirkliche Schmerz, dachte Philip. Nicht der eigentliche Schmerz. Er war in einem Alptraum gefangen, aus dem es kein Entrinnen gab.
Ein Kriminalbeamter stand neben Philips Bett. Er war ein Ermittler der alten Schule: Anfang sechzig, abgekämpft und ausgelaugt, mit müden Augen, die schon alles gesehen hatten.
»Ich bin Lieutenant Mancini. Tut mir leid, daß Ihnen das passiert ist, Mr. Adler«, sagte er. »Zu schade, daß der Kerl Ihnen nicht lieber das Bein gebrochen hat. Ich meine, wenn's schon hat passieren müssen .«
»Ich weiß, was Sie meinen«, wehrte Philip ab.
Howard Keller kam herein. »Ich bin auf der Suche nach Lara. Sie wollte um ...« Er sah den Besucher. »Oh, Entschuldigung!«
Mancini starrte ihn an. »Sie kommen mir bekannt vor. Kennen wir uns von irgendwoher?«
»Nein, das glaube ich nicht.«
Mancini lächelte plötzlich. »Keller! Mein Gott, Sie haben früher in Chicago Baseball gespielt.«
»Richtig. Woher ...?«
»Ich bin einen Sommer lang als Talentsucher für die Cubs unterwegs gewesen. An Sie erinnere ich mich noch gut! Sie hätten als Baseballspieler Karriere machen können.«
»Yeah. Wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen ...« Keller nickte Philip zu. »Ich warte draußen auf Lara.«
Lieutenant Mancini wandte sich an Philip. »Können Sie mir den Mann beschreiben, der Sie überfallen hat?«
»Der Täter ist ein Weißer gewesen. Ein großer, kräftiger Kerl ... mindestens einsfünfundachtzig. Ende vierzig bis Anfang fünfzig.«
»Könnten Sie ihn identifizieren, wenn Sie ihm wiederbegegnen würden?«
»Ja.« Das Gesicht würde er sein Leben lang nicht mehr vergessen.
»Mr. Adler, ich könnte Sie bitten, sich einen Haufen Fahndungsfotos anzusehen, aber damit würden Sie offen gesagt Ihre Zeit verschwenden. Ich meine, hier liegt nicht gerade ein außergewöhnliches Verbrechen vor. Bei uns in New York gibt's Tausende von Straßenräubern. Wird einer nicht auf frischer Tat gefaßt, ist eine Fahndung so gut wie aussichtslos.« Er zog sein Notizbuch heraus. »Was ist Ihnen geraubt worden?«
Читать дальше