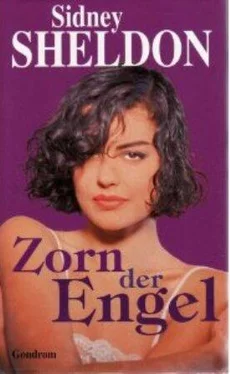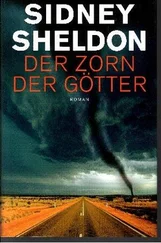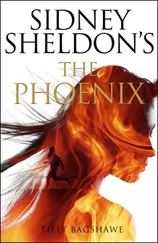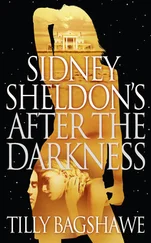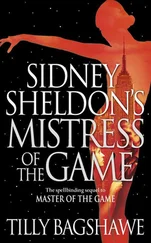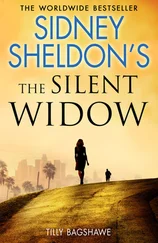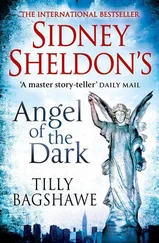»Adam, sie war phantastisch.« »Sie hat dasselbe über dich gesagt.«
»Man liest dauernd über den alten Südstaatencharme, aber man begegnet ihm nicht oft. Mary Beth hat ihn. Sie ist eine richtige Dame.«
»Du auch, Liebling. Wo möchtest du gern heiraten?« Jennifer sagte: »Auf dem Times Square, was mich betrifft. Aber ich glaube, wir sollten noch warten, Adam.«
»Worauf warten?«
»Bis nach den Wahlen. Deine Karriere ist wichtig. Eine Scheidung könnte dir jetzt schaden.«
»Mein Privatleben ist...«
»...in Zukunft auch dein öffentliches Leben. Wir dürfen nichts tun, was deine Chancen verderben würde. Wir können sechs Monate warten.«
»Ich will nicht warten.«
»Ich auch nicht, Liebling.« Jennifer lächelte. »Wir werden auch nur so tun, als ob wir warteten, nicht wahr?«
Jennifer und Adam aßen fast jeden Tag zusammen zu Mittag, und ein- oder zweimal verbrachte Adam die Nacht in ihrer Wohnung. Sie mußten vorsichtiger sein denn je, denn Adams Wahlkampagne hatte begonnen, und er war jetzt im ganzen Land bekannt. Er hielt Reden auf politischen Versammlungen, und seine Meinungen zu Fragen von nationalem Interesse wurden immer öfter in der Presse zitiert.
Adam und Stewart Needham nahmen ihren rituellen Morgentee zu sich. »Ich habe dich heute morgen im Fernsehen gesehen«, sagte Needham. »Gute Arbeit, Adam. Du hast in jedem Punkt überzeugt. Ich verstehe, daß sie dich noch einmal eingeladen haben.«
»Stewart, ich hasse diese Shows. Ich fühle mich da oben wie ein gottverdammter Schauspieler in einem Film.« Stewart nickte unbeeindruckt. »Das sind Politiker nun einmal, Adam -Schauspieler. Sie spielen eine Rolle und sind so, wie die Öffentlichkeit sie haben will. Zum Teufel, wenn Politiker sich in der Öffentlichkeit benähmen, wie sie wollten, dann wäre dieses Land nichts weiter als eine verdammte Monarchie.«
»Ich mag die Tatsache nicht, daß die Kandidatur für ein öffentliches Amt zu einer Probeaufnahme degradiert worden ist.«
Stewart Needham lächelte. »Du solltest dankbar sein, daß du so gut wirkst, mein Junge. Deine Werte in den Umfragen steigen von Woche zu Woche.« Er hielt inne, um sich Tee nachzuschenken. »Glaub mir, das ist jetzt erst der Anfang. Erst der Senat, dann die Zielscheibe Nummer eins. Nichts kann dich aufhalten.« Er nahm einen Schluck Tee. »Es sei denn, du begehst eine Dummheit.« Adam sah auf. »Was meinst du?«
Stewart Needham tupfte sich die Lippen mit einem Damasttaschentuch ab. »Dein Gegenkandidat teilt mit Vorliebe Tiefschläge aus. Ich wette, daß er in diesem Augenblick dein Leben mit einer Lupe betrachtet. Er wird doch hoffentlich keine Munition finden, oder?«
»Nein.« Das Wort glitt Adam automatisch über die Lippen. »Gut«, sagte Stewart Needham. »Wie geht es Mary Beth?«
Jennifer und Adam verbrachten ein geruhsames Wochenende in einem Landhaus in Vermont, das einer von Adams Freunden ihnen zur Verfügung gestellt hatte. Die Luft war trocken und frisch, sie ließ schon Vorahnungen auf den Winter aufkommen. Es war ein vollkommenes Wochenende, das sie am Tag mit langen Wanderungen, am Abend mit Spielen und Gesprächen vor dem Kaminfeuer verbrachten. Sie hatten alle Sonntagszeitungen sorgfältig durchgelesen. Adam lag in allen Umfragen vorn. Mit wenigen Ausnahmen standen die Medien auf seiner Seite. Sie mochten seine Art, seinen Anstand, seine Intelligenz und seine Offenheit. Immer wieder verglichen sie ihn mit John F. Kennedy. Adam rekelte sich vor dem Kamin und beobachtete den Widerschein der Flammen auf Jennifers Gesicht. »Was würdest du davon halten, die Frau des Präsidenten zu sein?«
»Tut mir leid. Ich bin schon in einen Senator verliebt.« »Wärst du enttäuscht, wenn ich nicht gewinne, Jennifer?« »Nein. Der einzige Grund, warum ich will, daß du gewinnst,
besteht darin, daß du gewinnen willst, Liebling.« »Wenn ich es schaffe, bedeutet das, daß wir in Washington
leben müssen.«
»Wenn wir zusammen sind, spielt nichts anderes eine Rolle.«
»Was ist mit deiner Kanzlei?«
Jennifer lächelte. »Soweit ich weiß, gibt es in Washington auch Anwälte.«
»Und wenn ich dich bitten wü rde, es aufzugeben?«
»Dann würde ich es aufgeben.«
»Das will ich nicht. Dazu bist du zu gut in deinem Beruf.«
»Mir ist nur das Zusammensein mit dir wichtig. Ich liebe dich so sehr, Adam.«
Er streichelte ihr weiches, dunkelbraunes Haar und sagte:
»Ich liebe dich auch sehr.«
Sie gingen ins Bett und später schliefen sie ein.
Sonntagnacht fuhren sie nach New York zurück. Sie holten Jennifers Wagen in der Garage, wo sie ihn untergestellt hatte, und Adam fuhr nach Hause. Jennifer ging wieder in ihre Wohnung.
Jennifers Tage waren unglaublich ausgefüllt. Wenn sie sich vorher schon für beschäftigt gehalten hatte, so wurde sie jetzt regelrecht belagert. Sie vertrat internationale Konzerne, die dabei erwischt worden waren, als sie sich ein paar Gesetze zurechtbogen, Senatoren, die ihre Finger in die Parteikasse gesteckt hatten, Filmschauspieler, die in Schwierigkeiten geraten waren. Sie vertrat Bankpräsidenten und Bankräuber, Politiker und Gewerkschaftsführer.
Das Geld strömte nur so herein, aber das war Jennifer nicht wichtig. Sie verteilte großzügige Prämien an ihre Mitarbeiter und machte verschwenderische Geschenke.
Die Firmen, die gegen Jennifer antraten, waren längst davon abgekommen, die zweite Garde ihrer Anwälte ins Gefecht zu schicken, so daß Jennifer sich oft mi t den größten juristischen Talenten der Welt zu messen hatte.
Sie wurde in das Kollegium amerikanischer Prozeßanwälte aufgenommen, und sogar Ken Bailey war beeindruckt. »Herrgott«, sagte er, »weißt du, daß es nur ein Prozent der Anwälte dieses Landes jemals bei denen zur Mitgliedschaft bringt?«
»Ich bin ihre Renommierfrau«, lachte Jennifer.
Wenn sie einen Angeklagten in Manhattan verteidigte, konnte sie sicher sein, daß Robert Di Silva entweder selber die Anklage vertrat oder zumindest die Strategie seiner Assistenten überwachte. Sein Haß auf sie war mit jedem ihrer Siege gewachsen.
Während eines Prozesses, in dem Jennifer dem Staatsanwalt gegenüberstand, hatte Di Silva ein Dutzend der besten Experten als Zeugen der Anklage aufgefahren. Jennifer hatte auf Sachverständige verzichtet. Sie sagte zu den Geschworenen: »Wenn wir ein Raumschiff bauen oder die Entfernung zu einem Stern berechnen wollen, dann brauchen wir Experten. Aber wenn wir etwas wirklich Wichtiges erledigen müssen, dann rufen wir zwölf normale Menschen zusammen. Wenn ich mich richtig erinnere, hat der Begründer des Christentums nichts anderes getan.« Jennifer gewann den Fall.
Eine von Jennifers erfolgreichsten Techniken bestand darin, den Geschworenen zu sagen: »Ich weiß, daß die Worte Gesetz und Gerichtssaal etwas einschüchternd und weit entfernt von Ihrem täglichen Leben klingen, aber wenn Sie aufhören, darüber nachzudenken, stellen Sie fest, daß wir hier nichts anderes tun, als uns mit dem Recht und Unrecht zu beschäftigen, das menschlichen Wesen wie uns allen angetan wurde. Vergessen wir, daß wir in einem Gerichtssaal sind, meine Freunde. Stellen wir uns vor, wir säßen in meinem Wohnzimmer und sprächen darüber, was diesem Angeklagten, unserem Mitmenschen, passiert ist.«
Und in ihrer Einbildung saßen die Geschworenen in Jennifers Wohnzimmer wie verzaubert von ihrer Ausstrahlung. Dieser Kniff wirkte so lange, bis Jennifer eines Tages wieder einmal einen Mandanten gegen Robert Di Silva verteidigte. Der Staatsanwalt stand auf und hielt sein Eröffnungsplädoyer.
»Meine Damen und Herren«, sagte Di Silva, »vergessen Sie, daß Sie in einem Gerichtssaal sitzen. Ich möchte, daß Sie sich vorstellen, Sie befänden sich zu Hause in meinem Wohnzimmer, und wir alle sitzen entspannt herum und plaudern über die schrecklichen Dinge, die der Angeklagte getan hat.« Ken Bailey beugte sich zu Jennifer und flüsterte: »Hörst du, was dieser Bastard tut? Er klaut dir deinen Mäusespeck.«
Читать дальше