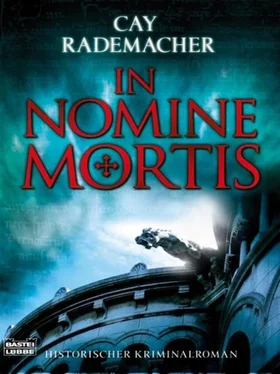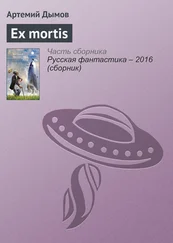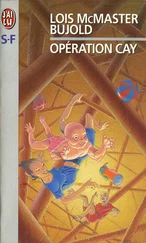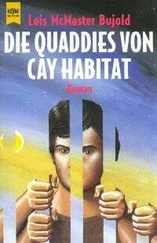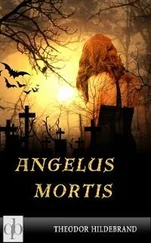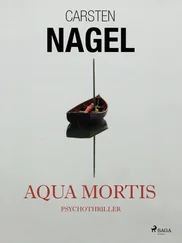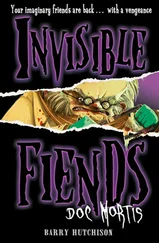Cay Rademacher - In Nomine Mortis
Здесь есть возможность читать онлайн «Cay Rademacher - In Nomine Mortis» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Год выпуска: 2009, Жанр: Исторический детектив, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:In Nomine Mortis
- Автор:
- Жанр:
- Год:2009
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
In Nomine Mortis: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «In Nomine Mortis»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
In Nomine Mortis — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «In Nomine Mortis», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Nichts. Im Treppenhaus selbst schien alles still - so glaubte ich zumindest, denn draußen kündigte sich das Gewitter nun in Böen an, welche in unregelmäßigen Abständen um den Turm heulten und es mir schwer machten, ungewöhnliche Geräusche auszumachen. Ich konnte die gewundene Treppe nur einige Stufen weit hinaufsehen, sodass sich weiter oben eine Hundertschaft Landsknechte hätte verstecken können, ohne dass ich sie gewahrt hätte. Vorsichtiger schlichen wir weiter. So gelangten wir in einen überwölbten Raum, der zur Linken eine offene Pforte aufwies. Sie führte zur Galerie hinaus, die in schwindelnder Höhe die beiden Türme miteinander verband. Ich spähte kurz hinaus, da ich glaubte, dort einen entweichenden Schatten gesehen zu haben. Doch entdeckte ich niemanden auf dem schmalen, steinernen Gang. Nur ein paar Raben flatterten auf und krächzten böse. Selbst hinaustreten oder gar bis zum anderen Turm gehen wollte ich allerdings nicht — aus Angst, dass jemand, der sich oben unter der Spitze verbarg, mich auf dieser Galerie entdecken mochte.
Ich atmete tief durch — denn nun konnte, wer immer dort oben sein mochte, mir nicht mehr entkommen, falls er noch lebte. Ich hatte befürchtet, dass uns jemand im Turm beim Hinaufsteigen gehört haben könnte. Dann wäre es ihm möglich gewesen, vom rechten Turm bis zur Galerie hinabzusteigen, über die Galerie in den anderen Turm zu wechseln und die Kathedrale unerkannt zu verlassen, während Lea und ich uns noch auf dem Weg nach oben befanden. Nun hatte ich diesen Fluchtweg abgeschnitten — vorausgesetzt allerdings, der, den wir suchten, war uns nicht gerade auf eben jener Galerie entkommen.
»Weiter!«, keuchte ich.
Noch einmal kämpften wir uns wohl viele Dutzend Stufen hoch. Die Treppe wurde immer enger und wand sich immer steiler hoch. Ich fürchtete, dass uns jemand hier auflauern würde. Wir hätten ihn im Kampfe niemals überwinden können. Zugleich fürchtete ich, dass jener Schatten, den ich glaubte gesehen zu haben, uns nun folgen könnte und Lea angriff, die hinter mir war. Wir hätten in der Falle gesessen.
Doch wir gelangten unbehelligt nach oben.
Wir traten vom Treppenhaus in eine erstaunlich große, hohe, steingewölbte viereckige Kammer direkt unterhalb des stumpfen, an einen Beifried gemahnenden Abschluss des Kathedralenturmes. Einige schmale, doch hohe Fensterbögen ließen viel Licht von außen herein, doch waren die Scheiben an mehreren Stellen zersprungen. Drei schwarze Raben flatterten wild auf, als wir hereinstürmten. Ich schlug mit dem Schürhaken nach ihnen und vertrieb sie. Dann sah ich mich um.
Wir waren zu spät gekommen.
An der dem Eingang gegenüberliegenden Wand standen schwere Eichenkisten, manche waren fast mannshoch. Alle waren aufgeschlagen, bei manchen war der Deckel sogar abgerissen worden und lag daneben auf dem Steinboden. Und alle waren leer. Neben den Fenstern, sodass sie gut im Licht standen, befanden sich auch einige Schreibpulte. Auf einem lag noch ein kleines Messer, wie man es zum Abschaben zu tilgender Textpassagen verwendete. Auf dem Boden lagen einige Schreibfedern verstreut, außerdem war ein Tintenfass dort aufgeschlagen und zersprungen. Blaue Tinte hatte sich über die Steine ergossen. Sie war längst getrocknet. Es roch noch nach Pergament und Leder, doch außer einigen Fetzen, auf denen allerdings nicht eine einzige Zeile Text stand, waren keine Bücher oder Urkunden zu sehen.
Mitten in der Kammer lag ein Toter. Es war ein Mönch, den die Raben umschwirrt hatten. Ein Dominikaner. »Tretet nicht näher!«, warnte ich Lea.
»Glaubt Ihr, ich habe die letzten Tage mit verbundenen Augen zugebracht?«, antwortete sie mir. »Ich habe so viele grausige Tote gesehen, da werde ich auch diesen Anblick ertragen.«
So hielten wir uns denn an den Händen, um uns gegenseitig Mut zu verleihen, als wir näher traten. Das Gesicht des Mitbruders, auch seine Arme und sein Oberkörper waren nicht nur von den Beulen entstellt, sie waren auch von den eisenharten Schnäbeln der Raben zerhackt worden. Und doch erkannte ich den Toten noch. »Es ist der Portarius«, flüsterte ich fassungslos.
Wer hätte für die Verschwörer besser kontrollieren können, wer das Kloster betrat - und wer es verließ! Ich hatte, wie mir erst jetzt klar wurde, dem alten Mitbruder gegenüber die unverzeihliche Sünde des Hochmutes begangen. Niemals hatte ich den Portarius für wahrhaftig wichtig gehalten, niemals hatte ich gedacht, dass er mir gefährlich werden könnte. Und doch wusste er fast immer, wann ich das Kloster verlassen hatte. Und, wer weiß, vielleicht hatte er auch gesehen, wie ich mich vor dem Kloster in der Rue Saint-Jacques mit Magdalena, der Dienerin Klaras getroffen hatte — und mit Lea. Ein Auge der Inquisition.
»Die Seuche hat ihn dahingerafft«, sagte Lea, die blass geworden war, deren Stimme jedoch gefasst klang. »Wie lange mag er schon tot sein?«
»Ein paar Stunden vielleicht«, murmelte ich. »Er stinkt nach Fäulnis wie alle Unglückseligen, welche die Krankheit in sich trugen. Doch ich rieche noch nicht den süßlichen Hauch der Verwesung.« Lea deutete auf die geplünderten Kisten und die leeren Schreibpulte. »Dann sind seine Mitverschwörer uns nur ein paar Stunden zuvorgekommen.«
»Doch mit all dem Gold und Silber werden sie langsam sein!«, rief ich, eilte zu einem Fenster in der linken Seite des Turms und starrte hinaus.
Ais ich nur wenige Stunden zuvor an der Place de Greve angelangt war, da hatten mich die Tänzer in ihrem schauderhaften Reigen so in Angst versetzt, dass ich blindlings auf die Insel gelaufen war. In meiner Furcht hatte ich weder nach links noch nach rechts geblickt — und so hatte ich nicht bemerkt, ob die Kogge noch im Hafen lag oder nicht. Dann hatte ich Lea gesucht, anschließend war ich, besessen von meinen eigenen Dämonen, in die Kathedrale gestürzt. Nun beklagte ich innerlich meine Hast und meine Angst.
Ich spähte Richtung Hafen. Der andere Turm versperrte mir einen Teil der Sicht. Auch war der Himmel nun vollständig schwarz. Blitze zuckten über das Firmament und warfen grelles Licht über die Dächer, das die Augen blendete. Der Rauch des Scheiterhaufens, um den die Tänzer ihren Reigen drehten, zog in dichten grauen Schwaden herüber.
Trotzdem sah ich einen Mast aufragen, höher als den aller anderen Schiffe: Die »Kreuz der Trave« war noch da.
Als ich jedoch genauer hinsah, bemerkte ich Bewegungen an Bord. Schatten huschten hierhin und dorthin. Der Rauch des Feuers wurde immer dichter, die Wolken schluckten auch das letzte Sonnenlicht, ich vermochte nicht mehr genau zu erkennen, was dort vor sich ging. Doch ich glaubte, dass sich Gestalten am Segel zu schaffen machten und andere an den Leinen, welche die Kogge mit dem Kai verbanden. »Schnell!«, rief ich, in höchster Angst. »Wir müssen zum Hafen!« Ich wollte die Treppe wieder hinabstürzen — doch da stand ein Schatten in der Pforte und versperrte uns den Weg.
*
Philippe de Touloubre sah aus wie der Engel des Todes. Seine Kutte war schmutzig und mit Blut befleckt. Seine Züge waren von Beulen und Wundmalen entstellt. Er stank wie ein Wesen der Hölle, seine Augen glänzten fiebrig und in seiner Linken blitzte die lange, scharfe Klinge eines venezianischen Dolches.
»Ich ahnte, dass du es irgendwie bis hier hinauf schaffen würdest, Bruder Ranulf«, stieß er keuchend hervor. »Oh, du wärest ein guter Inquisitor geworden, vielleicht der beste der Christenheit! Doch statt Ketzer zu jagen, bist du selbst zu einem geworden. Sogar eine Jüdin bringst du hinauf in die Kathedrale von Paris!« Meine Seele war kalt. Ich war ruhig, alle meine Sinne waren so klar, wie sie es wohl niemals zuvor und auch niemals danach wieder waren. Ich hob den Schürhaken.
»Gebt den Weg frei, Meister Philippe«, flüsterte ich.
»Niemals!«, rief er irre lachend. »Du wirst die Kogge nicht aufhalten können. Du wirst GOTTES Plan nicht stören!«
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «In Nomine Mortis»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «In Nomine Mortis» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «In Nomine Mortis» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.