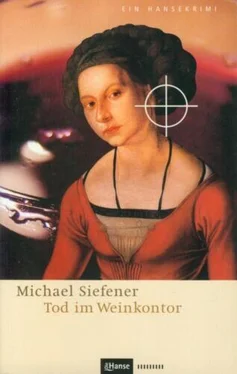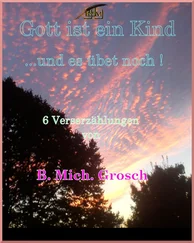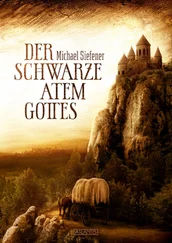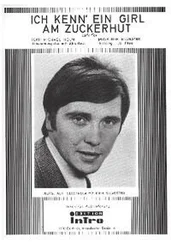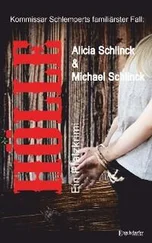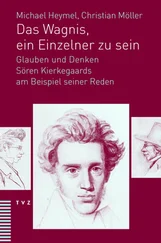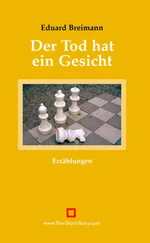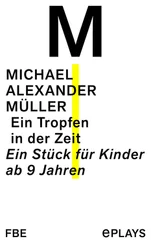»Ich habe Neuigkeiten«, flüsterte er, um die anderen nicht noch mehr zu stören. »Agnes hat dem Wirt gesagt, dass schon übermorgen ein Zug von Kölner Kaufleuten von hier abgeht. Wir könnten um eine Passage bitten. Vermutlich müssen wir aber etwas bezahlen…«
Anne nickte. Sie sah Anton prüfend an. Elisabeth wusste genau, dass sie im Augenblick viel mehr an der Frage interessiert war, wie und wo Anton die letzte Nacht verbracht hatte. Allein die Tatsache, dass er sehr ausgeruht wirkte, sprach gegen sündig verbrachte Stunden. Anne schien das genauso zu sehen und wirkte sehr erleichtert. Elisabeth verkniff sich ein Lächeln.
Sie verließen die Herberge und machten sich auf den Weg in die Deventer Straat, wo das Kontor eines der Handelsherren lag, die den Zug nach Köln organisierten. Elisabeth schaute sich neugierig um, als sie durch die engen Straßen gingen. Hier war alles so anders als in Köln oder gar London. Die Häuser waren viel schmaler und sehr hoch, und die Giebel waren treppenförmig, wie man es in Köln nur selten sah. Überhaupt erstaunte sie die Fülle an Steinhäusern. Diese Stadt war zwar klein, aber offenbar nicht arm. Auch die Leute waren gut gekleidet; man sah viele Brokat- und Damaststoffe, und die Hauben der Damen waren reich mit Perlen und Spitze verziert. Das Haus des Kaufmanns war ebenfalls prachtvoll und stand Elisabeths Elternhaus in nichts außer der Breite nach.
Der Handel war schnell abgeschlossen. Der Kaufmann reiste mit Stoffen nach Köln und hatte einige Kölner Handelsleute um sich geschart, die ihre Waren – vor allem Wein und Metallwaren – in den niederländischen Provinzen abgesetzt hatten und von dort Seide und Barchent mitbrachten. Als das Wort Wein fiel, horchte Elisabeth auf. Überall witterte sie inzwischen eine Verbindung zum schrecklichen Schicksal ihres Bruders. Während sich Anton und Jakob van Damme, der Kaufmann, einig wurden, dachte sie an die seltsame Zusammenkunft im Waterstone Inn, von der Anne berichtet hatte. Lag dort der Schlüssel zur Lösung des Rätsels? Oder hatte Edwyn Palmer ihren Bruder auf dem Gewissen? Oder gab es eine ganz andere Erklärung für seinen Tod? Elisabeth kam sich wie in einem Labyrinth gefangen vor. Und irgendwo in der Mitte lauerte das Unheil.
Noch zwei sehr laute Nächte verbrachten sie in der verrufenen Herberge, ohne dass ihnen jedoch ein Leid geschehen wäre. In der letzten Nacht wachte Elisabeth einmal aus ihrem unruhigen, traumschweren Schlummer auf und bemerkte, dass Anne nicht mehr neben ihr lag. Sie tastete in der dunklen, vom Mondschein schwach erhellten Kammer umher und stellte fest, dass das Bett dort, wo Anne geschlafen hatte, noch warm war. Aber Elisabeth war so müde, dass sie gleich wieder einschlief.
Am Morgen war Anne wieder da. Als sie aufstand und sich umkleidete, tat sie das mit fließenden, trägen und zufriedenen Bewegungen. Sie summte sogar ein Lied.
Man traf sich vor den Toren der Stadt auf einer kleinen Wiese. Anton und die beiden Pilgerinnen waren unter den Ersten, die eintrafen. Wagen, schwer beladen mit Kisten und Ballen, rumpelten heran, Pferde schnaubten, Kriegsknechte mit Lanzen, Schwertern und glänzenden Brustpanzern stellten sich auf; ihre Reittiere tänzelten nervös. Kaufherren mit wertvollen Mänteln und kostbaren Kappen liefen zwischen den Wagen umher, prüften noch einmal die Ladung und ihre Befestigungen, und schließlich ging es los.
Elisabeth und Anne fuhren in einem geschlossenen Wagen mit einem Weinhändler aus Köln, der seine Ware gut verkauft hatte und nichts mit in seine Heimatstadt zurückbrachte. Anton fuhr auf dem Bock mit, denn das Wetter war wunderbar; es ging ein laues Frühlingslüftchen, die Schwalben schwirrten bereits um die Stadtmauern, und Bussarde und Amseln schossen über die Felder und Weiden, auf denen Kühe und Schafe träge ihr unverständliches Leben lebten.
Elisabeth betrachtete den Weinhändler eine Weile, bevor sie etwas sagte. Er war ihr unbekannt, aber schließlich kannte sie sich in diesem Geschäft kaum aus. Ob er Ludwig gekannt hatte? Sicherlich waren sie sich bei den Zusammenkünften der Gaffel Himmelreich schon begegnet. Schließlich sprach sie ihn an. »Waren die Geschäfte gut, mein Herr?«
Der Kaufmann blinzelte ihr freundlich zu und zog die Kappe vor ihr. »Hans Gartzem, meine ehrenwerte Dame«, stellte er sich vor. »Ja, ich kann nicht klagen. Seit der Verhansung Kölns ist alles sehr schwierig geworden, und man muss sich neue Absatzmärkte schaffen. Früher habe ich den größten Teil des Weines nach Norden exportiert, aber damit ist jetzt Schluss. Man lässt uns Kölnische nicht einmal mehr in die Städte der Hanse, geschweige denn lässt man uns dort Handel treiben.«
»Es muss für viele von Euch sehr schwer sein, noch den Unterhalt zum Leben zu verdienen«, meinte Elisabeth vorsichtig. Der Wagen rumpelte so stark über eine Unebenheit, dass die Insassen durcheinander gewirbelt wurden. Elisabeth fiel dem Kaufmann auf den Schoß, was diesem sichtliches Behagen bereitete, aber er nutzte die Lage nicht aus. Sofort sprang Elisabeth mit hochrotem Kopf von ihm fort und setzte sich wieder auf die Bank ihm gegenüber.
Jakob Gartzem rückte sich die verschobene Kappe zurecht, strich genießerisch an der langen, schillernden Pfauenfeder entlang und sagte: »Ja, manchen hat es im wahrsten Sinne das Genick gebrochen. Es kommt halt darauf an, ob man wendig genug ist, um sich auf die neue Lage einzustellen. Ich zum Beispiel habe meine alten Kontakte wieder aufgefrischt und kann meinen Wein und meine Stoffe nun in den Niederlanden bis hinunter nach Herzogenbosch absetzen. Aber anfangs war ich auch nicht begeistert von der neuen Lage. Wenn ich Mitglied des Rates gewesen wäre, hätte ich gegen die offene Konfrontation mit der Hanse gestimmt. Ich finde es heute noch erstaunlich, dass der Rat es gewagt hat, sich gegen die Fischköpfe zu stellen. Zuerst sah es so aus, als würden die Ratsherren klein beigeben.«
Elisabeth hob die Brauen. Sie erinnerte sich an das, was Heynrici gesagt hatte. Ludwig war eines der Ratsmitglieder gewesen, die die Verhansung vorangetrieben hatten.
»Aber das ist für Euch als Dame bestimmt sehr langweilig«, fuhr Gartzem fort.
»Ganz und gar nicht«, beeilte sich Elisabeth zu versichern. »Wisst Ihr, welche Rolle Ludwig Leyendecker bei dieser Sache gespielt hat?«
Der Kaufmann runzelte die Stirn. »Leyendecker? Warum fragt Ihr nach ihm?«
Elisabeth räusperte sich. »Ich hatte seinen Namen einmal in diesem Zusammenhang gehört. Ansonsten weiß ich über solche Dinge nichts.«
»Das ist auch gut so. Ich sage Euch, die Regierungsgeschäfte sind wie eine Schlangengrube. Ich bin froh, dass ich nicht im Rat sitze.« Er wischte sich über die Stirn. »Was Leyendecker angeht, so war er der führende Kopf bei der Befürwortung des Englandhandels, und er war in der Wahl der Mittel zur Durchsetzung seiner Ziele nicht gerade zimperlich. Doch über Tote soll man nicht schlecht sprechen. Ihr wisst vielleicht, dass er sich mit dem Teufel verbündet hat und ihm der Erzfeind den Hals gebrochen hat.« Der Kaufmann bekreuzigte sich rasch.
Aha, das redet man also, dachte Elisabeth. Es drehte ihr beinahe den Magen um. Es war so wichtig, den Mörder Ludwigs zur Rechenschaft zu ziehen, um diese Gerüchte aus der Welt zu schaffen. Der Kaufmann schwieg; er schien alles gesagt zu haben, was er wusste. Nun grinste er Anne ein wenig anzüglich an. Elisabeth versank in ihren Gedanken. Wenn sie nur schon in Köln wäre und sich mit Andreas bereden könnte!
Doch die Reise würde noch eine Weile dauern.
Während der langen Fahrt, die zumeist in der Nähe des Rheins verlief und nur durch die Zollstationen und den Einbruch der Dunkelheit unterbrochen wurde, schienen sich Anton und Anne immer enger anzufreunden. Einmal erwischte Elisabeth die beiden, wie sie hinter einem Wagen an der Grenze des Herzogtums Brabant eng umschlungen standen und sich küssten. Elisabeth freute sich über die beiden, aber sie wunderte sich, dass Anne nach den schlimmen Erfahrungen mit ihrem Mann und trotz ihres Verdachtes, dass Anton mit öffentlichen Frauen umging, eine Beziehung zu ihm einzugehen wagte. Sie schien regelrecht aufzublühen, und als Elisabeth sie später, hinter der Grenze, nach Anton fragte, wurde sie rot und antwortete nur einsilbig. Anton hingegen wurde immer redseliger und schwärmte in Elisabeths Gegenwart von Anne wie von einer Heiligen.
Читать дальше