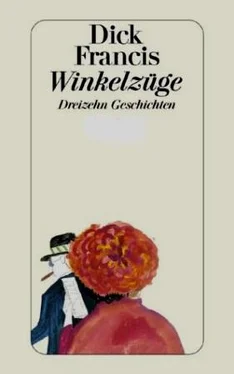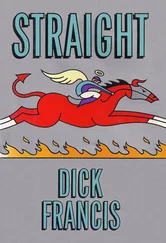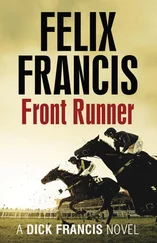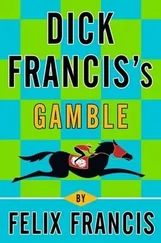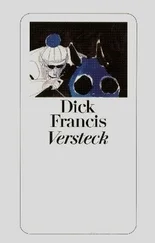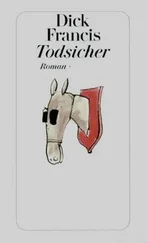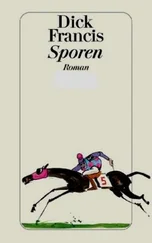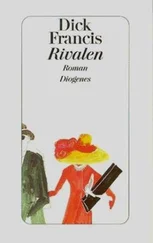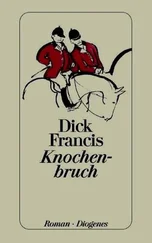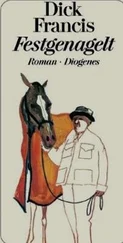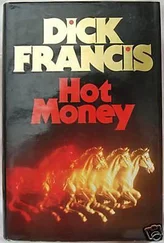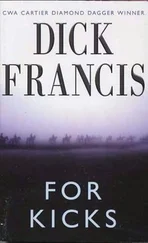>Gelegenheiten< wurden Emile Jacques per Post über einen nicht identifizierten Mittelsmann angetragen, den er nie kennengelernt hatte. Bevor er einen Auftrag annahm, unterzog er ihn einer gründlichen Untersuchung. Emile hielt sich für erste Klasse. Der amerikanische Ausdruck» Totschläger «war für einen Mann von seiner Gesinnung unbedingt vulgär. Emile nahm einen Auftrag erst dann an, wenn er sich sicher war, daß sein Kunde zahlen konnte, zahlen würde und nicht nachher von weinerlicher Reue überwältigt zusammenbrach. Überdies bestand Emile auf der Konstruktion wasserdichter Alibis für jeden Kunden, auf den ein überwältigender Verdacht fallen mußte. Und obwohl das durchaus einfach klang, war dies bisweilen der Faktor gewesen, der allein über Tun oder Lassen entschieden hatte.
So war es auch an einem bestimmten Dienstag im Dezember 1986. Das unentbehrliche Alibi schien perfekt zu sein, so daß Emile den Auftrag annahm und sorgfältig seine Taschen für eine kurze Reise nach England packte.
Emiles Englisch, das eher zweckmäßig als kunstvoll war, hatte ihn bisher drei englische Morde in vier Jahren unbeschadet überstehen lassen. Die Paradestücke der Touristenwörterbücher — (»Mon auto ne marche pas«; »Mein Wagen ist stehengeblieben«) — hatte ihn nicht nur vor der gefährlichen Neugier anderer bewahrt, sondern es ihm auch ermöglicht, seine Mission vorausschauend zu verwerfen, wenn ihn vor der Tat ein Gefühl der Unsicherheit plagte. Tatsächlich hatte er schon zweimal in einem späten Stadium den bereits begonnenen Job abgebrochen: einmal wegen schlechten Wetters, ein anderes Mal aus Unzufriedenheit über die Erbärmlichkeit des vorgeschlagenen Alibis.
«Pas bon«, sagte er sich.»Nicht gut.«
Sein Klient, der ein halbes Vermögen im voraus gezahlt hatte, wurde angesichts der Verzögerungen immer ungeduldiger.
An jenem Dienstag im Dezember 1986 jedoch war Emile Jacques, das Alibi betreffend, so zufrieden, wie er es nur sein konnte. Er hatte seine Koffer gepackt und sich beim Schießsportverein für die nächsten Tage abgemeldet und machte sich nun in seinem unauffälligen weißen Wagen auf den Weg nach Calais, um von dort aus die winterliche See des Ärmelkanals zu überqueren.
Wie gewöhnlich führte er die Werkzeuge seines Gewerbes offen mit sich: Handfeuerwaffen, Ohrenschützer sowie mannigfache Zertifikate, die seine Anerkennung als zugelassener Lehrer in einem hochklassigen Pariser Club bewiesen. Das Ganze hatte er in einem verschlossenen, mit Schaumgummi ausgepolsterten Koffer aus Metall, wie Fotografen ihn besaßen. Es sollte noch zwei Jahre dauern, bis Handfeuerwaffen in England verboten wurden, so daß seine Geschichte von einer beabsichtigten Teilnahme an einem Wettbewerb nicht in Frage gestellt wurde. Hätte man ihm bei der Einreise Schwierigkeiten gemacht, hätte er nur resigniert gelächelt und wäre nach Hause gefahren.
Emile Jacques Guirlande, von Beruf Mörder, bekam an jenem Dienstag im Dezember 1986 keine Schwierigkeiten. Nachdem er die Hürde Dover mühelos genommen hatte, fuhr er zufrieden durch die im Winterschlaf liegenden Felder Südenglands und ging im Geiste friedlich noch einmal seinen bösen Plan durch.
In diesem Jahr knisterte es in der Jagdrennszene der britischen Rennplätze. Grund für dieses Knistern war die unmögliche Trainer-Jockey-Allianz zwischen einem langhaarigen Abkömmling echter Zigeuner und dem aristokratischen Neffen aus einem historischen Haus.
Gypsy Joe (genauer gesagt, John Smith) verspürte und zeigte jene beinahe magische Verbundenheit mit Tieren, wie sie bei seinem Volk schon seit Urzeiten existiert. Gypsy Joe zuliebe gruben Vollblüter in ihrem eigenen archaischen Stammesgedächtnis und begriffen, daß die Führung der Herde das Ziel des Lebens war. Der Anführer der Herde gewann das Rennen.
Gypsy Joe gab seinen Pferden mit großer Umsicht das Futter und das Training, das ihren Herzen die größtmögliche Kraft verlieh, und flüsterte ihnen, während er sie für ein Rennen sattelte, rätselhafte Worte der Ermutigung zu. An üblichen Maßstäben gemessen war er durchaus erfolgreich und erfreute sich der widerwilligen Bewunderung der meisten seiner Kollegen, aber für Joe war das nie genug. Er war stets — und vielleicht unrealistischerweise — auf der Suche nach einem Reiter, dessen psychische Schwingungen genau zu dem paßten, was er von seinen Pferden wußte. Er suchte nach Jugend, Mut, Talent und einer unverdorbenen Seele.
Jedes Jahr, während er sich mit den Pferden aus seinem Stall beschäftigte, beobachtete und analysierte er die Rennreiter, die neu auf der Bahn waren. Nach fünf Jahren fand er endlich, wonach er suchte, und verschwendete keine Zeit, es sich öffentlich zu sichern.
Und so erschütterte Gypsy Joe im Spätfrühling des Jahres 1986 die Bruderschaft der Jagdrennjockeys, indem er einem unbeschwerten Amateur — der genau eine Saison lang Rennen geritten und keine bemerkenswerten Siege errungen hatte — einen Jockeyvertrag anbot. Der Amateur brauchte sich, um diesen ungewöhnlichen Vorschlag annehmen zu können, lediglich unverzüglich eine Lizenz als Berufsjockey zu verschaffen.
Red Millbrook (Red für rot; er hatte rotes Haar) hatte dem telefonischen Angebot von Gypsy Joe mit derselben allgemeinen Verwirrung gelauscht, die schon bald etliche andere befallen sollte, angefangen von den Mandarinen des Jockeyclubs bis hin zu kritischen Scharen von Stalljungen in den heimischen Pubs.
Erstens wurden für Jagdrennen nur wenige Reiter fest verpflichtet. Zweitens ritten bereits (wenn auch ohne Verträge) zwei Profis, beides alte Hasen, regelmäßig für Gypsy Joe; beider Resultate wurden weithin als zufriedenstellend betrachtet, da Gypsy Joe auf der Siegertafel der Trainer an fünfter Stelle stand. Drittens konnte man Red Millbrook, der die Schule noch nicht lange hinter sich hatte, als unbedarften Neuling einstufen.
Mit der Selbstsicherheit der Jugend bewarb sich der >un-bedarfte Neuling< unverzüglich um eine Lizenz.
Red Millbrook, soeben zum professionellen Jockey aufgestiegen, sah Gypsy Joe zum ersten Mal von Angesicht zu Angesicht, als er vor dem April Gold Cup in Sandown Park voller Neugier in den Führring trat. Gypsy Joe, vierzig und ebenso dickköpfig wie selbstbewußt, wußte, daß er den Spott der Rennszene herausforderte, wenn er diesen beinahe unerprobten Adelssproß in einem großen Rennen zum ersten Mal testete, noch dazu auf einem Pferd, auf dem er nie zuvor gesessen hatte. Kritische Kommentare in verschiedenen Rennzeitungen hatten Joe bereits öffentlich Schelte dafür erteilt, daß er seine beiden nützlichen, getreuen — und wutschnaubenden — Stalljockeys übergangen hatte und» die Hoffnung auf den Gold Cup um eines Publicitygags willen hatte fahren lassen«. Gypsy Joe vertraute seinem Instinkt und ließ sich nicht beirren.
Der junge Red Millbrook sah in Gypsy Joe, als er ihn im Führring traf, einen großen, ungepflegten, langmähnigen Kerl von einem Mann und bedauerte schon die spontan eingegangene Verpflichtung zu reiten, wann immer und wo immer der Trainer es ihm auftrug.
Die beiden so schlecht zusammenpassenden zukünftigen Verbündeten schüttelten einander zaghaft und unter den Augen von Tausenden von Fernsehzuschauern die Hände, und Red Millbrook dachte, der Schauder, der ihn durchlief, sei nur auf die Erregung des Augenblicks zurückzuführen. Gypsy Joe lächelte jedoch zufrieden vor sich hin und war vielleicht der einzige Zuschauer, den es nicht überraschte, als sein Starter sich mit einer halben Länge Vorsprung das Gold sicherte.
Nicht daß Red Millbrook in seinem kurzen Leben je schlecht geritten wäre: In der Tat hatte er alle freien Stunden seiner Jugend auf dem Pferderücken zugebracht, obwohl diese freien Stunden zielgerichtet von elterlicherseits aufgenötigter Schulbildung begrenzt worden waren. Seine mit Adelstiteln geschmückten Eltern konnten durchaus Stolz für ihren Sohn als Amateur aufbringen, schraken aber entsetzt vor dem Wort >professionell< zurück. Wie eine Nutte, stöhnte seine Mutter.
Читать дальше