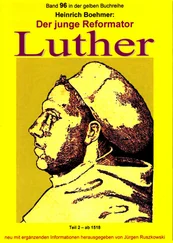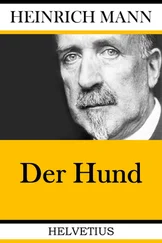Ich blickte in die Richtung, in die Simon zeigte. Beziehungsweise auf die Konstruktion, welche jenseits des Zauns, der den Sportplatz abgrenzte, aufragte: ein Felsen. Ein mächtiger Felsen. Zudem ein künstlicher. Und auf diesem mächtigen, künstlichen Felsen viele bunte Elemente, als hätte der Felsen einen lustigen Hautausschlag. Wie Kinder ihn gestalten würden, könnten sie wenigstens das Aussehen von allergischen Reaktionen bestimmen.
Jedenfalls handelte es sich um einen Kletterfelsen, an dem eine Vielzahl von Personen sich daran versuchte, die Wände hochsteigend oder sich an den gesicherten Seilen herunterlassend.
Natürlich sah ich diesen farblich gepunkteten Kegel nicht zum ersten Mal, auch wenn ich mein Training eher in die Gegenrichtung absolvierte. Abgesehen davon, daß ich beim Hürdenlauf immer nur die Hürden wahrnahm und sicher nicht die sie umgebende Landschaft. Aber spätestens beim Zurücktraben …
Ich hatte einen Grund, diese markante Erhöhung unbeachtet zu lassen. Mein Verhältnis zu Bergen und erst recht zu deren Besteigung war ein gestörtes. Freilich nicht aus eigener Anschauung. Ich war niemals auf Felsen geklettert, gleich ob echt oder künstlich. Die Höhe war mir seit jeher ein Greuel, wobei es einen Unterschied machte, aus einem Flugzeug Tausende Meter hinunterzuschauen oder Hunderte von einem Berg senkrecht ins Tal. Oder auch nur zehn Meter. Meine Schwester hingegen …
Richtig, über meine Schwester ist hier noch kein einziges Wort gefallen. Aber wie oft geschieht es überhaupt, daß die Leute von ihren Geschwistern reden? Von ihren Hunden, das schon, ihren Kindern, ihren Eltern, geliebt oder ungeliebt, ihren Feinden und Freunden, aber kaum ein Erwachsener erwähnt seine Geschwister. Wenn, dann wird wie über eine Nebensache gesprochen. Geschwister sind die Leute, die man zu Weihnachten trifft. Und wie oft ist Weihnachten?
Stimmt schon, so muß es nicht sein, aber meistens eben schon. Zudem war es in meinem Fall noch weit schwieriger. Ich sah meine Schwester, ich sah Astri, auch Weihnachten nicht mehr. Seit über einem Jahrzehnt lag sie auf einem Kölner Friedhof. Im Spätsommer 2002, eineinhalb Jahre bevor ich meinen eigenen Unfall hatte und in einer defekten Boeing ins Ostchinesische Meer gestürzt war, war meine Schwester in den Tiroler Bergen ums Leben gekommen.
Sie verunglückte, als ein Blitz in den Felsen einschlug und sie hinauskatapultierte. Sie war an die hundert Meter gefallen, ohne auch nur einmal die Steilwand zu streifen, und schließlich auf dem Felssockel aufgeprallt. Als die Bergrettung sie einen Tag später barg, hatte eine Haube von Schnee ihren Körper bedeckt. Wie ein Sarkophag, hatte einer der Männer gemeint. Und tatsächlich dachte ich oft, wieviel besser es gewesen wäre, sie nahe dem Berg zu begraben, als sie hinunter ins Tal zu bringen, hinaus aus Österreich, hinein nach Deutschland, hinüber auf den Kölner Friedhof, wo weit und breit kein Berg war, bloß viele gebändigte Steine.
Übrigens war es Ende September gewesen und das Unwetter vollkommen überraschend gekommen, während es in meinem Fall durchaus angekündigt gewesen war. Aber in beiden Fällen hatte ein Gewitter seine dramatische Wirkung getan.
War das alles, was uns verband?
Jedenfalls nicht die Liebe der Eltern. Es war allein Astri gewesen, die diese Liebe auf sich gezogen hatte. Die des Vaters noch stärker als jene der Mutter. Zwei Jahre nach mir geboren, waren sich diesmal beide Elternteile über die Namensgebung einig gewesen. Sie wählten eine der finnischen Formen von Astrid: Astri. Denn unter den Ahnen beider Familien hatte es sowohl eine Astrid wie auch eine Astri gegeben, die beide über hundert Jahre alt geworden waren. Somit sollte die Wahl dieses Vornamens als ein gutes Omen wirken.
Später klagte meine Mutter, wie wahnsinnig es gewesen sei, das Schicksal auf diese Weise herauszufordern. Sie erkannte darin allen Ernstes eine Schuld. Sie sagte:»Als hätten wir ein Todesurteil unterschrieben.«
Astri wurde bloß zweiundzwanzig. Das ist, wie man so sagt, kein Alter zum Sterben. Wobei sie immerhin an jenem Ort umkam, der ihr der liebste gewesen war. Das war auch immer ihre Rede gewesen, lieber jung sterben zu wollen, dafür beim Klettern, als im Krankenhausbett oder sonstwie bewegungsunfähig ein hohes Alter zu erreichen. Oder auch nur Mutter zu werden und gleich der eigenen Mutter in die Fänge eines Haushalts zu geraten.
Klar, es gibt auch eine Mitte. Es gibt auch die Möglichkeit, Mutter zu werden und dennoch weiter in die Berge zu gehen. Aber für Astri war dort, in der Mitte, kein Platz gewesen.
Bezeichnenderweise hatte sie sich als ihre persönliche» Heiligenfigur «den österreichischen Arzt und Bergsteiger Emil Zsigmondy ausgesucht, der 1861 geboren wurde und ebenfalls sehr jung, nämlich vierundzwanzigjährig, in den französischen Alpen abgestürzt war. Vor allem aber fällt auf, daß Zsigmondy 1881 als erster die Südflanke jenes Berg begangen hatte, an dessen Nordkante Astri 2002 ums Leben gekommen war.
Ich hatte derartige Leidenschaften nie begriffen, sich an unmenschliche Orte zu begeben, tief ins Meer, hoch in die Lüfte, in dunkle Höhlen, eisige Weiten. Worin besteht denn das Vergnügen, sich die Zehen abzufrieren? Klar, es geht um Überwindung, um die Beherrschung des eigenen Körpers, gerade dort, wo er nichts verloren hat. Weshalb man ja diesen Körper auf die Bedingungen zuschneidet. Astri hatte eine ungewöhnliche Kombination aus geringem Gewicht und ausgeprägten Muskeln entwickelt. Eine Kreuzung aus Eiskunstläuferin und Bodybuilderin. Wenn sie hundert Liegestütze machte, dann mit einer Leichtigkeit, als hänge sie an dienstbaren Fäden.
Bei rascher Betrachtung mag es eigentümlich wirken, wie wenig uns der Umstand verband, daß ich ein Hürdensportler wurde und sie eine Kletterin. Kein Interesse am anderen, keine Konkurrenz, keine Bewunderung. Was ich tat, war eben bloß ein Sport, Astri hingegen praktizierte eine Religion. Sie kletterte gewissermaßen mit Gott gegen Gott, während ich selbst maximal gegen Gegner oder die Zeit lief. Zudem war in meinem Fall stets klar, daß ich, bei aller Liebe zu den Hürden, ihnen nicht mein ganzes Leben widmen würde. Astri hingegen war eine Nonne. Sie hatte ihren Körper und ihr Leben etwas Höherem versprochen. Klar, sie ging auch mal mit Jungs weg, ging mal ins Kino oder in die Disco, aber das war eher den Stunden geschuldet, die sie im Tal — Köln war einfach» das Tal«— verbringen mußte, um die Schule zu besuchen, später die Universität (sicher hätte sie lieber in Innsbruck studiert, aber das war nicht drin). Doch selbst im Tal befand sie sich die meiste Zeit in der Senkrechten oder mit dem Rücken zur Erde, einerseits in einer Kletterhalle, andererseits in einem Raum, den sie sich auf dem Dachboden der Großeltern selbst eingerichtet hatte. Ein Raum als Überhang, ein höchstpersönlicher künstlicher Felsen, auf dem sie wie auf der Unterseite eines Netzes lebte. Die Nonne als Spinne.
Mir war immer klar gewesen, daß Astri in den Bergen sterben würde. Nur geschah es viel zu früh. Wobei die meisten Bergsteiger gerade fürchten, es könnte zu spät geschehen, es könne sie erst ereilen, wenn sie außerstande sind, die Felsen und Hänge aufzusuchen.
Als Astri gestorben war, hatten meine Eltern aufgehört, sich als Eltern zu fühlen. Der Elternteil in ihnen war genauso erloschen wie ihr Kind. Sie hatten nur noch in einem bürokratischen Sinn weitergelebt, ihre Pflicht erfüllend: der Vater in der Fabrik bei seinen Kartonagen, der nun auch seine frühere Leidenschaft für die Malerei und die Literatur (seinen Thomas-Bernhard-Glauben) aufgab, die Mutter als Hausfrau und Privatfriseuse, ohne echte Liebe zum Haushalt und ohne echte Liebe zu den Frisuren (im Grunde war sie am ehesten dem Staub verbunden, gegen dessen Unsterblichkeit sie aufbegehrte), auch ohne echte Liebe für den kleinen Garten am Stadtrand, den sie nur noch so betreute, wie man jemanden an ein paar Schläuche hängt und seine Windeln wechselt. Aber niemals seine Wangen berührt oder mit ihm redet.
Читать дальше