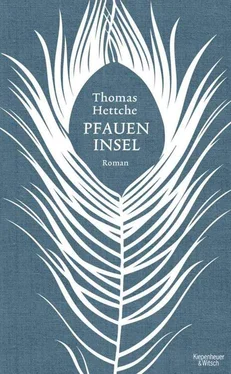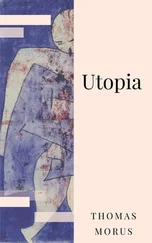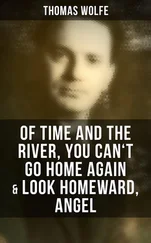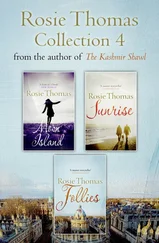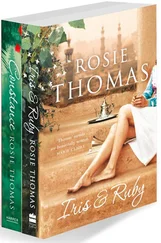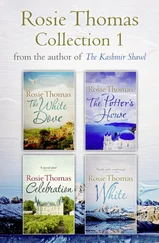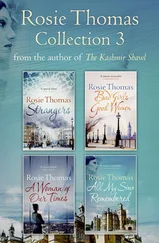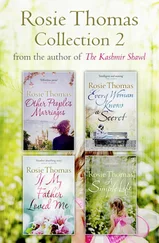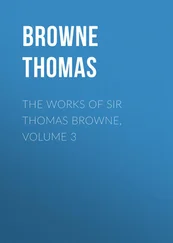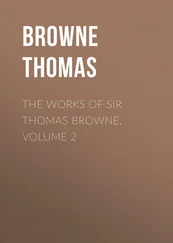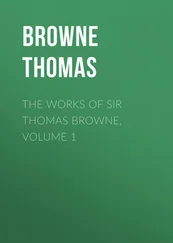Jetzt beugte er sich über die Wiege. »Ich sorge für es«, sagte er, ohne Marie anzusehen. »Aber du mußt es mir geben.«
Sie verstand nicht.
»Was meinst du damit?« fragte sie leise.
Sein Gesicht kam hoch und war jetzt ganz dicht vor ihrem. »Du mußt es mir geben«, wiederholte er sanft.
Vor Entsetzen schüttelte sie den Kopf. »Der Onkel wird es nicht zulassen.«
»Der Onkel weiß es.«
»Dann mußt du auch mich töten!«
Er musterte sie mit einem bitteren Lächeln. Und so sanft, als wäre sie ein uneinsichtiges Kind, sagte er: »Wer spricht vom Töten? Du mußt von der Insel, wenn du mir das Kind nicht gibst. Es ist ein Bastard, und man weiß nicht, von wem.«
Marie hätte schreien wollen, doch sie konnte es nicht. Konnte nicht schreien und konnte nicht weglaufen. Der Käfig war um sie. All die Jahre. Nur hatte sie es nicht gespürt.
»Und es ist ungetauft«, setzte er noch hinzu.
Entsetzensstarr konnte Marie nur zusehen bei dem, was Gustav nun tat. Und auch das Kind nahm es regungslos hin, als vertraute es dem, den es doch gar nicht kannte, und blieb ganz still, als Gustav es aus der Wiege nahm. Sorgsam schlug er ein Tuch um es, das Marie über einen Stuhl geworfen hatte, ging wortlos hinaus und schloß leise die Tür.

Kaum zwei Wochen später übergab Ferdinand Fintelmann seinem Neffen das Pfaueninsel-Revier und zog nach Charlottenburg, wo er noch bis 1863 im Schloßgarten tätig war. Für gewöhnlich arbeiteten Hofgärtner bis zu ihrem Tode ohne Hilfe, um ihr Gehalt nicht mit einem Adjunkten teilen zu müssen, und so wunderten sich alle auf der Insel, weshalb Ferdinand Fintelmann sie gerade zu diesem Zeitpunkt verließ, und mancher hatte bei dieser Nachricht ein ungutes Gefühl, was die Zukunft anging. Gustav kränkte vor allem, daß seine Mutter beschlossen hatte, mitzugehen. Mit keinem Wort hatte die noch immer hochgewachsene und sich gerade haltende Frau, deren einst so schönes Gesicht nun von vielen Falten überzogen war, den Sohn darauf vorbereitet, und da er sich ausgemalt hatte, sie bleibe und führe ihm weiter das Haus, kam es vor dem Abschied zu Auseinandersetzungen, und auch die kleine Abschiedsfeier im Kastellanshaus war nicht heiter.
Gustavs Brüder waren gekommen, einige Gärtnerkollegen mit ihren Frauen, ehemalige Gehülfen. Man rettete sich in eine gewisse Förmlichkeit, was leicht war, da auch Lenné sich eingefunden hatte und die Feier damit etwas Offizielles bekam. Der Gartendirektor schenkte Fintelmann einen durch seinen geschicktesten Zeichner, Gerhard Koeber, gefertigten Verschönerungs-Plan der Umgebung von Potsdam , auf dem sich all das fand, was in den letzten Jahren auf der Insel verändert worden war. Es war ein wundervoller Plan, detailgenau und geschmackvoll coloriert, für den Fintelmann sich sehr bedankte, wenn er ihn auch wieder daran erinnerte, wie gerne er jenen anderen mitnähme, den er selbst vor dreißig Jahren von der Insel gezeichnet hatte und der noch immer im Schloß hing.
Bis zum letzten Moment, bis zur Abreise des Onkels, konnte Marie nicht anders als hoffen, er werde das Unrecht wiedergutmachen. Nachdem Gustav mit dem Kind gegangen war, hatte sie sich eine Woche lang nicht rühren können. Jeder Schrei war in ihr erstickt. Ob sie geschlafen hatte? Sie wußte es nicht. Hatte nichts angerührt von dem Essen, das die Klugin ihr ans Bett brachte. Bis diese es nicht mehr ausgehalten und zum Hofgärtner um Hilfe gelaufen war, der auch gleich gekommen war, um nach Marie zu sehen.
Und für einen Moment hatte Marie da tatsächlich gehofft, es werde sich nun noch alles zum Guten wenden. Hatte sich mühsam aufgerichtet, sich geschämt dafür, wie verwahrlost sie aussah, und Fintelmann alles erzählt, obwohl er den Grund ihres Unglücks natürlich längst kannte. Er hatte ihr schweigend zugehört und genickt dazu und schließlich gesagt, wie leid ihm das alles tue. Ihr mit einem traurigen Lächeln über die Stirn gestrichen. Aber so sei es besser. Wirklich, sie müsse ihm glauben, so sei es am besten. Was denn? Daß das Kind nicht mehr hier auf der Insel sei. Da hatte Marie die Tränen nicht mehr zurückhalten können und ihn schluchzend weggeschickt.
Dennoch war sie, wie alle Bewohner der Insel, bei seiner Abreise am Steg. Und als er sie sah, kam er zu ihr, und wieder mußte sie weinen, und er hob sie, obwohl es ihm schwerfiel, wie als Kind noch einmal hoch und streichelte ihr über die Wange. Und noch immer konnte Marie nicht anders, als auf ein Wort von ihm zu hoffen. Währenddessen verabschiedete sich die Herrnhuterin von ihrem Sohn ohne große Herzlichkeit. Dann stiegen sie miteinander in den Kahn. Und als letztes, bevor sie losmachten, instruierte der alte Hofgärtner Gustav noch einmal, was mit den Hunderten von Topfpflanzen zu geschehen habe, die er sorgsam vorbereitet hatte, und die er ihm nachzusenden bat, sobald die Witterung im Frühjahr es zulasse.

Auf Einladung des Garten-Directors Peter Joseph Lenné hielt Gustav Adolph Fintelmann Anfang des folgenden Jahres seinen ersten Vortrag auf der 125. Versammlung des Vereins zur Beförderung des Gartenbaues in den königlich preußischen Staaten . Das enge Gestühl in dem hohen holzgetäfelten Raum war bis auf den letzten Platz besetzt, und der Tabakrauch hing dicht in der verbrauchten Luft, als er durch die niedrige Schranke an den ovalen Tisch trat. Der Titel seines Vortrags lautete: Über Anwendung und Behandlung von Blattzierpflanzen.
»Das spielende Kind«, begann er, nachdem er sich für die Einladung bedankt hatte, »das spielende Kind pflückt sich Blumen von der Wiese, der Mann aber betrachtet die schönen Gruppen, bei denen nur Form, ungestört durch bunte Farben, ergötzt.«
Damit war der Ton angeschlagen, der von nun an alles Tun Gustav Fintelmanns bestimmen würde. Er hatte sich entschieden. Für ihn gab es nur mehr das Reich der Blätter. Und tatsächlich würde die Pfaueninsel unter ihm zur Wiege der großen Blattpflanzenmode des 19. Jahrhunderts werden, der Blattform, Blattgröße, Blattstellung so viel wichtiger war als die Blüten und ihre Farben.
»Sprechen Schönheit und Mannigfaltigkeit der Blumen zu uns von dem unerschöpflichen Reichtum der Natur«, fuhr er mit fester Stimme fort, »so erinnert die Üppigkeit und Größe der Blätter an ihre Kraft und Fülle, sie mahnen uns an die fernen Tropen, wohin uns unsere Wünsche so oft tragen, dort, wo die Vegetation in ihrer ganzen Macht herrscht.«
Niemand im Raum wußte, was auf der Insel geschehen war, außer Lenné, dem Gustav sich in einer schwachen Stunde offenbart hatte. Mit aller Vehemenz hatte der Garten-Director sich gegen etwaige Ansprüche der Zwergin ausgesprochen. Ja, daß sie das Kind auf gar keinen Fall behalten, die Saat niemals aufgehen dürfe. Stolz darüber, daß er ihm gefolgt war, musterte Lenné jetzt seinen Eleven, dessen Entwicklung, die er so umsichtig gefördert hatte, ihm recht gab. Gustav machte in dem dunkelroten Frack mit seiner schmalen Taille à la mode eine so ausgesprochen gute Figur, daß er überlegte, ob er wohl ein Korsett trug, wie viele es jetzt taten. Jedenfalls saßen seine hellgrauen Pantalons ebenso perfekt wie die in allen leuchtenden Blautönen gestreifte Weste und der Vatermörder mit ebenfalls blauem Jabot, das Lenné an das Blau der Hortensien erinnerte, auf das Gustav so stolz war. Und außerdem, was ihm in diesem Moment gar nicht recht war, an eine bestimmte Begegnung mit jener Zwergin im Labyrinth zwischen den Rosen.
Das Bild, wie dieses Geschöpf damals im Sommerlicht dagestanden hatte mit der ganzen überströmenden Liebe, die es offenkundig absurderweise für seinen Schüler empfand, wollte nicht weichen. Aber schließlich gelang ihm doch, es verschwinden zu lassen, indem er es, wie es seine Art war, mitsamt dem Hintergrund, auf dem es zu leuchten nicht aufhören wollte, abtat. Alles war getan, sagte er sich. Die Pfaueninsel, so, wie sie war, vollendet. Mochte jenes Wesen inmitten der Käfige seinen Platz haben, weder ihn noch Gustav kümmerte dies von nun an, da war sich Lenné, während er ihm zuhörte, ganz sicher.
Читать дальше