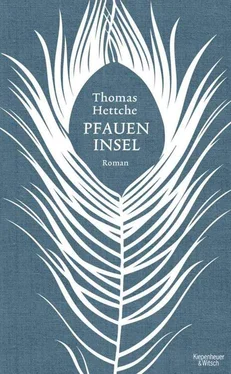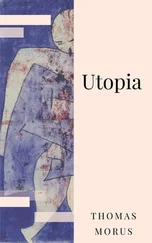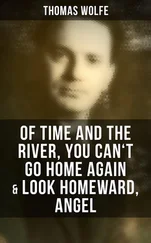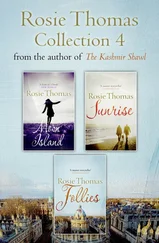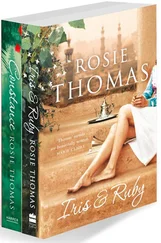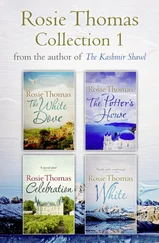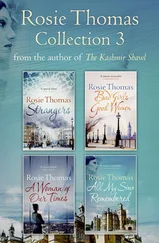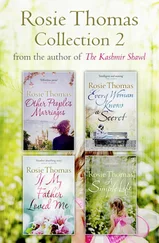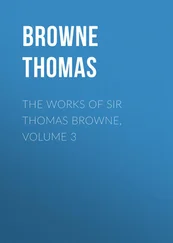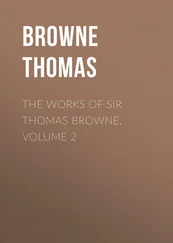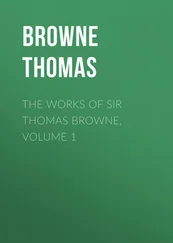Und in diesem Moment schreckte Marie das erste Mal aus ihrem Traum auf. Mein Kind! hört sie sich selbst schreien, nur, um von ihrem Traum wie betäubt wieder einzuschlafen, beruhigt von jener gläsernen Tür in einer gläsernen Wand, von der sie den unerklärlichen Eindruck eines grünen Scheins, die Empfindung von etwas Warmem, Blühendem behielt, als sie in ihren Traum zurücksank, was sich anfühlte, als ließe man alles los, als atmete man plötzlich so ungeheuer wollüstig tief, daß der ganze Körper flatternd verschwand.
Und dann stand sie plötzlich im Saal des Schlosses und vor ihr, auf dem Boden, lag das Ding aus der Havel. Es war ein Bündel. Sie zweifelte, daß es das vorher auch schon gewesen war, mit Sicherheit aber wußte sie es nicht. Es fühlt sich wie ein körperlicher Schmerz an, wie ein Ziehen irgendwo ganz tief in einem, wenn man versucht, sich in Träumen zu erinnern. Sie war im Nachthemd. Sie hockte sich hin und betrachtete es. Sie wußte, es sollte atmen darin. Etwas sollte sich bewegen. Aber es war ganz starr. Und mit Herzklopfen öffnete sie es. Und erschrak vor dem, was sie da herausschälte aus dem nassen Stoff. Ihr bleichblaues Kind, so klein, wie es gewesen, als es zur Welt gekommen war. Und noch viel kleiner. So klein, wie es nie gewesen war. So klein, daß es auf der Handfläche eines normal gewachsenen Menschen Platz gehabt hätte. Dabei aber gar nicht fein und zart die Arme und Finger und das Köpfchen, Marie sah das im Traum überdeutlich, und sie streichelte dem kalten Wesen das Bäuchlein, küßte es und schmeckte das kalte Wasser an ihm, küßte es und weinte und erwachte endlich.

Vorsichtig folgte Gustav mit dem Finger der Blattwölbung einer der Pelargonien, die noch immer, wie zu Zeiten seines Onkels, ihren Platz auf dem Fensterbrett des Arbeitszimmers hatten. Er erinnerte sich daran, wie er das auch als Junge getan und geglaubt hatte, in den feinen Blattadern tatsächlich eine Bewegung zu spüren, das Leben darin.
Bevor der Onkel die Insel verließ, hatte er ihm mit einem feierlichen Blick die Instruktion für den Königlichen Hofgärtner und Schloßkastellan auf der Pfaueninsel bei Potsdam auf den Schreibtisch gelegt, von dem er sorgsam alle persönlichen Dinge entfernt hatte. Nie war das Verhältnis des Onkels zu ihm so innig gewesen wie zu einem leiblichen Sohn, und weil er mißbilligte, was Gustav hinsichtlich des Kindes unternommen hatte, war der Abschied zwischen ihnen kalt. Und gerade deshalb hatte Gustav sich mit einem Gefühl der Genugtuung an seinem ersten Tag als Hofgärtner an den leeren Schreibtisch gesetzt und die Instruktionen genauestens studiert. Ihm oblag die polizeiliche Beaufsichtigung der Insel, also des Gartens, des Schlosses und die Verwaltung der Meierei. Er hatte dafür Sorge zu tragen, daß die Arbeiter auf den Wegen blieben, kein anderer Landungs- oder Abfuhrplatz auf der Insel genommen wurde als derjenige vor dem Kastellanshaus, daß niemand auf der Insel einen eigenen Kahn hatte, das Vieh nur auf der Meierei frei herumlief, der Dünger aus der Menagerie für den Garten und die Milch aus der Meierei wiederum für die Menagerie bereitgestellt wurden. Er hatte die Weiderechte mit dem Menagerieinspektor abzusprechen und mit diesem gemeinsam jeden Oktober einen Bericht an den Hofmarschall zu verfassen, was die Tiere und den Zustand der Gebäude anging. Schließlich hatte er dafür zu sorgen, daß die Besucher das Tabakrauchen, Mitführen von Hunden, Speisen und Getränken unterließen.
Es war das Jahr 1842. Gustav war jetzt Mitte dreißig und sein Haar, das er etwas länger trug, lichtete sich bereits. Er hatte feingliedrige, immer etwas unruhige Hände und legte Wert auf gute Kleidung, vor allem auf seinen Gehrock nach englischem Schnitt. Inzwischen war er Vorsitzender der Märkisch-Ökonomischen Gesellschaft und Sekretär des Gartenbauvereins. Nach dem Abschied des Onkels hatte Gustav damit begonnen, regelmäßig die Temperaturen auf der Insel zu messen, und zwar diejenige der Luft, des Wassers in der Havel und im Meiereibrunnen, als handelte es sich bei der Insel um einen Körper und beim Brunnen um eine intime Öffnung in diese hinein, die es ihm gestattete, ihre Vitaldaten zu überwachen. Jeder Liebende ist ein Überlebender. Doch auch die Toten sind weiter unter uns, als wäre nichts geschehen.
Draußen vor dem Fenster legten die noch ganz frischen Blätter der Pappeln hellgrüne Schatten über den sonnigen Sand. Gustavs Zeigefinger wischte über das Fensterbrett und zog eine dünne Spur in den Staub. Hier, zwischen dem rauhen Steinzeug der Blumentöpfe, hatte jenes alte Weinglas ohne Stiel gelegen, das er Marie damals unbedingt hatte zeigen müssen. Damit, davon war er überzeugt, hatte alles begonnen. Dieses rote Leuchten. Manchmal kam es ihm vor, als ob es sie beide nicht nur in jene Scheune geführt hätte, sondern Marie auch in eine andere, in Kunckels Welt. Die lauten Schritte der beiden größeren seiner vier Töchter polterten die Treppe hinab. Das weckte die Kleine, und er hörte, wie sie oben in ihrem Bettchen anfing zu weinen. Er registrierte, wie seine Frau vom Schlafzimmer ins Kinderzimmer hinüberging. Das Schluchzen verebbte, und in der folgenden Stille kroch der Gedanke an jenes Kind, das nicht hier war, aus seinem Herzen hervor, als wäre es sein Schweigen, das er hörte.
Liebte er seine Frau? Das war eine Frage, die er sich gemeinhin nicht stellte, auch niemals gestellt hatte, seit sie einander vorgestellt worden waren und sie beide es bei weiteren Gelegenheiten unternommen hatten, den anderen kennenzulernen. Er war sich ziemlich sicher, daß es ihr ebenso ging. Ihre Ehe entsprach dem, was sie beide gewollt hatten. Ihre Kinder der Beweis. Seine Entscheidung war richtig gewesen. Männer waren von Geburt an unmoralisch, gewalttätig, unersättlich in jeder Hinsicht, es hatte lange gedauert, bis er das begriff. Es brauchte eine Frau, um sich selbst zu erziehen. Einmal hatte er versucht, das alles Marie zu erklären, auch, was Fichte dazu schrieb, aber sie hatte ihn nicht verstanden. Die Stille nagte an ihm. Er hatte einen Sohn, den es nicht gab. Seit er denken konnte, hatte er geglaubt, Marie zu lieben. Pflanzen kennen keine Liebe. Manchmal schoß Christians Blick, mit dem er ihn damals angesehen hatte, grinsend und wissend, nackt hingelagert am Ufer in die Wurzeln der alten Grauweide, als er Marie nachgesprungen war ins Wasser, wie ein Schmerz, der einen anderen überdeckt, durch sein Empfinden von Schuld.
Marie hatte manchmal Stendhal zitiert, sie las ja in jeder freien Minute, doch er hatte nie begriffen, wieso sie gerade diesen Satz so gern mochte: La beauté n’est que la promesse du bonheur . Seltsam, daß immer alle betont hatten, wie schön seine Eltern gewesen seien. Beim Vater wußte er selbst gar nicht, ob das stimmte, zu selten war er dem aus der gescheiterten Ehe vertriebenen Bankerotteur in seiner Kindheit begegnet, aber was die Mutter anging, stimmte das wohl. Aber er hatte die Dringlichkeit nie verstanden, mit der man darauf hinwies. Seltsam: Er hatte sich nie, wirklich niemals, das konnte er beschwören, vor Maries Gestalt geekelt. Und das, obwohl ihn doch nie die Blüte, in die man sich versenkte, interessiert hatte, sondern jene Schönheit, die aus der Architektur der Pflanze erwächst, aus ihrem funktionalen Bau und damit aus ihrem Platz in der Systematik.
Lenné hatte vorgemacht, zu welcher Kraft solche Systematik in der Lage ist, wenn sie an die Stelle des Wildwuchses tritt. Vor kaum mehr als zehn Jahren hatte er die Landesbaumschule zwischen Sanssouci und Charlottenhof gegründet, die inzwischen auf einhundertdreißig Morgen jährlich anderthalb Millionen Gehölze produzierte, die größte Baumschule der Welt, und alle preußischen Alleen mit Straßenbäumen versorgte, private wie staatliche Gärten mit Obstbäumen und Gehölzen, und Jahr für Jahr zweihundertachtzigtausend Forstbäume zog. Darauf galt es aufzubauen. Palmenhaus, Menagerie und Rosengarten wurden auch im Ausland als Sehenswürdigkeiten geschätzt. Mit der Eisenbahn war die Insel nun auf eine ganz neue Weise an die Welt angeschlossen. Das entsprach Gustav, der mit Gärtnern in ganz Europa korrespondierte, seine Aufsätze in Loudons Gardener’s Magazine veröffentlichte und überall für die Insel bestellte, was ihm wichtig schien. Bedauerlich nur, daß Lenné ihn noch gar nicht besucht hatte seit seiner Anstellung. Aber so war er nun einmal. Das Projekt Pfaueninsel war für ihn abgeschlossen.
Читать дальше