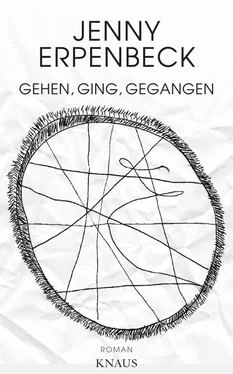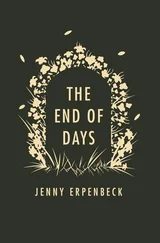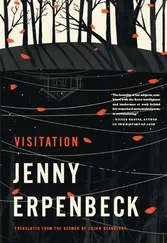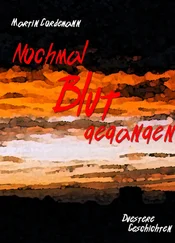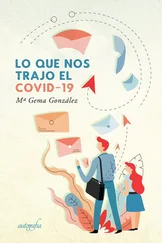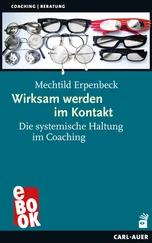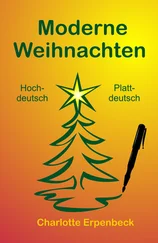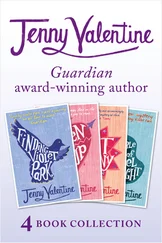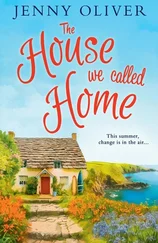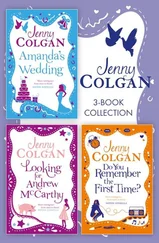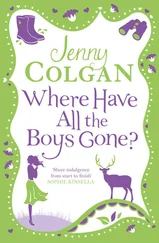Jetzt sieht der Platz wie eine Baustelle aus. Eine Landschaft aus Zelten, Bretterbuden und Planen: weiß, blau und grün. Er setzt sich auf eine Parkbank, sieht sich um und hört, was gesprochen wird. Niemand fragt hier nach seinem Namen. Was sieht er? Was hört er? Er sieht Transparente und Aufsteller mit handgepinselten Parolen. Er sieht schwarze Männer und weiße Sympathisanten. Die Schwarzen in frisch gewaschenen Hosen, bunten Jacken, gestreiften Hemden, hellen Pullovern mit farbigen Schriftzügen, wo wäscht man eigentlich Wäsche auf einem besetzten Platz? Einer trägt goldfarbene Turnschuhe, ist das Hermes? Die Sympathisanten haben weiße Haut, dafür ist ihre Kleidung schwarz und verschlissen, Hosen, T-Shirts, Pullover. Die Sympathisanten sind jung und blass, sie färben sich die Haare mit Henna, sie glauben nicht an die heile Welt, sondern wollen, dass alles anders wird, und stecken sich deshalb Ringe durch Lippen, Ohren oder die Nase. Die Flüchtlinge wiederum wollen in das, was in ihren Augen überzeugend genug wie eine heile Welt aussieht, erst einmal hinein. Hier auf dem Platz überkreuzen sich die zwei Arten des Wünschens und Hoffens, es gibt eine Schnittmenge, aber der stille Beobachter zweifelt daran, dass sie sehr groß ist.
Bevor Richard mit seiner Frau aufs Land zog, hatten sie eine Wohnung in der Stadt gehabt, nur zweihundert Meter Luftlinie vom Westen Berlins entfernt. Und lebten dort beinahe so ruhig wie später dann auf dem Land. Die Mauer hatte aus ihrer Straße eine Sackgasse gemacht, Kinder liefen dort Rollschuh. Als die Mauer 1990 dann Stück für Stück weggeräumt wurde, standen pünktlich zur Eröffnung eines jeden neuen Übergangs zahlreiche gerührte Westberliner da und hießen ihre Brüder und Schwestern aus dem Osten willkommen. Hießen eines Morgens um 9.30 Uhr mit Tränen in den Augen auch ihn willkommen, den Ostberliner, der zufällig in dieser Straße wohnte, die neunundzwanzig Jahre geteilt gewesen war, auf seinem Weg in die Freiheit. Er aber war an diesem Morgen gar nicht auf dem Weg in die Freiheit gewesen, sondern nur auf dem Weg zur Universität — pünktlich mit der Öffnung dieses Teilstücks der Mauer hatte er den S-Bahnhof erreichen wollen, der sich auf der Westseite der Straße befand. Mit den Ellenbogen hatte er sich, ungerührt und in Eile, durch die gerührte Menschenmenge gekämpft, irgendeine Beschimpfung rief ihm einer der enttäuschten Befreier noch nach, aber Richard erreichte die Universität zum ersten Mal in weniger als zwanzig Minuten.
Noch bis vor einem Jahr war die Parkbank, auf der er jetzt sitzt, eine ganz normale Parkbank in einer Grünanlage in Kreuzberg. Spaziergänger saßen hier, erholten sich, ruhten aus. Den Kanal, den es zu Lennés Zeiten hier gegeben hatte, ließ die Stadtverwaltung in den zwanziger Jahren des letzten Jahrhunderts wieder zuschütten, weil er so stank. Ob das Wasser trotzdem noch immer in der Tiefe zwischen den Sandkörnern fließt?
Zur Erholung sitzt jetzt jedenfalls niemand mehr hier. Und dass auch Richard nicht gleich wieder aufsteht, liegt nur daran, dass er nicht zur Erholung hier ist. Das selbstverständliche Sitzen auf einer Parkbank hat durch die schwarzhäutigen Menschen, die auf den Grünflächen hinter den Bänken kampieren, aufgehört, etwas Selbstverständliches zu sein. Berliner, die seit Lennés Zeiten wussten, wie man sich in diesem Park, auf einer Bank sitzend, verhielt, wissen es nicht mehr: Keine alte Frau füttert die Spatzen, keine Mutter schaukelt den Kinderwagen sacht hin und her, kein Student liest, keine drei Trinker halten hier ihr Vormittagstreffen ab, kein Beamter isst seinen Mittagsimbiss, kein Liebespaar hält sich bei der Hand.»Die Verwandlung des Sitzens «wäre auch ein guter Titel für einen Aufsatz. Richard bleibt sitzen, und zwar trotzdem. Immer wenn ein Trotzdem erscheint, das ist seine Erfahrung, wird es interessant.»Die Geburt des Trotzdem «wäre auch ein guter Titel.
Die einzige weißhäutige Person, die hier auf dem Platz ebenso zu Hause zu sein scheint wie die Flüchtlinge, ist eine knochige Frau Anfang vierzig. Sie zeigt einem Türken, wo er die Fladenbrote, die er spenden will, hinbringen kann. Etwas später nimmt sie von einem bärtigen Mann ein Fahrrad entgegen und gibt es an einen der Flüchtlinge weiter, beide schauen dem Flüchtling beim glücklichen Losfahren zu. Übrigens, der hat einen Steckschuss in der Lunge, sagt sie noch, der Bärtige nickt, Libyen, sagt sie, er nickt, dann schweigen beide einen Moment, der Mann sagt, dann will ich mal wieder. Eine junge Frau mit einem Mikrofon in der Hand kommt auf die Knochige zu.
Sie gebe kein Interview im Moment, sagt die knochige Frau.
Aber es sei doch wichtig, dass die Berliner.
Sie wissen vielleicht, dass gerade verhandelt wird über ein Winterquartier.
Deswegen bin ich ja, sagt die junge Frau.
Sieht er vielleicht schon aus wie ein Penner, dass es die beiden Frauen nicht stört, wenn er nur einen halben Meter entfernt von ihnen sitzt und ihnen zuhört?
Dann wissen Sie vielleicht auch, dass das Angebot des Senats von jetzt bis April heißt: pro Mann und Nacht 18 Euro.
Ja, davon hab ich.
Nun, sagt die Knochige, der einzige, der den Männern ein Haus geben will, verlangt jetzt schon doppelt soviel. Wenn Sie also schreiben: Es gibt Ratten hier und nur noch vier Klos, manchmal drei Tage nichts Warmes zu essen, und schreiben: schon im letzten Winter sind die Zelte unter dem Schnee zusammengebrochen — dann verspreche ich Ihnen: Über Ihren Artikel freut sich nur dieser Investor.
Ach so, sagt die junge Frau, verstehe, sagt sie, und lässt das Mikrofon sinken.
Wieder denkt Richard, wie er es schon oft in den letzten Jahren gedacht hat, dass die Wirkungen von dem, was einer tut, beinahe immer unübersehbar sind, und oft sogar das genaue Gegenteil von dem sind, was einer durch sein Handeln ursprünglich erreichen wollte. Dass es auch hier so ist, liegt vielleicht daran, denkt er, dass es sich bei der Auseinandersetzung des Senats mit den Flüchtlingen letztendlich um ein Grenzproblem handelt, und sich an einer Grenze, mathematisch formuliert, die Vorzeichen häufig verkehren. Kein Wunder, denkt er, dass das Wort handeln mit dem Tun nicht weniger eng verwandt ist als mit dem Verkaufen.
Ohne das Mikro wieder einzuschalten, quasi nur so, als Mensch, fragt die junge Frau die Knochige noch:
Was machen die Männer eigentlich hier den ganzen Tag, wenn sie nicht arbeiten dürfen?
Nichts, sagt die knochige Frau. Und im Abwenden sagt sie noch: Wenn das Nichtstun zu schlimm wird, organisieren wir eine Demo.
Verstehe, sagt die junge Frau und nickt der Knochigen zu, die jetzt fortgeht.
Dann packt sie das Mikrofon wieder ein, mit dem Rücken zu ihm steht sie noch immer direkt vor seiner Bank, ohne zu merken, dass sie all die Zeit über einen stummen Zuschauer hat. Die Knochige geht indes zu dem offenen Zelt hinüber, das die Küche zu sein scheint, unterwegs hebt sie einen hölzernen Aufsteller auf, der umgefallen ist und dabei in eines der Zelte ein Loch gerissen hat.
Richard sieht, wie ein schwarzer Mann zu einem anderen hingeht und diesem zur Begrüßung die Hand schüttelt. Er sieht eine Gruppe von fünf Männern beisammenstehen und reden, einer von ihnen telefoniert. Er sieht den, der das Fahrrad geschenkt bekommen hat, im Kreis um den Platz fahren, manchmal auch auf den Kieswegen in abenteuerlichen Kurven zwischen den anderen Männern hindurch. Er sieht drei Männer in einem offenen Zelt hinter einem Tisch sitzen, vor sich einen Pappkarton mit der Aufschrift Spenden . Er sieht einen Älteren allein auf der Lehne einer Bank sitzen, der hat ein kaputtes Auge. Er sieht, wie einer mit einer blauen Tätowierung im Gesicht einem anderen auf die Schulter klopft und fortgeht. Er sieht einen der Männer mit einer Sympathisantin reden. Er sieht einen in einem Zelt, dessen Plane zurückgeschlagen ist, auf einer Liege sitzen, der hält ein Telefon in der Hand und tippt etwas ein. Von dem, der auf der Liege daneben liegt, sieht er nur die Füße. Er sieht zwei, die in einer ihm unverständlichen Sprache miteinander diskutieren, als der eine jetzt lauter wird und den anderen gegen die Brust stößt, so dass der nach hinten taumelt, muss der Fahrradfahrer einen Bogen um die beiden machen. Er sieht die Knochige mit einem Mann sprechen, der einen Topf in der Hand hält. Er sieht das prächtige Eckhaus, das den Hintergrund für das alles abgibt. Es mag ungefähr aus der Zeit stammen, als hier, wo er jetzt sitzt, noch der Kanal war. Es sieht wie ein ehemaliges Kaufhaus aus, aber nun ist im Erdgeschoss eine Bank. Als hier der Kanal war, hatte Deutschland noch Kolonien. Kolonialwarenladen stand in verwitterter Schrift an manchen Fassaden im Osten Berlins noch bis vor zwanzig Jahren zu lesen, bevor der Westen anfing zu renovieren. Kolonialwaren und die Einschüsse vom Zweiten Weltkrieg auf ein und derselben Fassade, und in der verstaubten Vitrine eines solchen für die Renovierung schon leergezogenen Hauses vielleicht obendrein noch ein sozialistisches Pappschild: Obst Gemüse Speisekartoffeln (OGS) . Auf dem Globus, der bei ihm im Arbeitszimmer steht, ist noch Deutsch-Ostafrika verzeichnet. Über dem Marianengraben hat sich die Pappe, mit der die Kugel bezogen ist, etwas gelöst, aber der Globus sieht trotzdem noch schön aus. Wie Deutsch-Ostafrika heute heißt, weiß Richard nicht. Gab es zu der Zeit, als dort, wo er jetzt sitzt, ein Kanal war, in dem Kaufhaus da drüben vielleicht Sklaven zu kaufen? Haben womöglich schwarze Diener den Zeitgenossen Lennés die Kohlen in den vierten Stock hinaufgetragen? Bei dieser Vorstellung muss er grinsen, aber wenn man als älterer Herr allein auf einer Parkbank sitzt und vor sich hin grinst, mag anderen das bedenklich erscheinen. Worauf wartet er überhaupt? Glaubt er wirklich, dass nach einem ganzen Jahr, in dem die Männer schon hier auf dem Platz kampieren, ausgerechnet heute, an diesem beliebigen Tag, an dem er aus der Vorstadt hierhergekommen ist, sich etwas Unvorhergesehenes ereignet? Es ereignet sich nichts, und als er nach zweieinhalb Stunden anfängt zu frösteln, erhebt er sich von der Bank und fährt wieder nach Hause.
Читать дальше