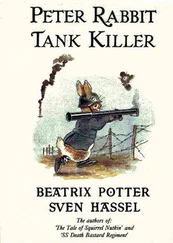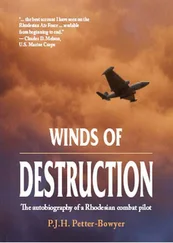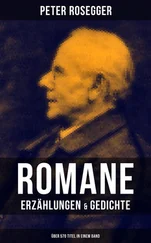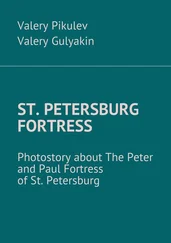IN DIESEM ZUSAMMENHANG kommt mir die Geschichte mit der Cousine in den Sinn, in die ich pubertierender Junge verliebt war, mit zwölf, dreizehn Jahren. In Halle an der Saale. Da steht eine Burg überm Tale und schaut in den Strom hinein, das ist die fröhliche Saale, das ist der Giebichenstein, da hab ich so oft gestanden, es blühten Täler und Höhn, und seitdem in allen Landen sah ich nimmer die Welt so schön. Im Sommer sehe ich mich landverschickt. Es geht in die Stadt der Chemiearbeiter. Die Reise ist großartig, das Ziel von Jahr zu Jahr weniger lockend. Ich sitze im Bus. Der Bus setzt mich am Bahnhof ab. Ich werde von der Adoptionsmutter begleitet. Sie erwirbt die Fahrkarte für mich, redet auf mich ein, was ich zu tun und was zu lassen habe, als würde es was nutzen. Wenn ich auf dem für mich reservierten Platz sitze, sind alle Vorgaben vergessen. Ich stehe die Fahrt über am Fenster, zähle Rehe, Hasen, Füchse, Pferde, Kühe, bin die Fahrtzeit über hinlänglich beschäftigt, werde von Onkel Horst abgeholt, der um die fünfzig Jahre alt ist, eine glänzende Glatze zum pechschwarzen Haarkranz trägt, über sein gesamtes Gesicht lacht und stets auch was zum Lachen hat, selbst wenn es regnet, ihn die Leute rempeln. Eine unbekümmerte, regelrechte Frohnatur ist dieser Onkel, fragt lachend an, was die Adoptionsmutter mir da wieder für seltsam alt machende Sachen übergeholfen hat, die nicht zu mir passen, mit denen ich mich in seiner Gegend bei den Kindern lächerlich mache. Ich stimme ihm heimlich zu und habe große Schwierigkeiten mit seinem Dialekt. Die Großmutter belustigt sich über die breite Aussprache der Hallenser: Die sprechen nicht, die maulen. Die lassen zudem im Wald die Hasen runter und sehen dann Hosen über die Lichtung hoppeln. Breiter als der Onkel walzt die Tante den Dialekt aus. Sitzt ewig in ihrer Küche am Küchentisch vorm Aschenbecher und hat allezeit einen Kittel an, besitzt deren viele, trägt sie während der Arbeit im kleinen Kaufmannsladen um die Ecke, beim näheren Hinsehen scheint die Unterwäsche hervor: Kenn di Laut ruhich sän, hob ä nix zu verbärschn oder. Sie trägt den Tag über Kittel. Vielleicht geht sie mit ihrem Kittel auch zu Bett. Sie keucht mehr, als dass sie lacht, wirbelt zu jedem einzelnen Wort ihre Zigarettenhand, haut sich auf die dünnen Schenkel, wobei dann die Asche auf den Fußboden fällt oder als Teilstück auf dem Tischtuch landet, das mit so einigen Löchern versehene, von Kippenglut ins Tuch gebrannt. Sie leckt den Mittelfinger ihrer Hand an, bringt Kuppe und Spucke über die Asche, die im Ganzen am Finger kleben bleibt, was ich als Zauberei ansehe: Gelle, Jungchen, verstehst nichts von Tutenblasen, staunste nur. Zu den Verwandten gehören die zwei Töchter, eine ist dünn, lang und schwarzhaarig und für mich fast schon eine Frau, die andere ist in meinem Alter, kleiner als ihre Schwester und pummelig dazu, mit schönen Grübchen im Gesicht, die erscheinen, wenn das Mädchen lacht. Ich bin in die Pummelige verliebt, der wunderschönen Augen wegen, zwei schwarze Perlen. Durch die Eltern angewiesen, mit mir die Stadt zu erkunden, mir die Schönheiten der Stadt zu zeigen, ziehen wir zu zweit durch die Hallenser Straßen. Das Mädchen zeigt auf ein Haus und erklärt es mir. Das Mädchen zeigt auf einen Platz und unterrichtet mich von ihm, wie auch vom Denkmal, auf dem der deutsche Komponist steht, Vertreter des Spätbarock, in Halle geboren, in Hamburg Konzertmeister am Hamburger Opernhaus, hat seine erste Oper mit zwanzig Jahren geschrieben, Almira, sagt sie. Ich merke mir den Namen der Oper und nehme mir vor, die Oper zu hören und all die anderen Musikstücke, von denen ich aus ihrem süßen Mund erzählt bekomme. Sie sagt Italien, Florenz, Rom und ich sehe der Cousine immer auf den Mund, der von Adel und Geistlichkeit spricht, Kantaten, die Feuerwerksmusik, die Wassermusik. Ich habe noch nie eine klassische Musik gehört. Der ist doch erst aus dem Kinderheim gekommen, sagen ihre Eltern zur Cousine, die meint, ich müsse trotzdem wissen und kennen. Und fühl mich recht wie neu geschaffen, wo ist die Sorge nun und Not, was mich gestern wollt erschlaffen, ich schäm mich des bei Morgenrot. Ich muss die schöne Cousine immer wieder ansehen, wie sich beim Reden die Lippen bewegen, die Grübchen beim Lächeln entstehen und vergehen. Das Haar fliegt nach hinten, wenn sie ihren Kopf bewegt. Ich fahre mit der Cousine Straßenbahn. Straßenbahnfahren finde ich wunderbar. Ich schmiege mich an die Cousine, dränge sie an die Scheibe, folge ihrem Finger, der auf Sehenswürdigkeiten draußen zeigt, rücke dichter und dichter an sie heran. Wir krabbeln einen Berg empor, genießen die Aussicht auf den Fluss unterhalb, die Landschaft hinterm Fluss unterhalb und sitzen in einem Garten, trinken Brause aus dem Fass von dem Geld, das ihr der Vater mit auf den Weg gegeben hat. Auf dem Fluss, auf den Landwegen überall sind sie mit Kutschwerken herumgefahren, früher, haben Salz transportiert, weite Routen ins Land hinein, über die Landesgrenzen hinaus, spricht der Mund. Ob es mir nicht aufgefallen wäre: Halle, Saale, Salze, Salz, salarii. Ob ich wisse, dass Salz einmal das weiße Gold genannt worden ist. Und wie wir aufstehen, weitergehen, fasst die Cousine mich bei der Hand, geht Hand in Hand mit mir bis nach Halle, lässt meine Hand erst am Stadtrand wieder los. Ich bin so glücklich, auch wenn die Cousine so streng mit mir geredet und die Stimme gegluckst hat. Tante und Onkel freuen sich: Wie gut ihr euch versteht. Was für ein schönes Paar ihr seid. Kurz und unabsichtlich kratzt mich die Cousine mit ihrem Fingernagel. Etwas Blut tritt aus, ein dünner Schorf bildet sich. Ich sitze im Zug zurück zwischen Reisenden eingeklemmt und bin mit nichts seliger beschäftigt als meinem kleinen Ratscher, dem Erinnerungsstück an die Cousine, das ich als liebes Andenken an sie und die Tage in der Stadt an der Saale bewahren will. Daheim angekommen, ziehe ich mich auf den Dachboden zurück, verfalle dem ersten, fetten Liebeskummer, stehe stundenlang am Fenster, blicke zum Hof heraus, wo der Hahn den Hennen hinterherrennt, Hühner picken und sich bespringen lassen. Ich esse nicht. Ich halte mich im abgedunkelten Eckchen auf und reiße mir den Schorf von der Wunde, dass Blut austritt; eine Weile geht das so, dann bildet sich kein neuer Schorf; die Wunde heilt aus. Ich ritze meinen Finger, weite den Kratzer der Cousine aus, schneide mir mit der Rasierklinge tief ins Fleisch, will der Cousine später die Wunde zeigen können, in einem halben, einem dreiviertel Jahr, wenn es wieder nach Halle an die Saale geht, die Verwandtschaft besuchen, Onkel und Tante, von denen die Cousine die jüngste Tochter ist und meine Liebe. Ich will die Cousine später heiraten. Ich bin, was die beabsichtigte Heirat und späteren Kindersegen anbelangt, für mein Alter manierlich unterrichtet, weiß selbstredend, dass von den Verwandten eines Adoptionskindes niemand mit mir verwandt ist, ich die Cousine also lieben und heiraten darf und mit ihr ein Kind haben kann, ohne dass das Kind ein schwachsinniger Depp würde. Ich will der Cousine meinen Liebesratscher vorweisen, er wird mein Heiratsantrag sein, ich muss Sorge tragen, dass die Wunde nicht verschwindet.
NACH DEM TOD DER ADOPTIONSMUTTER entdecke ich jene drei Kartons, nicht üppig gefüllt, schmale Zigarrenkisten, in ihnen Fotos aus den heftigen Sehnsuchtstagen. Ein schönes halbes Dutzend Fotografien erwärmen mir das Herz, zeigen mich neben der Cousine am hellen Saalestrande, in der Pioniereisenbahn, eng beisammen, Kopf an Kopf, auf dem Sitz am Fenster, um das sich der Pionierpark langsam dreht, wie wir meinen, die wir uns nicht bewegen, steif beisammensitzen und regungslos sind, unsere ersten zarten Regungen genießen, Wange an Wange, getarnt als gemeinsames Interesse an dem, woran unsere Liebesbahn vorbeifährt. Die Cousine ist bei uns daheim am Ostseestrand festgehalten, von der Großmutter abgelichtet. Ich stecke in dieser schrecklichen, schwarzen Dreiecksbadehose, eine Nummer zu groß geraten.
Читать дальше