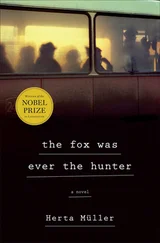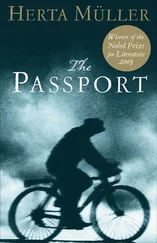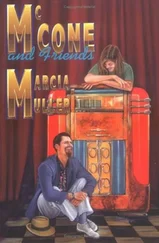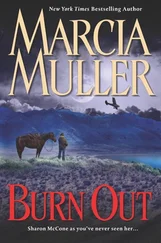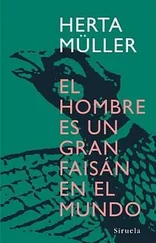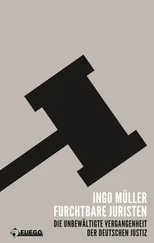Nicht umsonst erwartete Tur Prikulitsch, dass ich mich beklage. Nur deshalb fragte er alle paar Tage in der Rasierstube:
Und, wie ist es bei euch im Keller.
Wie geht es im Keller.
Was macht der Keller.
Klappt es im Keller.
Oder nur: Und im Keller.
Und weil ich ihm den Schneid abkaufen wollte, blieb ich immer bei derselben Antwort: Jede Schicht ist ein Kunstwerk.
Wenn er nur den kleinsten Schimmer gehabt hätte von der Mischung aus Kohlegasen und Hunger, hätte er fragen müssen, wo ich mich herumtreibe im Keller. Und ich hätte sagen können, bei der Flugasche. Denn auch die Flugasche ist eine Art kalte Schlacke, treibt sich überall herum und überzieht den ganzen Keller mit Pelz. Auch mit der Flugasche kann man sich glücklich machen. Sie hat kein Gift und gaukelt. Sie ist mausgrau, samtig und riecht nicht, besteht aus Plättchen, winzigkleinen Schuppen. Sie wuselt ständig und hängt sich wie Rauhreifkristalle an alles. Jede Oberfläche verpelzt. Im Licht macht die Flugasche aus dem Drahtnetz der Glühbirne einen Zirkuskäfig mit Läusen, Wanzen, Flöhen und Termiten. Die Termiten haben Hochzeitsflügel, hab ich in der Schule gelernt. Ich habe sogar gelernt, die Termiten leben in Lagern. Sie haben einen König, eine Königin und Soldaten. Und die Soldaten haben große Köpfe. Es gibt Kiefersoldaten, Nasensoldaten und Drüsensoldaten. Und alle werden von den Arbeitern gefüttert. Und die Königin ist dreißig mal größer als die Arbeiter. Ich glaube, das ist auch der Unterschied zwischen dem Hungerengel und mir oder Bea Zakel und mir. Oder Tur Prikulitsch und mir.
In Verbindung mit Wasser fließt nicht das Wasser, sondern die Flugasche, indem sie Wasser trinkt. Sie bläht sich auf zu Tropfsteinservicen und noch viel größer zu Betonkindern, die graue Äpfel essen. In Verbindung mit Wasser kann die Flugasche zaubern.
Ohne Licht und Wasser sitzt sie tot herum. An den Kellerwänden wie echter Pelz, auf der Wattemütze wie Kunstpelz, in den Nasenlöchern wie Gummistopfen. Das Gesicht von Albert Gion, so schwarz wie der Keller, sieht man nicht, nur sein Augenweiß schwimmt durch die Luft und seine Zähne. Bei Albert Gion weiß ich nie, ob er nur verschlossen oder traurig ist. Wenn ich ihn frage, sagt er: Darüber denke ich nicht nach. Wir sind zwei Kellerasseln, das meine ich ernst.
Nach Schichtschluss gehen wir duschen in die Banja neben dem Fabrikstor. Kopf, Hals, Hände werden dreimal eingeseift, aber die Flugasche bleibt grau und die kalte Schlacke violett. Die Kellerfarben waren in die Haut gefressen. Mich störte es nicht, ich war sogar ein wenig stolz, es waren ja auch die Farben des Selbstbetrugs.
Bea Zakel bedauerte mich, überlegte eine Weile, wie sie das schonend formulieren könnte, wusste aber, dass es eine Kränkung war, als sie sagte: Du bist wie aus einem Stummfilm, du gleichst dem Valentino.
Sie hatte sich die Haare frisch gewaschen, ihr Seidenzopf war glatt geflochten und noch feucht. Ihre Wangen waren gut genährt und röteten sich wie Erdbeeren.
Als Kind lief ich, während die Mutter und die Fini-Tante Kaffee tranken, durch den Garten. Ich sah zum ersten Mal in meinem Leben eine dicke reife Erdbeere und rief: Kommt mal her, hier brennt ein Frosch und leuchtet.
Ein Stückchen glühend heißer Kellerschlacke habe ich aus dem Lager nach Hause mitgebracht, am rechten Schienbein außen. Es ist in mir ausgekühlt und hat sich in kalte Schlacke verwandelt. Es schimmert durch die Haut wie eine Tätowierung.
Mein Kellerkompagnon Franz Gion hatte auf dem Heimweg von der Nachtschicht gesagt: Jetzt, wo es warm wird, kann man, wenn man nichts zu Essen hat, den Hunger wenigstens in der Sonne wärmen. Ich hatte nichts zu essen und ging in den Lagerhof, meinen Hunger wärmen. Das Gras war noch braun, niedergedrückt und vom Frost verbrannt. Die Märzsonne hatte bleiche Fransen. Überm Russendorf war der Himmel aus gewelltem Wasser, und die Sonne ließ sich treiben. Und mich trieb der Hungerengel zum Abfall hinter die Kantine. Dort lagen womöglich Kartoffelschalen, wenn noch niemand vor mir da war, die meisten waren noch in der Arbeit. Als ich neben der Kantine Fenja im Gespräch mit Bea Zakel sah, nahm ich die Hände aus den Taschen und wechselte in den Spazierschritt. Zum Abfall konnte ich jetzt nicht. Fenja trug diesmal ihre lila Häkeljacke, und mir fiel mein weinroter Seidenschal ein. Nach dem Fiasko mit den Gamaschen wollte ich nicht mehr auf den Basar. Wer so gut wie Bea Zakel reden konnte, konnte auch gut handeln und meinen Schal tauschen für Zucker und Salz. Fenja hinkte gequält in die Kantine zu ihrem Brot. Kaum stand ich vor Bea, fragte ich: Wann gehst du auf den Basar. Sie sagte: Vielleicht morgen.
Bea hatte Ausgang, wann sie wollte, Passierscheine bekam sie ja von Tur, wenn sie überhaupt welche brauchte. Sie wartete auf der Bank am Lagerkorso, und ich ging den Schal holen. Er lag ganz unten im Koffer neben meinem weißen Taschentuch aus Batist. Ich hatte ihn monatelang nicht mehr angefasst, er war zart wie Haut. Es überlief mich, ich schämte mich vor seinen fließenden Karos, weil ich so verwahrlost war und er immer noch anschmiegsam mit den glänzend und matt versetzten Würfeln. Er hatte sich im Lager nicht verändert, er bewahrte im gewürfelten Muster die ruhige Ordnung von früher. Er war nichts mehr für mich, also ich nichts mehr für ihn.
Als ich ihn Bea übergab, glitten ihre Augen wieder in die zögernde Drehung, die etwas vom Schielen hatte. Ihre Augen waren enigmatisch, das einzig Schöne an ihr. Sie legte sich den Schal um den Hals und konnte nicht widerstehen, überkreuzte die Arme und streichelte ihn mit beiden Händen. Ihre Schultern waren schmal, die Arme dünne Stecken. Aber Hüften und Hintern waren mächtig, ein Fundament aus klobigen Knochen. Mit einem zierlichen Rumpf und einem massiven Unterleib war Bea Zakel aus zwei Staturen zusammengesetzt.
Bea hat den weinroten Schal mitgenommen zum Tauschen. Doch am nächsten Tag beim Appell trug Tur Prikulitsch den Schal an seinem Hals. Und die ganze nächste Woche. Er hatte meinen weinroten Seidenschal zum Appellfetzen gemacht. Jeder Appell war seither auch noch die Pantomime meines Schals. Und er stand ihm gut. Meine Knochen waren bleischwer, mit dem Ein- und Ausatmen in einem, mit den Augen hinaufdrehen und an Wolkenrändern einen Haken finden, klappte es nicht. Mein Schal an Tur Prikulitschs Hals ließ es nicht zu.
Ich riss mich zusammen und fragte Tur Prikulitsch nach dem Appell, woher er den Schal hat. Er sagte, ohne zu zögern: Von zu Hause, den hatte ich schon immer.
Er erwähnte Bea nicht, zwei Wochen waren vergangen. Ich hatte von Bea Zakel noch keinen Krümel Zucker oder Salz bekommen. Hatten die beiden Sattgefressenen eine Ahnung, wie schwer sie meinen Hunger betrogen. Hatten nicht sie mich verelenden lassen, dass mein eigener Schal nicht mehr zu mir passte. Wussten sie nicht, dass es mein Eigentum war, solang ich noch nichts dafür bekommen hatte.
Ein ganzer Monat verging, die Sonne blieb nicht so fad. Das Meldekraut wuchs wieder silbergrün, der wilde Dill gefiedert. Ich kam aus dem Keller und pflückte ins Kissen. Beim Bücken kippte mir das Licht weg, ich sah nur schwarze Sonne vor den Augen. Ich kochte mein Meldekraut, es schmeckte nach Schlamm, ich hatte immer noch kein Salz. Und Tur Prikulitsch trug immer noch meinen Schal, und ich ging immer noch zur Nachtschicht in den Keller und danach durch die leeren Nachmittage hinter die Kantine zum Abfall, der besser schmeckte als mein Falscher Spinat ohne Salz oder Meldekrautsuppe ohne Salz.
Auf dem Weg zum Abfall traf ich wieder Bea Zakel, und sie fing auch diesmal einfach an zu reden von den Beskiden, die in die Waldkarpaten münden. Und als sie aus ihrem kleinen Dorf Lugi nach Prag gekommen war und Tur vom Missionar endlich auf Handel umgesattelt hatte, fiel ich ihr ins Wort und fragte:
Читать дальше